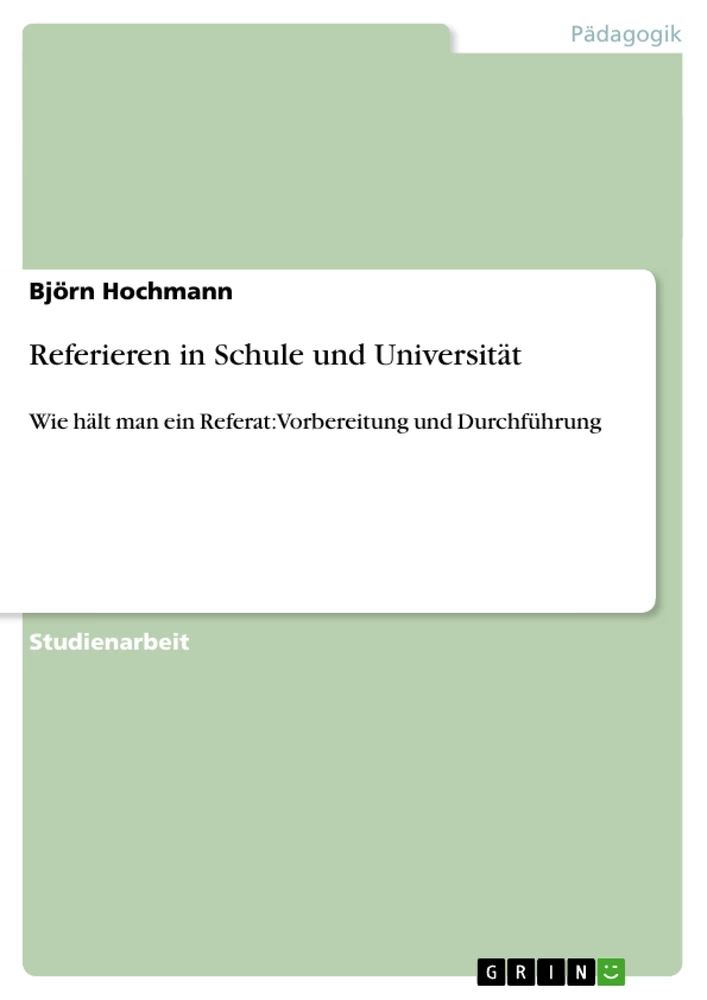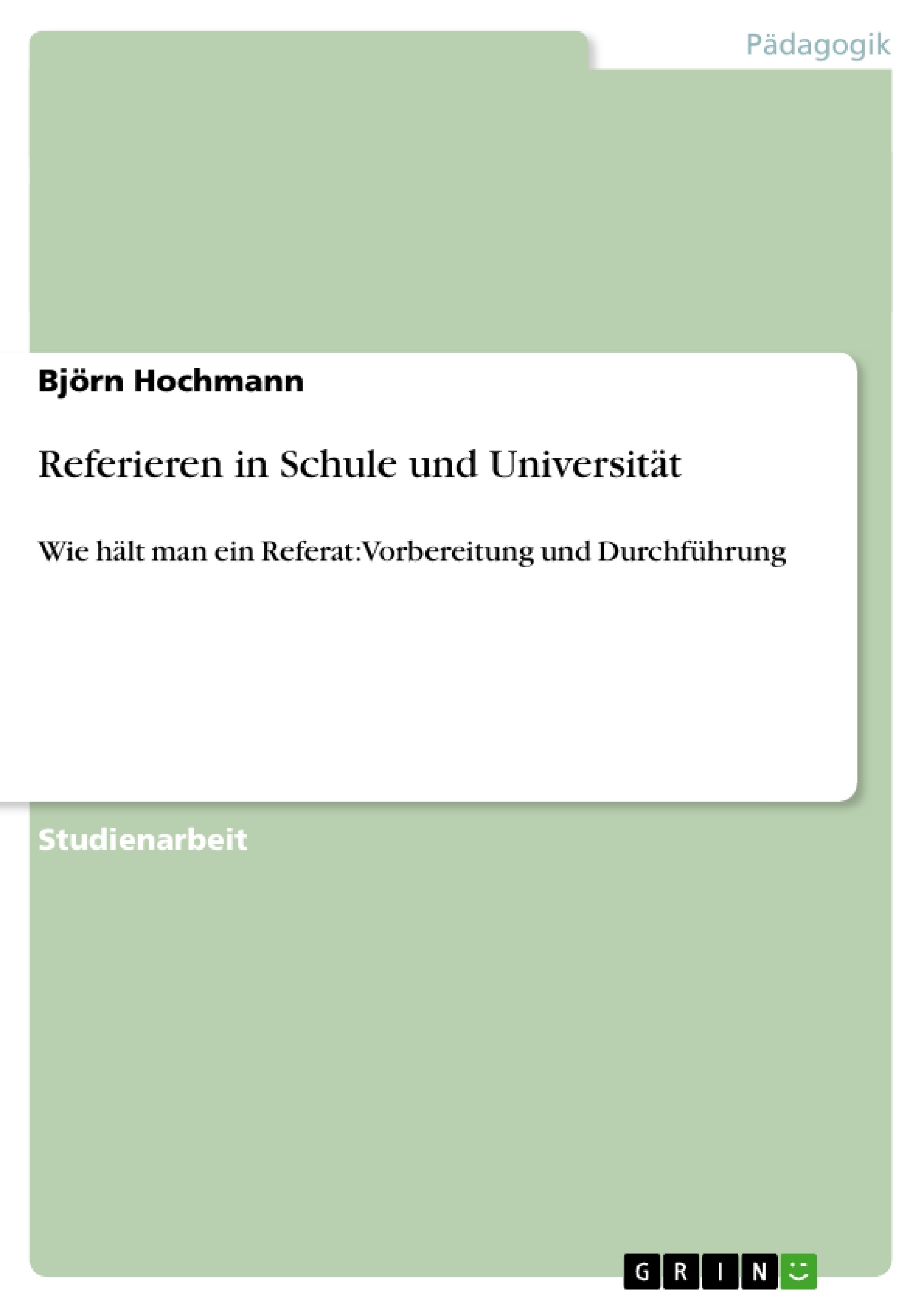Es gibt heutzutgae kaum noch einen Studiengang oder ein berufliches akademisches Feld, in dem man nicht irgendwann einmal einen freien Vortrag o. Ä. halten muss. Schon das Wort "Referat" löst bei vielen Menschen Panik aus. Ein Referat zu übernehmen und auch mit möglicher Angst umzugehen, ist aber nichts, was man nicht lernen könnte. Für ein richtiges, d.h. für die Zuhörer interessantes, langfristig lehrreiches, vielleicht spannendes Referat gehört etwas Übung und ein gewisses Handwerkzeug, dass diese Arbeit zu vermitteln versucht.
Ein Referat bietet eine große Chance für den Referenten. Hier kann gezeigt werden, dass man über bestimmte Schlüsselqualifikationen verfügt. Und das sind nicht wenige. Knobloch zählt zu diesen Soft Skills explizit: "Konzentrationsfähigkeit, Fähigkeit zum vernetzten Denken, Vorstellungsvermögen, Kritikfähigkeit, Problembewusstsein, Leistungsbereitschaft, Planungsfähigkeit, Kreativität, Transferfähigkeit, analytisches Denken, Urteilsfähigkeit, Genauigkeit, Interesse, Organisationsfähigkeit, Beherrschung von Arbeitstechnicken und Problemlösungsstrategien, Interpretationsfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Medienkompetenz, Sprachkompetenz, Untersuchungsfähigkeit, Unterscheidungsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Verantwortungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Belastbarkeit."
Diese Arbeit gibt nicht nur die üblichen Ratschläge zur Gliederung, Stoffsammlung oder rhetorische Hinweise zum Vortag. Es werden auch Themen wie Lampenfieber und Atemtechnik ange-sprochen oder wie man mit Störungen und Zwischenrufen umgehen kann. Zu den wichtigsten Problemfeldern bietet diese Arbeit auch spezielle Übungen an.
Die Arbeit schließt nicht mit dem sonst üblichen Fazit ab, sondern mit einer Checkliste, die spiegelstrichartig die wichtigsten Punkte zur Vorbereitung und Durchführung des Referats noch einmal kompakt und übersichtlich zusammenfasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorbereitung des Referates
- 2.1 Themenwahl und erste Vorbereitungen
- 2.2 Informationsbeschaffung, Stoffsammlung und Strukturierungsphase
- 2.3 Freier Vortrag vs. Ablesen
- 2.4 Weitere Planung und Medieneinsatz
- 2.5 Der Redestil
- 2.5.1 Der Wortschatz
- 2.5.2 Fremdwörter und Modewörter
- 2.5.3 Stilistische Untugenden
- 2.6 Abschließende Checkliste (Teil I)
- 3. Durchführung des Referats
- 3.1 Lampenfieber
- 3.2 Sprechkultur: Betonung, Tempo, Lautstärke
- 3.3 Körpersprache: Standort und Haltung
- 3.4 Körpersprache: Gestik und Mimik
- 3.5 Die ersten Minuten: Begrüßung und Bindung des Publikums
- 3.6 Der Hauptteil
- 3.7 Schlussteil
- 3.8 Zwischenrufe, Störungen, Fragen
- 3.9 Abschließende Checkliste (Teil II)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, Studierenden und Schülern eine umfassende Anleitung zur Vorbereitung und Durchführung von Referaten an die Hand zu geben. Sie geht über die bloße Wissensvermittlung hinaus und behandelt wesentliche Aspekte einer erfolgreichen Präsentation, einschließlich der Bewältigung von Lampenfieber und dem Umgang mit unerwarteten Situationen.
- Vorbereitung eines Referats: Themenwahl, Informationsbeschaffung, Strukturierung.
- Der Redestil: Wortschatz, Stilmittel, Vermeidung stilistischer Fehler.
- Durchführung eines Referats: Lampenfieber bewältigen, Körper- und Sprechsprache effektiv einsetzen.
- Umgang mit Publikum: Begrüßung, Interaktion, Fragen beantworten.
- Methodisch-didaktische Strategien für effektive Wissensvermittlung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung der Referatskunst im akademischen Kontext und hebt die Notwendigkeit methodisch-didaktischer Strategien hervor. Sie stellt das Referat nicht nur als reine Wissensvermittlung dar, sondern als eine „Performance“, die Schlüsselqualifikationen wie Konzentrationsfähigkeit, analytisches Denken und Kommunikationsfähigkeit erfordert. Die Arbeit verspricht praktische Tipps und Übungen zur Bewältigung von Herausforderungen wie Lampenfieber und Umgang mit Zwischenrufen.
2. Vorbereitung eines Referates: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Vorbereitungsphase eines Referats, beginnend mit der Themenwahl und Terminplanung. Es unterstreicht die Bedeutung einer klaren Strukturierung des Stoffes und der Informationsbeschaffung. Der Abschnitt zum Redestil betont die Wichtigkeit eines passenden Wortschatzes und die Vermeidung stilistischer Mängel. Die abschließende Checkliste dient der Selbstkontrolle vor dem Vortrag.
3. Durchführung des Referats: Der dritte Abschnitt konzentriert sich auf die praktische Durchführung des Referats. Es werden Strategien zur Bewältigung von Lampenfieber, Tipps zur Verbesserung der Sprechkultur und Körpersprache vermittelt. Besonderes Augenmerk liegt auf der Begrüßung des Publikums, der Gestaltung des Haupt- und Schlussteils sowie dem Umgang mit Zwischenrufen und Fragen. Eine zweite Checkliste dient der nochmaligen Überprüfung wichtiger Punkte vor dem Vortrag.
Schlüsselwörter
Referat, Präsentation, Vorbereitung, Durchführung, Redestil, Körpersprache, Lampenfieber, Kommunikation, Wissensvermittlung, methodisch-didaktische Strategien, Schlüsselqualifikationen.
Häufig gestellte Fragen zum Referat-Leitfaden
Was beinhaltet dieser Referat-Leitfaden?
Dieser Leitfaden bietet eine umfassende Anleitung zur Vorbereitung und Durchführung von Referaten. Er umfasst ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Leitfaden behandelt alle wichtigen Aspekte, von der Themenwahl und Informationsbeschaffung bis hin zur Bewältigung von Lampenfieber und dem Umgang mit dem Publikum.
Welche Phasen der Referatsvorbereitung werden behandelt?
Der Leitfaden beschreibt detailliert die Vorbereitungsphase, einschließlich Themenwahl, Informationsbeschaffung, Strukturierung des Stoffes und die Gestaltung des Redestils. Besonderes Augenmerk wird auf die Auswahl des passenden Wortschatzes und die Vermeidung stilistischer Fehler gelegt. Checklisten unterstützen die Selbstkontrolle.
Wie unterstützt der Leitfaden bei der Durchführung des Referats?
Der Leitfaden liefert praktische Tipps für die Durchführung des Referats, wie z.B. Strategien zur Bewältigung von Lampenfieber, Verbesserung der Sprechkultur und Körpersprache. Es werden Hinweise zur Begrüßung des Publikums, zur Gestaltung des Haupt- und Schlussteils sowie zum Umgang mit Zwischenrufen und Fragen gegeben. Eine weitere Checkliste dient der Überprüfung vor dem Vortrag.
Welche Themenschwerpunkte werden im Leitfaden behandelt?
Die wichtigsten Themenschwerpunkte sind: die Vorbereitung eines Referats (Themenwahl, Informationsbeschaffung, Strukturierung), der Redestil (Wortschatz, Stilmittel, Vermeidung stilistischer Fehler), die Durchführung eines Referats (Lampenfieber bewältigen, Körpersprache und Sprechkultur effektiv einsetzen), der Umgang mit dem Publikum (Begrüßung, Interaktion, Fragen beantworten) und methodisch-didaktische Strategien für eine effektive Wissensvermittlung.
Welche Zielgruppe spricht dieser Leitfaden an?
Der Leitfaden richtet sich an Studierende und Schüler, die ihre Fähigkeiten in der Vorbereitung und Durchführung von Referaten verbessern möchten. Er bietet sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Tipps und Übungen.
Welche Schlüsselqualifikationen werden durch die Referatserstellung gefördert?
Die Erstellung und Präsentation eines Referats fördert wichtige Schlüsselqualifikationen wie Konzentrationsfähigkeit, analytisches Denken und Kommunikationsfähigkeit.
Wie kann Lampenfieber bewältigt werden?
Der Leitfaden bietet Strategien und Tipps zur Bewältigung von Lampenfieber, die im Kapitel zur Durchführung des Referats detailliert beschrieben werden.
Wie sollte man mit Zwischenrufen und Fragen des Publikums umgehen?
Der Leitfaden gibt konkrete Anweisungen zum professionellen Umgang mit Zwischenrufen und Fragen des Publikums während des Referats.
- Citation du texte
- Björn Hochmann (Auteur), 2007, Referieren in Schule und Universität , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134282