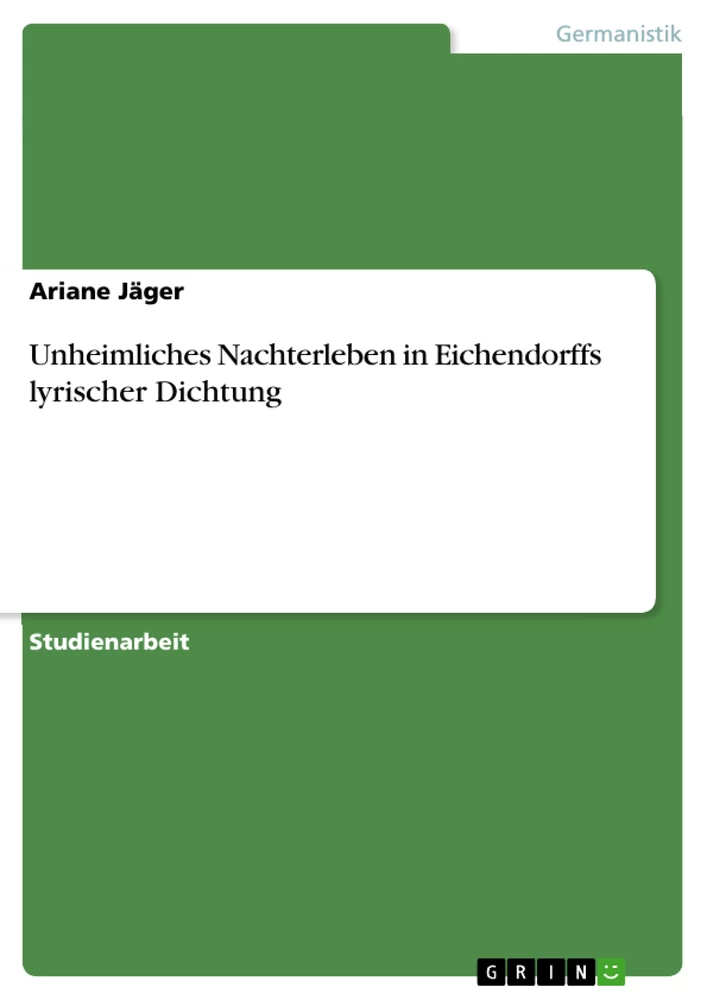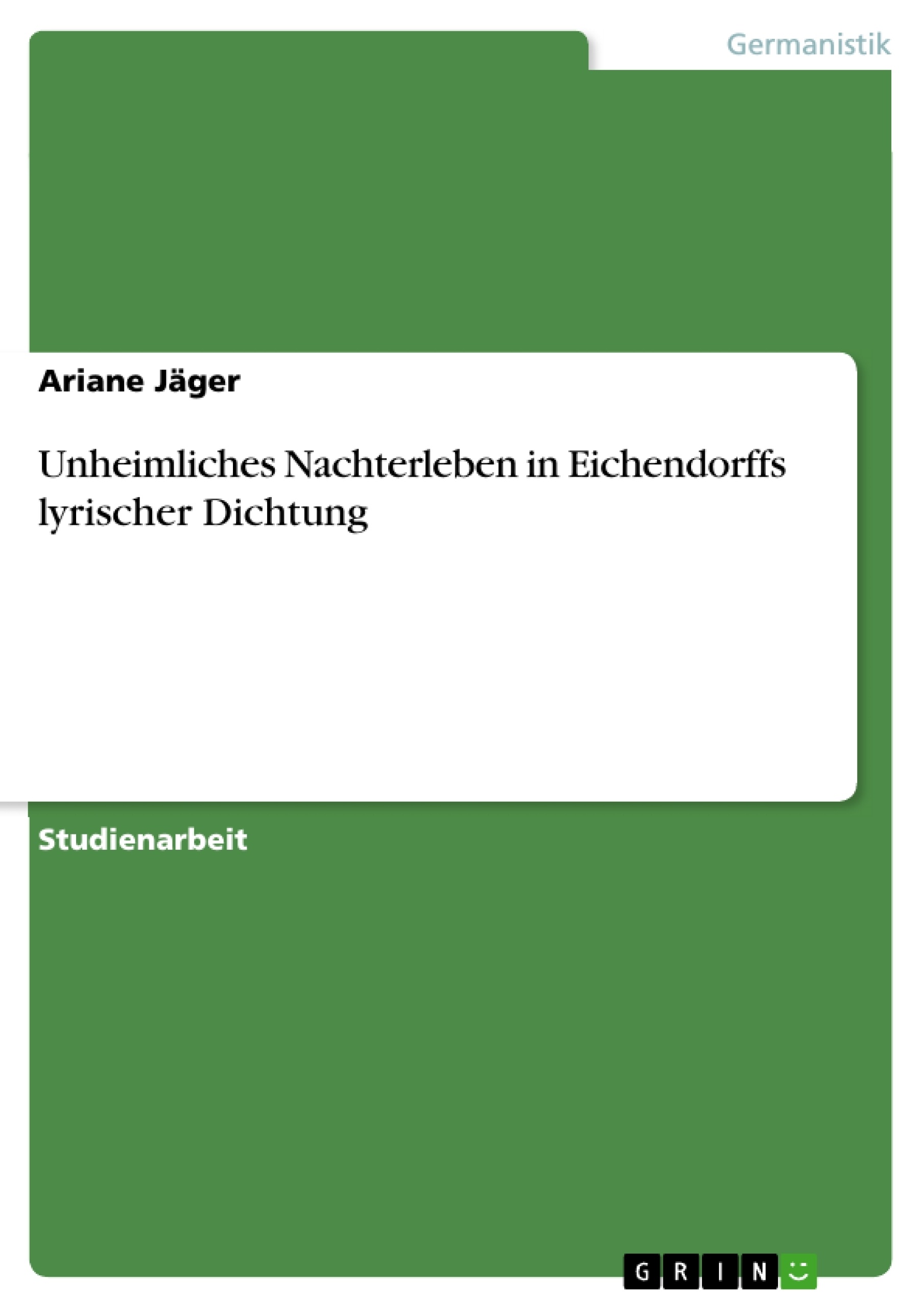Die folgende Hauptseminarsarbeit wird sich mit der unheimlichen Nachtlandschaft Eichendorffs beschäftigen. Dafür soll zunächst auf die verschiedenen Nachtformen in seiner lyrischen Dichtung eingegangen werden, um aufzuzeigen, wie und mit welcher Wirkung diese in Eichendorffs Texten vorkommen. Im weiteren Verlauf der Arbeit soll dann heraus gearbeitet werden, welche Elemente grundlegend für seine unheimliche Nacht sind. Dafür sollen eine Reihe ausgewählter Gedichte, von denen ein Großteil selten oder gar nicht in der Eichendorff- Forschung behandelt wurde, herangezogen werden. Diese sollen eingehend beobachtet, dabei bereits auf sprachliche Auffälligkeiten hingewiesen werden, um diese in einem weiteren Schritt näher charakterisieren zu können. Im Schlußteil soll dann geklärt sein, wie Eichendorff es erreicht, seiner Nacht den unheimlichen Charakter zu verleihen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Nacht bei Eichendorff
- 3. Nachtformen bei Eichendorff
- 3.1 Die Mondnacht
- 3.2 Die sternklare Nacht
- 3.3 Das Traummotiv und die Verzauberung der Nacht
- 4. „Unheimlichkeit“
- 4.1 Definition von „Unheimlichkeit“
- 4.2 Die unheimliche (finstere) Nacht
- 5. „Unheimlichkeit“ in ausgewählten Gedichten Eichendorffs
- 5.1 „Nachts“
- 5.2 „Abschied“
- 5.3 „Im Abendroth“
- 5.4 „Liebe in der Fremde“
- 5.5 „Nachtgebet“
- 6. Eichendorffs Sprache
- 7. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der unheimlichen Nachtlandschaft in Eichendorffs lyrischer Dichtung. Ziel ist es, verschiedene Nachtformen in seinen Texten aufzuzeigen und die Elemente zu identifizieren, die seine unheimliche Nacht prägen. Ausgewählte Gedichte, zum Teil selten in der Forschung behandelt, werden analysiert, wobei sprachliche Besonderheiten berücksichtigt werden. Die Arbeit klärt, wie Eichendorff seinen nächtlichen Szenen einen unheimlichen Charakter verleiht.
- Die verschiedenen Nachtformen bei Eichendorff (Mondnacht, sternenklare Nacht etc.)
- Die Definition und Darstellung von „Unheimlichkeit“ in Eichendorffs Werk
- Analyse ausgewählter Gedichte im Hinblick auf die unheimliche Atmosphäre
- Die Rolle von Sprache und Stilmitteln in der Schaffung der unheimlichen Wirkung
- Eichendorffs spezifischer Umgang mit dem Motiv der Nacht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert das Thema der Arbeit: die unheimliche Nachtlandschaft in Eichendorffs Lyrik. Sie beschreibt den methodischen Ansatz, der darin besteht, verschiedene Nachtformen zu analysieren und die sprachlichen Mittel zu untersuchen, die zur Erzeugung der unheimlichen Atmosphäre beitragen. Die Auswahl der analysierten Gedichte wird begründet und die Forschungsfrage formuliert: Wie schafft Eichendorff es, seiner Nacht den unheimlichen Charakter zu verleihen?
2. Die Nacht bei Eichendorff: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung der Nacht in Eichendorffs Werk im Kontext anderer Tageszeiten. Die Nacht wird nicht nur als bloße Dunkelheit definiert, sondern als Ort der Phantasie, Sehnsucht, aber auch der Gefahr und Verirrung. Der Morgen steht für Aufbruch und Erwartung, der Mittag für ambivalente Ruhe, der Abend für Wehmut, die in der Nacht ihren Höhepunkt erreicht. Die Arbeit hebt die besondere Symbolik der Nacht hervor und zeigt das rege Interesse der Forschung an Eichendorffs Darstellung der nächtlichen Atmosphäre. Der Fokus liegt auf der unheimlichen Wirkung, die durch die atmosphärische Dunkelheit erzeugt wird.
3. Nachtformen bei Eichendorff: Dieses Kapitel differenziert zwischen verschiedenen Arten der nächtlichen Darstellung bei Eichendorff. Die Mondnacht wird als ein wiederkehrendes Element beschrieben, das sowohl rätselhafte Schauderhaftigkeit als auch stille Schönheit vermitteln kann. Der Mond wird oft als einsam dargestellt, verbunden mit Sehnsucht und Liebe. Im Gegensatz dazu steht die sternenklare Nacht, die eher mit einem christlichen Hintergrund verbunden ist und göttliche Präsenz symbolisiert. Das Kapitel beleuchtet die vielfältige Symbolik beider Nachtformen und ihren Einfluss auf die Stimmung und die emotionale Wirkung der Gedichte.
5. „Unheimlichkeit“ in ausgewählten Gedichten Eichendorffs: Dieses Kapitel analysiert ausgewählte Gedichte Eichendorffs im Hinblick auf die Darstellung von Unheimlichkeit. Es untersucht, wie die unheimliche Atmosphäre durch sprachliche Mittel und die Inszenierung nächtlicher Szenen erzeugt wird. Die Analyse der einzelnen Gedichte zeigt die vielschichtigen Ausprägungen des Unheimlichen und deren Bedeutung im Kontext von Eichendorffs Gesamtwerk. Das Kapitel beleuchtet, wie die gewählten Gedichte den Aspekt der unheimlichen Nacht veranschaulichen.
6. Eichendorffs Sprache: (Anmerkung: Der Inhalt dieses Kapitels ist nicht aus dem gegebenen Textausschnitt ersichtlich und kann daher nicht zusammengefasst werden.)
Schlüsselwörter
Eichendorff, Lyrik, Nacht, Unheimlichkeit, Mondnacht, sternenklare Nacht, Traum, Sehnsucht, Gefahr, Sprache, Stilmittel, romantische Dichtung, Symbolik, Atmosphäre.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der unheimlichen Nachtlandschaft in Eichendorffs Lyrik
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Darstellung der unheimlichen Nachtlandschaft in Joseph von Eichendorffs lyrischer Dichtung. Der Fokus liegt auf der Erforschung verschiedener Nachtformen und der sprachlichen Mittel, die zur Erzeugung einer unheimlichen Atmosphäre beitragen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit will verschiedene Nachtformen in Eichendorffs Gedichten aufzeigen, die Elemente identifizieren, die seine unheimliche Nacht prägen, und ausgewählte Gedichte (teilweise selten in der Forschung behandelt) unter Berücksichtigung sprachlicher Besonderheiten analysieren. Das übergeordnete Ziel ist es zu klären, wie Eichendorff seinen nächtlichen Szenen einen unheimlichen Charakter verleiht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Nachtformen bei Eichendorff (Mondnacht, sternenklare Nacht etc.), die Definition und Darstellung von „Unheimlichkeit“ in seinem Werk, die Analyse ausgewählter Gedichte im Hinblick auf die unheimliche Atmosphäre, die Rolle von Sprache und Stilmitteln in der Schaffung der unheimlichen Wirkung und Eichendorffs spezifischen Umgang mit dem Motiv der Nacht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in diesen?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung (Einführung in das Thema und die Methode), Die Nacht bei Eichendorff (Bedeutung der Nacht im Kontext anderer Tageszeiten), Nachtformen bei Eichendorff (Unterscheidung von Mondnacht und sternenklarer Nacht), „Unheimlichkeit“ (Definition und Darstellung des Unheimlichen), „Unheimlichkeit“ in ausgewählten Gedichten Eichendorffs (Analyse ausgewählter Gedichte), Eichendorffs Sprache (Analyse der sprachlichen Mittel) und Schlussbetrachtung (Zusammenfassung der Ergebnisse).
Welche Gedichte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert unter anderem die Gedichte „Nachts“, „Abschied“, „Im Abendroth“, „Liebe in der Fremde“ und „Nachtgebet“, um die Darstellung der unheimlichen Nacht zu veranschaulichen.
Wie wird die „Unheimlichkeit“ in der Arbeit definiert und dargestellt?
Die Arbeit definiert und beschreibt die „Unheimlichkeit“ in Eichendorffs Werk anhand der Analyse ausgewählter Gedichte und der Untersuchung der sprachlichen Mittel, die zur Erzeugung der unheimlichen Atmosphäre beitragen. Es wird untersucht, wie die nächtlichen Szenen inszeniert werden, um eine unheimliche Wirkung zu erzielen.
Welche Rolle spielt die Sprache in der Schaffung der unheimlichen Atmosphäre?
Die Arbeit untersucht die Rolle von Sprache und Stilmitteln in der Erzeugung der unheimlichen Wirkung. Dieses Kapitel ist jedoch im gegebenen Textausschnitt nicht detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Eichendorff, Lyrik, Nacht, Unheimlichkeit, Mondnacht, sternenklare Nacht, Traum, Sehnsucht, Gefahr, Sprache, Stilmittel, romantische Dichtung, Symbolik, Atmosphäre.
- Quote paper
- MA Ariane Jäger (Author), 2005, Unheimliches Nachterleben in Eichendorffs lyrischer Dichtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134275