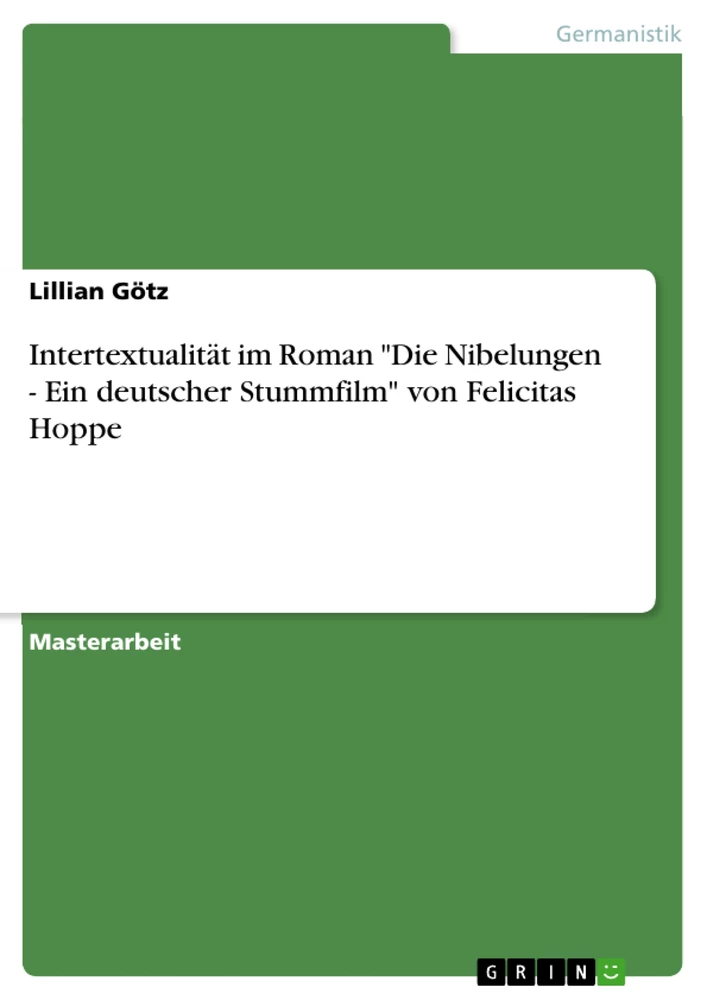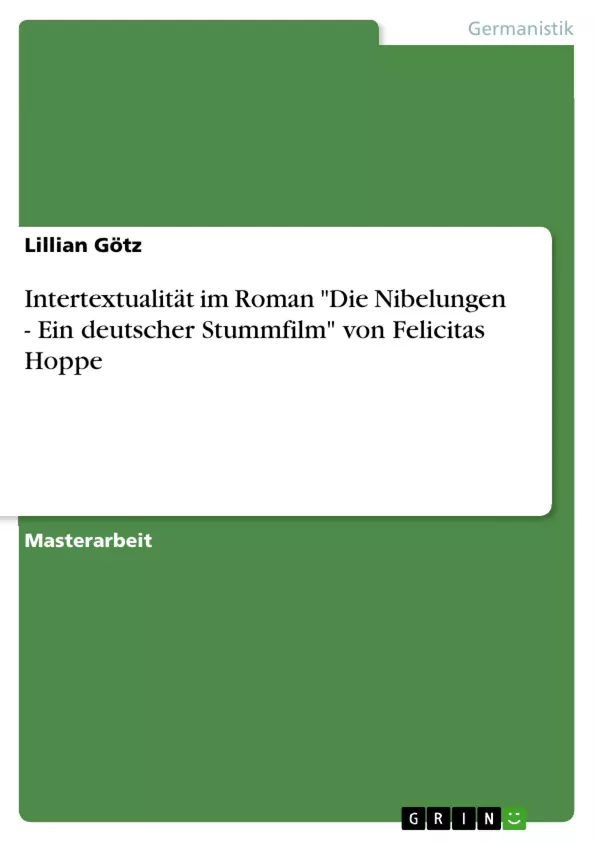Das Thema dieser Arbeit ist die Untersuchung des literaturwissenschaftlichen Phänomens "Intertextualität" am Beispiel des Romans "Die Nibelungen - Ein deutscher Stummfilm" von Felicitas Hoppe. Im ersten Teil der Arbeit werden Konzepte, Theorien, Formen, Funktionen, Rezeption und Geschichte der Intertextualität vorgestellt und zusammengefasst. Anschließend wird der Roman der Autorin vorgestellt und ausgewählte Analysekategorien der Intertextualität am Roman von Hoppe untersucht. Die Ergebnisse und Ausblicke der Arbeit werden in einem Fazit zusammengefasst.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich zum einen mit dem theoretischen Konzept von Intertextualität und zum anderen mit ihrer praktischen Anwendbarkeit in einem konkreten literarischen Text. Als solcher ist der Roman „Die Nibelungen – Ein deutscher Stummfilm“ von Felicitas Hoppe ausgewählt worden. Der 2021 veröffentlichte Text ist die Neuerzählung des Nibelungenliedes, das uns aus dem 13. Jahrhundert schriftlich überliefert ist.
Als einer der zentralen Texte, mit denen sich die Germanistik auseinandersetzt, ist die intertextuelle Beschäftigung mit Hoppes Roman für den Fachbereich der Neueren deutschen Literatur ein relevanter Aspekt, da auf diesem Wege ein Stück Gegenwartsliteratur nicht nur textanalytisch, sondern auch in Bezug auf ihren literaturhistorischen Kontext untersucht werden kann. Diese Arbeit möchte Erkenntnisse über die Theorie, den Einsatz und die Rezeptionsmöglichkeiten von Intertextualität an dem konkreten Beispiel von Felicitas Hoppes Roman sammeln.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Vorstellung des Themas und Relevanz der Arbeit
- Methode und Aufbau der Arbeit
- Anmerkungen
- Intertextuelle Theorie
- Konzepte der Intertextualität
- Michail Bachtin und das Konzept der Dialogizität
- Julia Kristeva und das Universum der Texte
- Gérard Genette und die Transtextualitätstheorie
- Broich/Pfister und die Systematisierung des Intertextualitätsbegriffes
- Susanne Holthuis und die Interaktion zwischen Text und Leser
- Peter Stocker und der Einzeltext- und Textklassenbezug
- Hardarik Blühdorn und die Sprache der Intertextualität
- Intertextuelle Formen und Markierungen
- Einzeltext- und Systemtextreferenz nach Broich und Pfister
- Intertextuelle Typologie nach Gérard Genette
- Referenz, ,,in praesentia“ und Referenz, ,,in absentia“ bei Susanne Holthuis
- Progressionsskala intertextueller Markierungen nach Jörg Helbig
- Interfiguralität
- Funktionen der Intertextualität
- Entwicklung und Probleme des Funktionsbegriffes
- Intertextualität als kommunikatives Phänomen
- Funktionsrichtungen von Intertextualität
- Textverarbeitung und intertextueller Leseprozess
- Intertextualität und Intermedialität
- Zwischenfazit
- Der Roman von Felicitas Hoppe
- Untersuchungsergebnisse zur Intertextualität im Roman
- Das Gesamtwerk der Autorin als intertextueller Rahmen
- Die Paratexte - Begleitende Intertextualität
- Der Buchtitel
- Das Coverbild
- Die Zueignung
- Die Motti
- Das Inhaltsverzeichnis und der Abspann
- Die Kapitelüberschriften
- Interfiguralität im Roman von Felicitas Hoppe
- Siegfried, RvP und der böse Onkel Hagen
- Der Zeuge im Beiboot
- Die Rollen und Geister der Nibelungen
- Das dreifache G
- Figuren und Rollen
- Die interfigurale Personifikation
- Intertextueller Rezeptionsanspruch des Romans
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen der Intertextualität, untersucht die relevanten Theorien und zeigt deren Anwendung anhand des Romans „Die Nibelungen – Ein deutscher Stummfilm“ von Felicitas Hoppe auf.
- Das Konzept der Intertextualität und seine Entwicklung in der Literaturwissenschaft
- Die verschiedenen Formen und Markierungen von Intertextualität
- Die Funktionen von Intertextualität im literarischen Text
- Die Intertextualität in Felicitas Hoppes Roman „Die Nibelungen – Ein deutscher Stummfilm“
- Der Rezeptionsanspruch des Romans im intertextuellen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema der Intertextualität und zeigt die Relevanz der Thematik für die Literaturwissenschaft auf. Anschließend werden die wichtigsten Konzepte der Intertextualität vorgestellt und anhand verschiedener Theorien beleuchtet.
Im weiteren Verlauf werden die Formen und Markierungen von Intertextualität analysiert und in ihren Funktionen eingeordnet. Das Kapitel über Interfiguralität betrachtet die verschiedenen Figuren des Romans im Kontext der Intertextualität.
Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit dem intertextuellen Rezeptionsanspruch des Romans und beleuchtet die Frage, wie der Roman mit seinen intertextuellen Bezügen auf die Rezeption Einfluss nimmt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf das Konzept der Intertextualität, die Anwendung von Intertextualitätskonzepten, die Interfiguralität, den Roman „Die Nibelungen – Ein deutscher Stummfilm“ von Felicitas Hoppe und den Rezeptionsanspruch des Romans im intertextuellen Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Romans von Felicitas Hoppe?
Der Roman "Die Nibelungen - Ein deutscher Stummfilm" ist eine moderne Neuerzählung des mittelalterlichen Nibelungenliedes.
Was bedeutet Intertextualität?
Intertextualität bezeichnet die Eigenschaft von Texten, sich auf andere Texte zu beziehen, diese zu zitieren oder zu transformieren.
Welche Theoretiker zur Intertextualität werden behandelt?
Die Arbeit nutzt Konzepte von Michail Bachtin, Julia Kristeva, Gérard Genette sowie Broich und Pfister.
Was versteht man unter Interfiguralität?
Interfiguralität ist ein Teilbereich der Intertextualität, bei dem literarische Figuren (wie Siegfried oder Hagen) aus bekannten Vorlagen in neuen Texten auftreten.
Welche Rolle spielen Paratexte in Hoppes Roman?
Buchtitel, Coverbild, Motti und das Inhaltsverzeichnis dienen als begleitende intertextuelle Rahmen, die den Leser auf Bezüge vorbereiten.
- Arbeit zitieren
- Lillian Götz (Autor:in), 2022, Intertextualität im Roman "Die Nibelungen - Ein deutscher Stummfilm" von Felicitas Hoppe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1341849