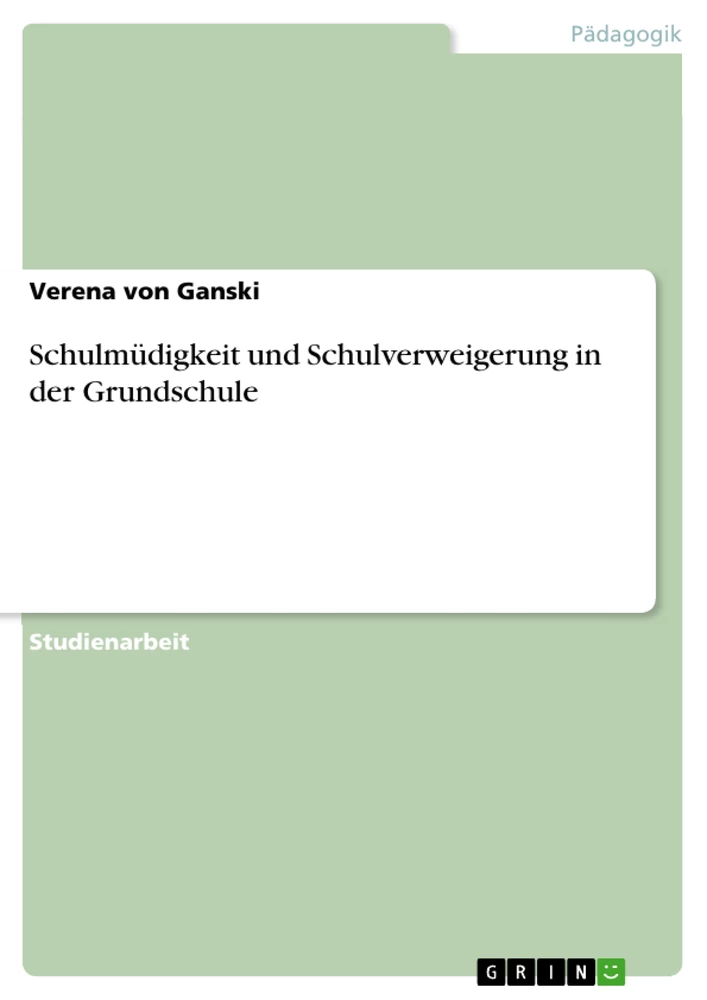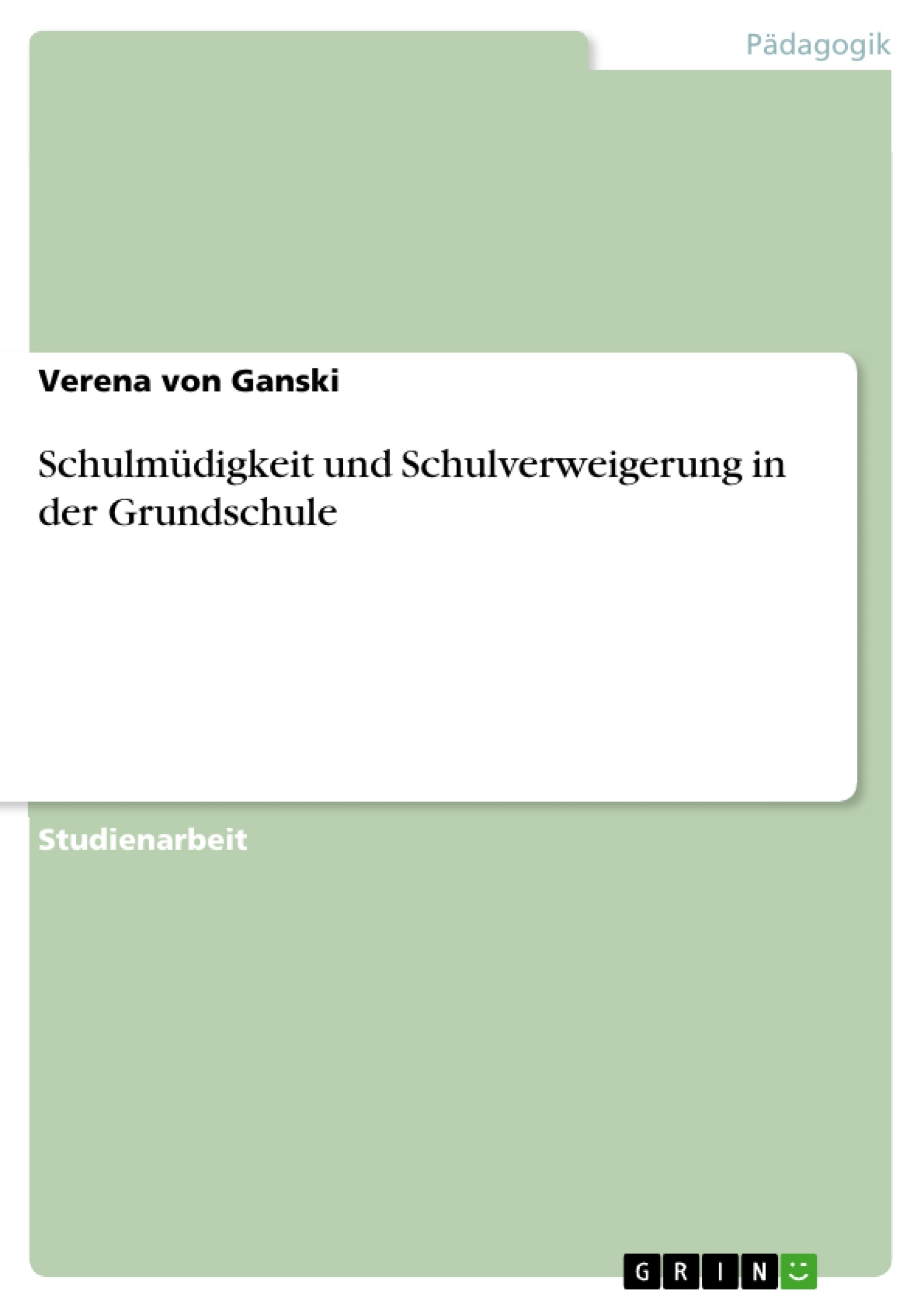Das Anliegen dieser Hausarbeit ist es, die Phänomene Schulunlust und Schulmüdigkeit in der Grundschule darzustellen.
Temporär auftretende Schulunlust und Müdigkeit ist fast normal und kennt jeder bestimmt. Wir gehen wie alle mal, lieber und mal weniger gerne in die Schule. Problematisch wird es jedoch, wenn sich die Schulmüdigkeit verfestigt und es zu einem dauerhaften Problem wird. Die Ursachen dafür sind genauso vielfältig, wie die Ausprägungen.
Von gedanklicher Distanzierung und Träumen im Unterricht, bis hin zum dauerhaften Fernbleiben der Schule und des Unterrichts. Die dadurch entstehenden Probleme sind breit gefächert und deren Auswirkungen auf das Leben der Kinder und Jugendlichen sowie ihre berufliche Zukunft risikohaft. Während der letzten Jahrzehnte rückte schulmeidendes Verhalten in den Fokus der Wissenschaft, und die verschiedenen Professionen begannen über die Ursachen, die dem Verhalten zugrunde liegen, zu forschen. Durch die Vielfalt der forschenden Disziplinen ergeben sich jeweils unterschiedliche Perspektiven und Begrifflichkeiten.
Die vorliegende Arbeit behandelt im Schwerpunkt Schulmüdigkeit und Schulabsentismus in der Grundschule, da die ersten Symptome sich bereits im Alter von 8 Jahren feststellen lassen. Je früher die Symptome erkannt werden, desto höher ist die Chance dem entgegenzuwirken und die Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen.
Diese Arbeit wird zunächst die verschiedenen Bezeichnungen für das Phänomen des Schulabsentismus und der Schulmüdigkeit vorstellen und anschließend definieren. Anschließend werden unterschiedliche Formen vorgestellt. Im nächsten Kapitel werden die Ursachen und Indikatoren für das Verhalten näher beleuchtet. Dabei werden besonders familiäre, persönliche und schulische Faktoren in den Fokus genommen. Im Anschluss daran werden die Auswirkungen und Folgen näher betrachtet. Im darauffolgenden Kapitel werden verschiedene Modelle zur Prävention und Handlungsvorschläge dargestellt. Zum Schluss wird im Fazit ein Resümee über die bisherigen Kenntnisse der Arbeit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Intention und Aufbau
- 2 Definition der Begriffe und Formen
- 3 Ursachen und Indikatoren für Schulabsentismus
- 3.1 Indikatoren
- 3.2 Ursachen
- 4 Folgen
- 5 Prävention und Handlungsvorschläge
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Phänomen von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung in der Grundschule. Ziel ist es, die verschiedenen Facetten dieses Problems darzustellen, von temporären Erscheinungsformen bis hin zu dauerhaftem Schulfernbleiben. Die Arbeit beleuchtet die vielfältigen Ursachen, die daraus resultierenden Folgen und mögliche Präventionsmaßnahmen.
- Definition und Abgrenzung verschiedener Begriffe im Zusammenhang mit Schulabsentismus (Schulmüdigkeit, Schulverweigerung etc.)
- Ursachen von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung (familiäre, persönliche und schulische Faktoren)
- Folgen von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung für die betroffenen Kinder und Jugendlichen
- Präventions- und Interventionsmöglichkeiten
- Zusammenfassende Betrachtung des Themas und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Intention und Aufbau: Diese Einleitung beschreibt das Ziel der Arbeit: die Darstellung der Phänomene Schulunlust und Schulmüdigkeit in der Grundschule. Es wird betont, dass temporäre Schulunlust normal ist, dauerhafte Schulmüdigkeit jedoch problematisch wird und vielfältige Ursachen aufweist. Die Arbeit behandelt die Ursachen, Folgen und Präventionsmöglichkeiten dieses Problems und betont die Wichtigkeit früher Intervention, da erste Symptome bereits im Alter von 8 Jahren auftreten können. Der Aufbau der Arbeit wird skizziert, wobei die Definition der Begriffe, die Ursachen und Indikatoren, die Folgen, Präventionsmaßnahmen und ein Fazit angekündigt werden.
2 Definition der Begriffe und Formen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung verschiedener Begriffe, die das Phänomen des Schulfernbleibens beschreiben (Schulverdrossenheit, Schulmüdigkeit, Schulverweigerung etc.). Es wird die Uneinheitlichkeit der Begrifflichkeiten in der Fachliteratur hervorgehoben und der Begriff „Schulverweigerung“ als am weitesten verbreitet, aber auch als problematisch dargestellt, da er eine bewusste Handlung impliziert und weitere Einflussfaktoren vernachlässigt. Das Kapitel differenziert zwischen Schulverweigerung und Schulschwänzen und beschreibt Schulmüdigkeit als „Null-Bock-Einstellung“ oder gedankliche Abwesenheit. Schließlich wird der Begriff „Schulabsentismus“ als wertneutrale Beschreibung des Fernbleibens von der Schule favorisiert und nach Thimm (2005) in verschiedene Gruppen (Auffällige, Gefährdete, Abgekoppelte) unterteilt.
Schlüsselwörter
Schulmüdigkeit, Schulverweigerung, Schulabsentismus, Grundschule, Ursachen, Folgen, Prävention, Indikatoren, familiäre Faktoren, persönliche Faktoren, schulische Faktoren.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Schulmüdigkeit und Schulverweigerung in der Grundschule
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das Phänomen von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung in der Grundschule. Sie beleuchtet die verschiedenen Facetten dieses Problems, von temporären Erscheinungsformen bis hin zu dauerhaftem Schulfernbleiben, und analysiert Ursachen, Folgen und mögliche Präventionsmaßnahmen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Definition und Abgrenzung verschiedener Begriffe (Schulmüdigkeit, Schulverweigerung, Schulabsentismus), die Ursachen von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung (familiäre, persönliche und schulische Faktoren), die Folgen für betroffene Kinder und Jugendliche, sowie Präventions- und Interventionsmöglichkeiten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der frühzeitigen Intervention, da erste Symptome bereits im Alter von 8 Jahren auftreten können.
Wie sind die Begriffe Schulmüdigkeit, Schulverweigerung und Schulabsentismus definiert?
Die Arbeit hebt die Uneinheitlichkeit der Begrifflichkeiten in der Fachliteratur hervor. „Schulverweigerung“ wird als weit verbreiteter, aber auch problematischer Begriff dargestellt, da er eine bewusste Handlung impliziert. Schulmüdigkeit wird als „Null-Bock-Einstellung“ oder gedankliche Abwesenheit beschrieben. Der Begriff „Schulabsentismus“ wird als wertneutrale Beschreibung des Fernbleibens von der Schule favorisiert und nach Thimm (2005) in verschiedene Gruppen (Auffällige, Gefährdete, Abgekoppelte) unterteilt. Die Arbeit differenziert auch zwischen Schulverweigerung und Schulschwänzen.
Welche Ursachen für Schulmüdigkeit und Schulverweigerung werden untersucht?
Die Hausarbeit untersucht familiäre, persönliche und schulische Faktoren als Ursachen für Schulmüdigkeit und Schulverweigerung. Genauer wird dies in Kapitel 3 erläutert, welches sich mit Ursachen und Indikatoren auseinandersetzt.
Welche Folgen haben Schulmüdigkeit und Schulverweigerung?
Die Arbeit beleuchtet die negativen Folgen von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung für die betroffenen Kinder und Jugendlichen. Diese werden im Kapitel 4 detailliert beschrieben.
Welche Präventions- und Interventionsmöglichkeiten werden vorgeschlagen?
Kapitel 5 der Hausarbeit widmet sich Präventions- und Handlungsvorschlägen, um Schulmüdigkeit und Schulverweigerung entgegenzuwirken.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung (Intention und Aufbau), Definition der Begriffe und Formen, Ursachen und Indikatoren für Schulabsentismus, Folgen, Prävention und Handlungsvorschläge und Fazit. Der Aufbau ist im Inhaltsverzeichnis detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schulmüdigkeit, Schulverweigerung, Schulabsentismus, Grundschule, Ursachen, Folgen, Prävention, Indikatoren, familiäre Faktoren, persönliche Faktoren, schulische Faktoren.
- Arbeit zitieren
- Verena von Ganski (Autor:in), 2022, Schulmüdigkeit und Schulverweigerung in der Grundschule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1341742