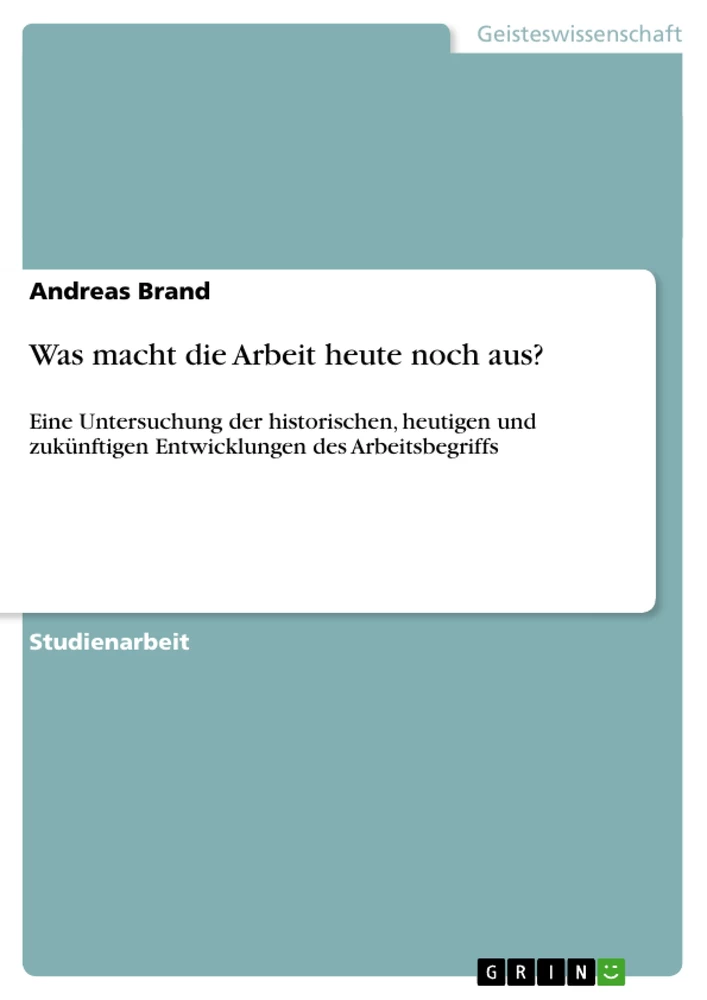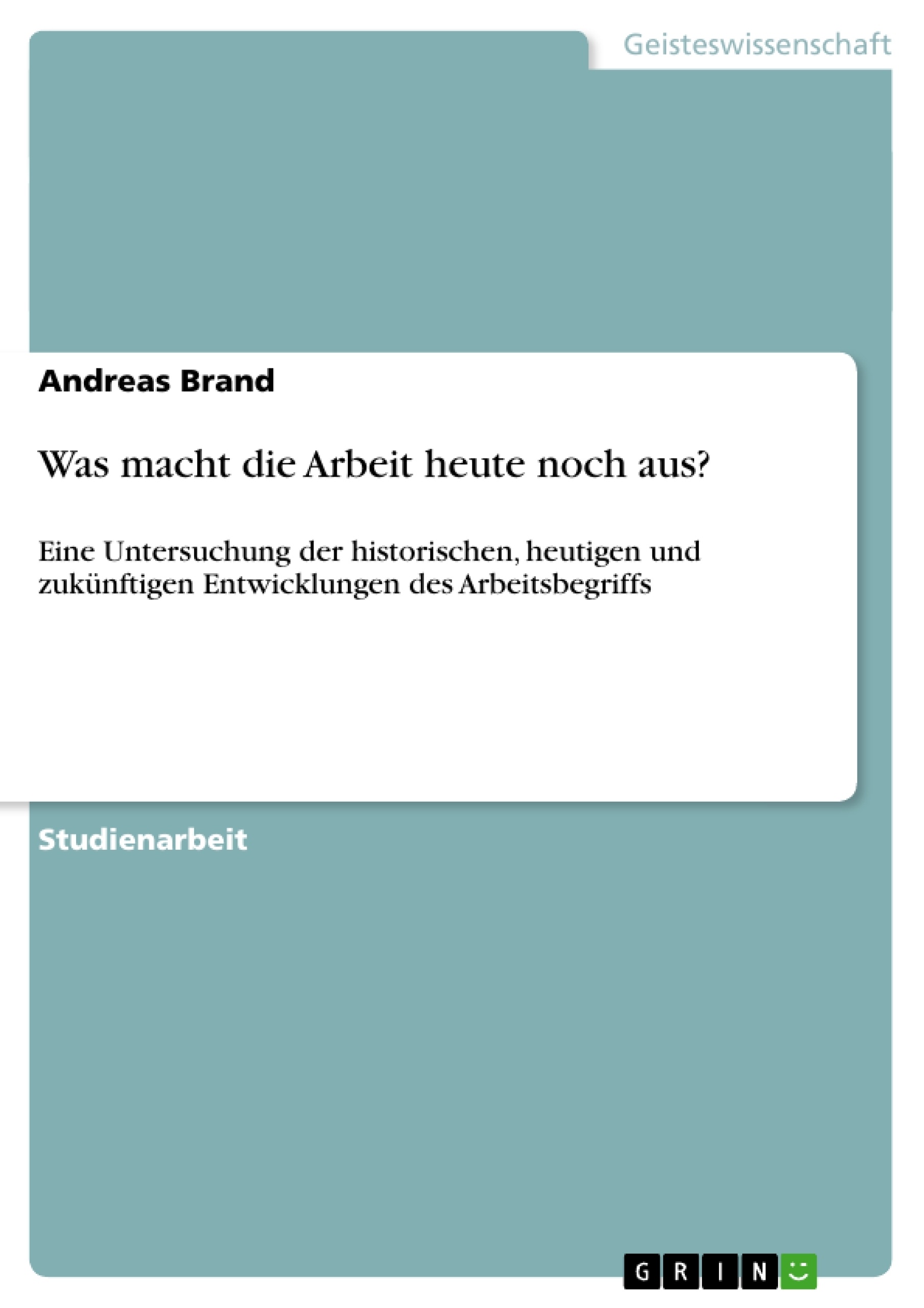Ausgangspunkt dieser Seminararbeit ist die These vom Ende der Arbeit. Anhand historischer Grundkategorien soll untersucht werden, ob diese These sich halten läßt. Der Arbeitsbegriff ist eine Grundkategorie der Soziologie, so daß von Interesse ist, wie dieser gegenwärtig bestimmt ist und wie er sich weiterentwickelt.
Die relativ dominanten Arbeitsformen Erwerbs- bzw. Lohn-, Eigen- und Schwarzarbeit werden, da sie zeitgenössische Erscheinungen sind, genauer untersucht und definiert. Die Unterschiede zwischen Erwerbs- und der zur informellen Ökonomie gehörenden Eigen- und Schwarzarbeit werden herausgestellt. Die Form der Bürgerarbeit bzw. ehrenamtlichen Tätigkeit gehört auch zum Begriff der informellen Wirtschaft bzw. Arbeit. Sie soll, da nicht Untersuchungsziel dieser Arbeit, ausgeklammert werden.
Zusätzlich werden die Positionen der Befürworter der These vom Ende der Arbeit bzw. der Arbeitsgesellschaft denen der Gegner gegenübergestellt. Anhand der Argumente beider Seiten versuche ich dann zu erörtern, ob der Erwerbsarbeitsbegriff weiterhin realitätsnah ist. Abschließend werden zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten der Arbeit beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- Was macht die Arbeit heute noch aus? Eine Untersuchung der historischem heutigen und zukünftigen Entwicklungen des Arbeitsbegriffs mit Fokus auf die Enverbs- Eigen- und Schwarzarbeit
- Philosophische, etymologische Definition und historische Sicht der Arbeit
- Philosophische Definition
- Etymologische Bestimmung der Arbeit
- Historische Sicht
- Antikes Griechenland und antikes Rom/Römerzeit
- Feudalismus/Mittelalter
- Die Industrialisierung — der Weg zur Erwerbs-ILohnarbeit
- Der gegenwärtige Arbeitsbegriff
- Erwerbs-/Lohnarbeit
- Lohnarbeit
- Erwerbsarbeit
- Eigenarbeit
- Schwarzarbeit
- Zusammenfassung und Vergleich der drei Arbeitsformen Erwerbs-, Eigen- und Schwarzarbeit
- Zukünftige Entwicklungen der Arbeit: Wie sieht die Arbeit in Zukunft aus?
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der These vom Ende der Arbeit und untersucht anhand historischer Grundkategorien, ob diese These haltbar ist. Sie analysiert die Entwicklung des Arbeitsbegriffs in verschiedenen historischen Epochen, von der Antike bis zur Gegenwart, und betrachtet die drei zeitgenössischen Arbeitsformen: Erwerbs-/Lohnarbeit, Eigenarbeit und Schwarzarbeit.
- Die historische Entwicklung des Arbeitsbegriffs
- Die verschiedenen Arbeitsformen in der heutigen Zeit
- Die These vom Ende der Arbeit und ihre Argumente
- Zukünftige Entwicklungen der Arbeit
- Die Rolle des Kapitalismus und der Informationsgesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die These vom Ende der Arbeit vor und skizziert den Fokus der Seminararbeit auf die historische Entwicklung des Arbeitsbegriffs und die Analyse von Erwerbs-, Eigen- und Schwarzarbeit.
Das zweite Kapitel geht auf die philosophischen und etymologischen Grundlagen des Arbeitsbegriffs ein und beleuchtet seine historische Entwicklung von der Antike über das Mittelalter bis zur Industrialisierung. Es werden dabei die verschiedenen Arbeitsformen der jeweiligen Epochen, wie Sklavenarbeit, Handwerksarbeit und Fabrikarbeit, beschrieben und in ihren Kontext gesetzt.
Das dritte Kapitel analysiert die drei zeitgenössischen Arbeitsformen Erwerbs-/Lohnarbeit, Eigenarbeit und Schwarzarbeit. Es werden die Definitionen, Charakteristika und Unterschiede dieser Arbeitsformen herausgestellt und in Bezug auf die historischen Grundlagen gesetzt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Arbeitsbegriff, die historische Entwicklung der Arbeit, Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, Schwarzarbeit, die These vom Ende der Arbeit, die Arbeitsgesellschaft, der Kapitalismus, die Informationsgesellschaft, die Zukunft der Arbeit und die Pluralisierung von Arbeitsformen.
- Quote paper
- Andreas Brand (Author), 1999, Was macht die Arbeit heute noch aus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134173