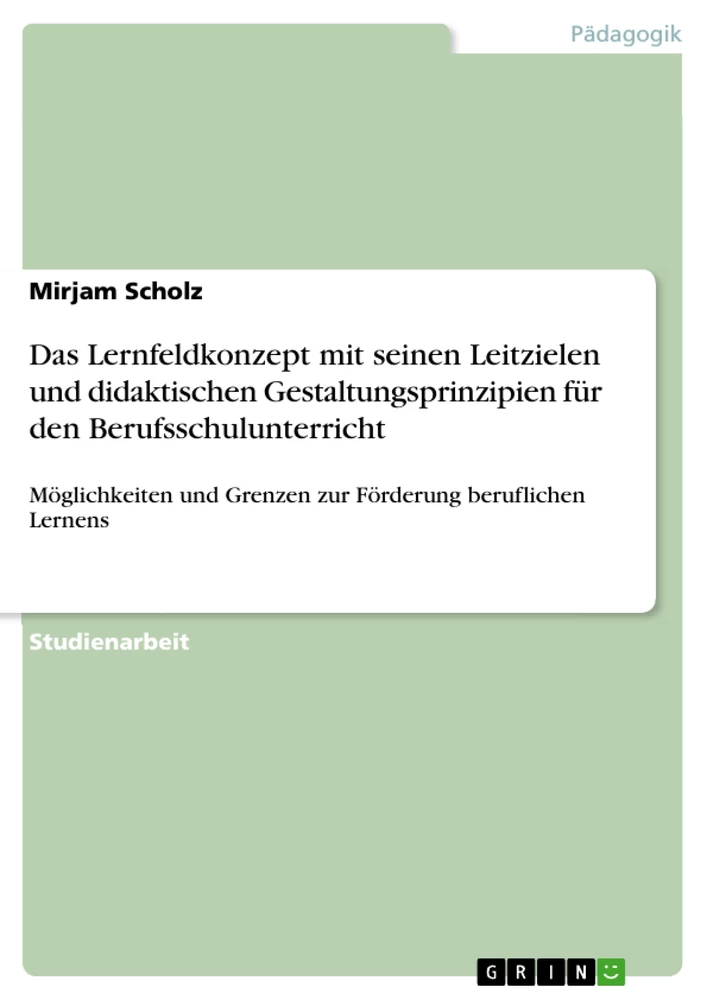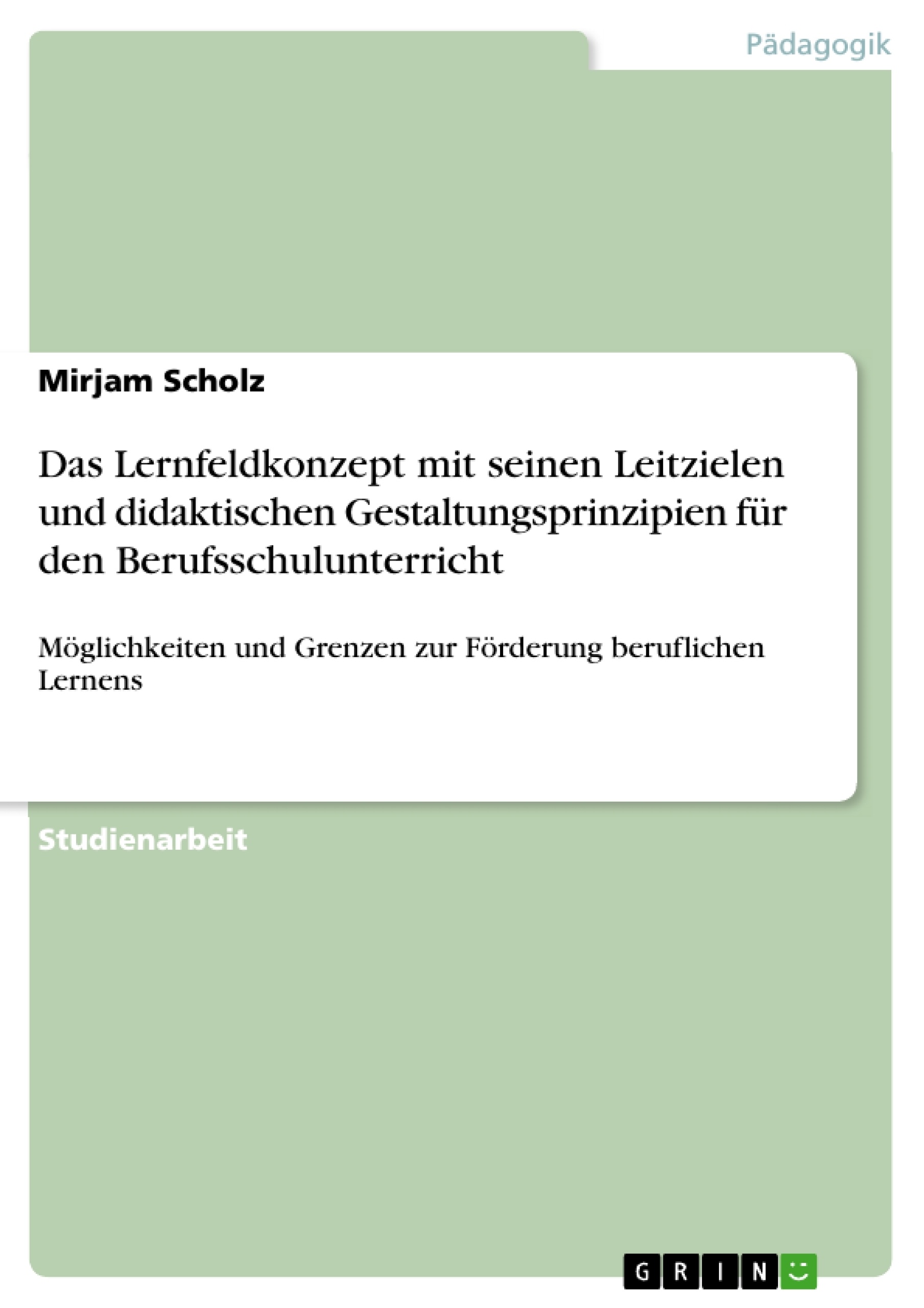In den letzen Jahrzehnten hat es weitreichende Veränderungen im deutschen Beschäftigungssystem gegeben. Im der Ausbildung von jungen Arbeitskräften wird mittlerweile eine Vermittlung von Schlüsselqualifikationen erwartet auch von Seiten der Berufsschule, die sie als ausgelernte Kraft mit in den Beruf bringen sollen. Somit hat eine Förderung der Handlungskompetenz im beruflichen Lernen sehr an Gewicht gewonnen. Im Laufe der Jahre gab es zahlreiche Neuordnungen der Ausbildungsberufe, um sich den Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt anzupassen. Die Anforderungen an den Arbeitnehmer hatten sich verändert, so musste auch die Schule bzw. die Berufsausbildung, ausgehend von ihrem Bildungsauftrag, dazu angepasst bzw. umstrukturiert werden, so dass sie den gegeben Anforderungen entspricht, um qualifizierte Arbeitskräfte für den Arbeitsmarkt zu produzieren. Das bisherige Ausbildungssystem war an seine Grenzen gelangt, daher entwickelte die Kultusministerkonferenz des Bundes ein Model als Antwort auf die veränderten Bedingungen und Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt.
Wirtschaft und Gesellschaft befinden sich in einem anhaltenden Strukturwandel. Um diesen Wandel zu bewältigen, zu nutzen und mitzugestalten, ist ein lebenslanges Lernen erforderlich. Es werden hohe Anforderungen an alle Organisationen im Bildungsbereich gestellt und der Organisationsgrad der Arbeit steigt stetig. Um dies zu fördern wird der Unterricht in der Berufsausbildung nun handlungsorientiert gestaltet. Laut der Rahmenvereinbarung der KMK ist die berufliche Bildung einem doppelten Ziel verpflichtet:
• Die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler in sozialer Verantwortung soll gefördert werden.
• Es soll eine Qualifizierung zur Ausübung eines Berufs stattfinden, d.h. für Tätigkeiten, die aktuell auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt werden oder für die ein Bedarf erwartet wird
• Gefordert wird nicht der Erwerb “trägen Wissens”, sondern die Lehr-Lern-Arrangements sollen den Erwerb von “intelligentem, anwendungsfähigem Wissen” / “Strukturwissen” ermöglichen
Früher wollte man mit dem Unterricht Inhalte vermitteln und Lernziele erreichen, heute dagegen möchte man, dass Schülerinnen und Schüler Kompetenzen entwickeln. Die Lernfeldkonzeption setzt somit an den Kritikpunkten des Dualen Systems an.
Und hier setzt dann auch meine Leitfrage der Hausarbeit an: Sind lernfeldorientierte Curricula denn überhaupt geeignet, um das aufgetretene Berufsbildungsproblem zu beheben?
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Thematik unter dem Aspekt der gestiegenen Anforderungen im Beschäftigungssystems
- Grundlagen des Lernfeldkonzepts
- Berufliches Lernen
- Handlungsfelder
- Lernfelder
- Lernsituationen
- Lernfelder im Unterricht der Berufsschule
- Didaktische Zielperspektive von Lernfeldern
- Von der beruflichen Handlungssituation zu Lernfeldern
- Lernfelder in den Rahmenlehrplänen und ihre Umsetzung im Unterricht
- Zusammenfassung: Vom der Handlungsebene zur Lernsituation
- Stärken des Lernfeldkonzepts gegenüber der Fächersystematik durch handlungsorientierten, fächerübergreifenden Unterricht
- Grenzen und Schwächen des Lernfeldkonzepts bezogen auf die Konstruierung von Lernfeldern
- Neue Anforderung an die Lehrkraft
- Organisation/Umsetzung des LFK
- Schüler
- Resümee und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Lernfeldkonzept und dessen Bedeutung für den Berufsschulunterricht. Sie untersucht die Möglichkeiten und Grenzen des Konzeptes zur Förderung beruflichen Lernens im Kontext der gestiegenen Anforderungen im Beschäftigungssystem.
- Die Entwicklung des Lernfeldkonzepts als Reaktion auf die veränderten Anforderungen im Arbeitsmarkt.
- Die didaktische Zielperspektive von Lernfeldern und deren Umsetzung im Unterricht.
- Die Stärken des Lernfeldkonzepts im Vergleich zur traditionellen Fächersystematik, insbesondere die Förderung von Handlungskompetenz und fächerübergreifendem Lernen.
- Die Herausforderungen und Schwächen des Lernfeldkonzepts, insbesondere die Anforderungen an Lehrkräfte und die Organisation des Unterrichts.
- Die Bedeutung des Lernfeldkonzepts für die Zukunft der Berufsausbildung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung beleuchtet die Veränderungen im Beschäftigungssystem und die damit verbundenen Anforderungen an die Berufsausbildung. Sie stellt die Handlungskompetenz als zentrales Ziel der Berufsausbildung heraus und führt in die Thematik des Lernfeldkonzepts ein.
Kapitel 2 definiert die zentralen Begriffe des Lernfeldkonzepts: Berufliches Lernen, Handlungsfelder, Lernfelder und Lernsituationen. Es wird die Abhängigkeit der Lernfelder von den Handlungsfeldern erläutert und die Bedeutung der didaktischen Analyse für die Konstruktion von Lernfeldern hervorgehoben.
Kapitel 3 widmet sich der Umsetzung von Lernfeldern im Unterricht der Berufsschule. Es wird die didaktische Zielperspektive von Lernfeldern, die Transformation von Handlungsfeldern zu Lernfeldern und die Integration von Lernfeldern in den Rahmenlehrplänen und deren Umsetzung im Unterricht beschrieben.
Kapitel 4 beleuchtet die Stärken des Lernfeldkonzepts, insbesondere die Förderung von Handlungskompetenz und fächerübergreifendem Lernen. Es wird der Vergleich zur traditionellen Fächersystematik gezogen und die Bedeutung der Handlungsorientierung im Unterricht hervorgehoben.
Kapitel 5 analysiert die Grenzen und Schwächen des Lernfeldkonzepts. Es werden die neuen Anforderungen an Lehrkräfte, die Organisation und die Umsetzung des Lernfeldkonzepts sowie die Herausforderungen für die Schüler beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Lernfeldkonzept, die Handlungskompetenz, die Berufsausbildung, die Berufsschule, die Didaktik, die Handlungsorientierung, der fächerübergreifende Unterricht und die Herausforderungen der Umsetzung des Lernfeldkonzepts in der Praxis.
- Quote paper
- Dipl. Soz.Päd./Dipl. Soz.Arb. Mirjam Scholz (Author), 2007, Das Lernfeldkonzept mit seinen Leitzielen und didaktischen Gestaltungsprinzipien für den Berufsschulunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134087