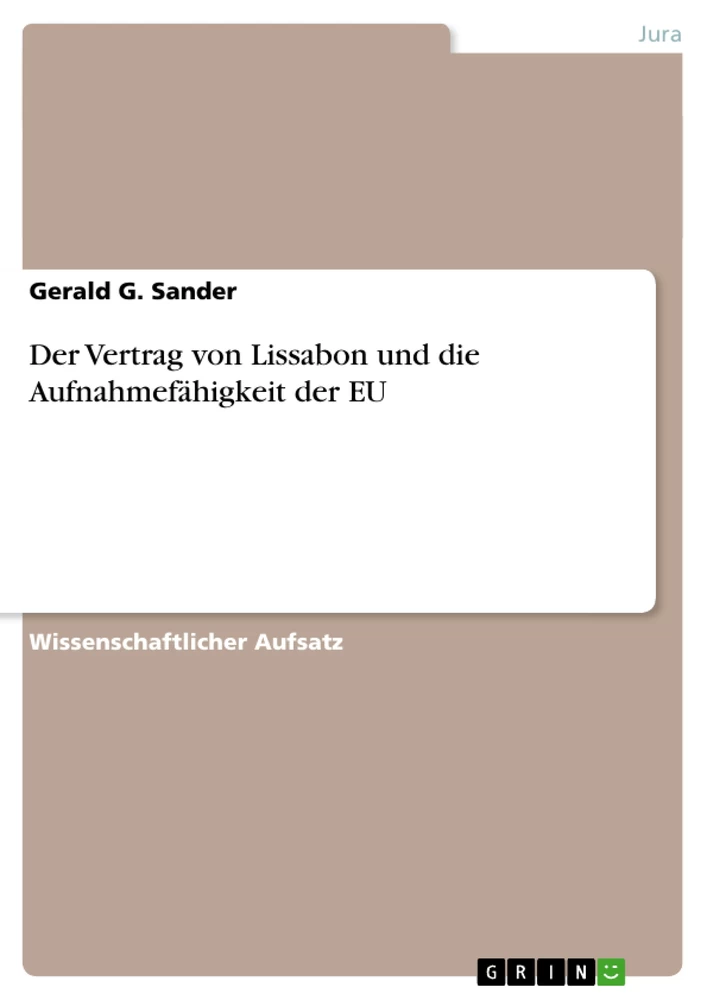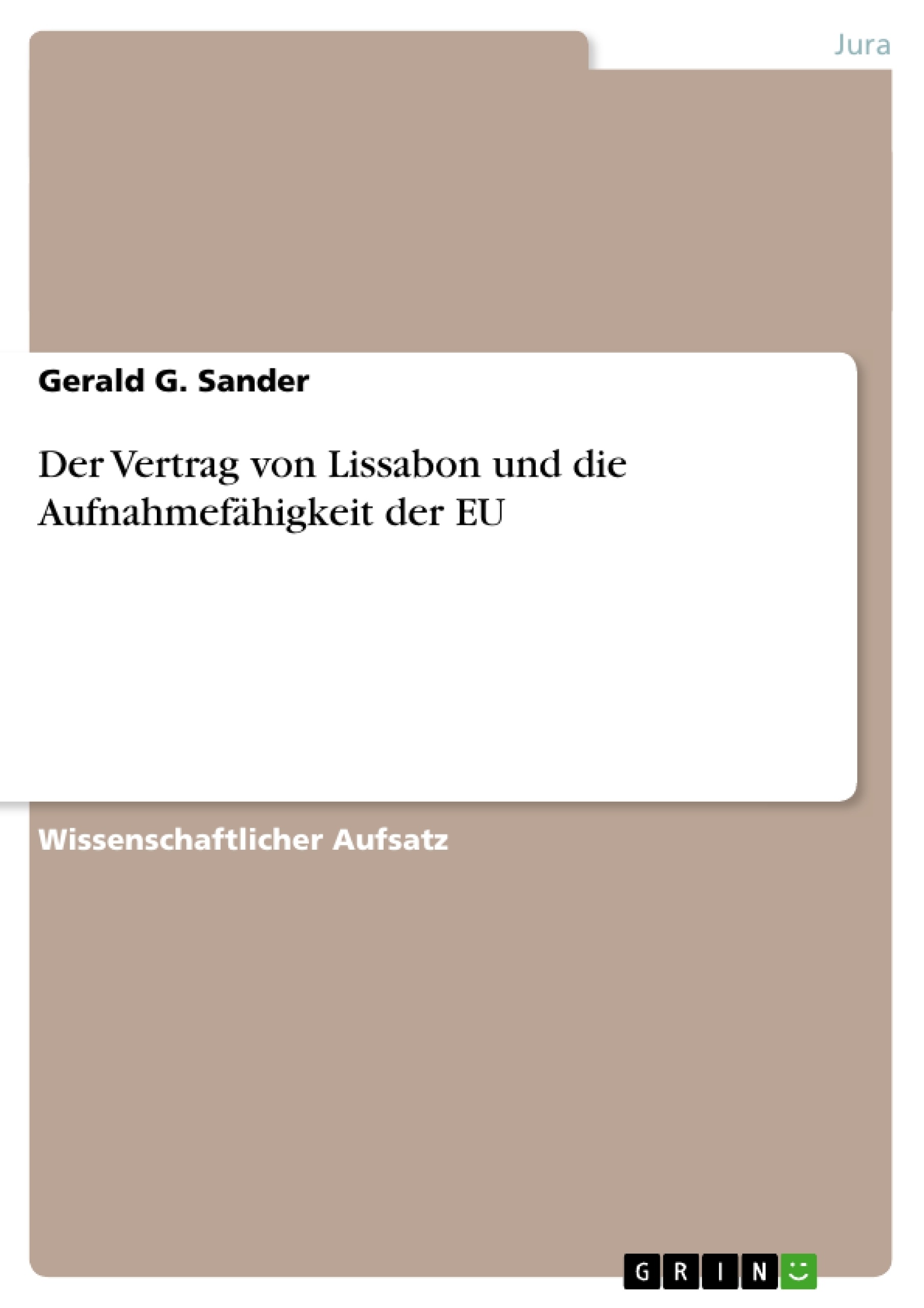Staaten, die eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union anstreben, müssen für den Beitritt verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Zunächst muss es sich bei dem Beitrittskandidaten gemäß Art. 49 EUV um einen europäischen Staat handeln. Weitere Bedingung ist die Erfüllung der sog. Kopenhagener Kriterien durch den Beitrittsstaat. Hierzu zählen die politischen und die ökonomischen Kriterien sowie die Übernahme des gemeinschaftlichen Besitzstandes. Ferner wird verlangt, dass die EU selbst fähig zur Aufnahme eines weiteren Staates ist. Dieses Kriterium wird insbesondere im Hinblick auf einen Beitritt der Türkei, aber auch Russlands diskutiert. Während eine Aufnahme Russlands an diesem Kriterium scheitern würde, werden im Fall der Türkei zumindest umfassende Reformen der EU vor dem Beitritt angemahnt.
Am 13. Dezember 2007 unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs sowie die Außenminister der EU-Mitgliedstaaten feierlich den Vertrag von Lissabon. Der neue Vertrag übernimmt die wesentlichen inhaltlichen Fortschritte des gescheiterten Verfassungsvertrags, baut als Änderungsvertrag aber auf der Struktur der beiden bestehenden Verträge – des Vertrages über die Europäische Union (EUV) und des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) – auf. Während der EU-Vertrag seinen Namen behält (im Folgenden: EUV n.F.), wird der Name des EG-Vertrages in „Vertrag über die Arbeitsweise der Europäi-schen Union (AEUV)“ geändert. Der Begriff „Gemeinschaft“ wird im Vertragstext dabei konsequent durch „Union“ ersetzt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Überblick über wesentliche Neuerungen im Lissabonner Vertrag
- 1. Institutionelle Änderungen
- 2. Verfahrensänderungen
- 3. Neuerungen bei den Sachpolitiken
- 4. Weitere ausgewählte Neuerungen
- 5. Nicht übernommene Regelungen aus dem Verfassungsvertrag
- III. Bewertung ausgewählter Aspekte
- 1. Die Kompetenzprobleme im Mehrebenensystem
- 2. Effiziente Entscheidungsstrukturen im Rat?
- 3. Künftige institutionelle Gewichtsverteilung
- 4. Steigerung der demokratischen Legitimation der EU
- 5. Bewertung
- IV. EU-Reform und Türkeibeitritt
- V. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung des Textes ist eine Analyse des Vertrags von Lissabon und seiner Auswirkungen auf die EU, insbesondere im Hinblick auf die Aufnahmefähigkeit der Union, speziell in Bezug auf den möglichen Beitritt der Türkei. Der Text untersucht die institutionellen und verfahrenstechnischen Neuerungen des Vertrags und bewertet deren Bedeutung für die zukünftige Entwicklung der EU.
- Institutionelle Reformen der EU durch den Vertrag von Lissabon
- Auswirkungen des Vertrags auf die Entscheidungsfindungsprozesse innerhalb der EU
- Bewertung der demokratischen Legitimation der EU nach Lissabon
- Die Rolle des Vertrags im Kontext des möglichen Türkeibeitritts
- Kompetenzverteilung und -probleme im mehrstufigen EU-System
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Voraussetzungen für einen EU-Beitritt, insbesondere die Kopenhagener Kriterien und die Aufnahmefähigkeit der EU selbst. Der Fokus liegt auf der Diskussion um den Beitritt der Türkei und die Notwendigkeit von EU-Reformen in diesem Zusammenhang. Der Vertrag von Lissabon wird als bedeutender Reformversuch nach den gescheiterten Referenden zum Verfassungsvertrag vorgestellt, der die EU handlungsfähiger und demokratischer machen soll. Die Ablehnung des Vertrags durch Irland und die damit verbundene Unsicherheit über dessen Zukunft werden ebenfalls angesprochen. Die Haltung von Merkel und Sarkozy, keine weiteren Erweiterungen ohne Einigung auf den neuen Vertrag zuzulassen, wird erwähnt, ebenso wie die Absicht der Kommission, die Beitrittsverhandlungen mit Kroatien abzuschließen. Der Text kündigt einen Überblick über die Neuerungen des Vertrags und eine Bewertung einzelner Aspekte an, einschließlich des Türkeibeitritts.
II. Überblick über wesentliche Neuerungen im Lissabonner Vertrag: Dieses Kapitel bietet einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Neuerungen des Vertrags von Lissabon. Es gliedert sich in institutionelle Änderungen (z.B. die Einrichtung des Europäischen Rates mit einem Präsidenten und die Rolle des Hohen Vertreters für die Außen- und Sicherheitspolitik), verfahrenstechnische Änderungen, Neuerungen bei den Sachpolitiken, weitere ausgewählte Neuerungen und nicht übernommene Regelungen aus dem gescheiterten Verfassungsvertrag. Der Abschnitt zu den institutionellen Änderungen beispielsweise analysiert die Auswirkungen der längeren Amtszeit des Präsidenten des Europäischen Rates auf die europäische Politik, sowie die Bündelung der Funktionen des EU-Außenkommissars und des EU-Außenbeauftragten im neuen Amt des Hohen Vertreters. Die geplante und dann (vorübergehend) verhinderte Reduzierung der Kommissare wird ebenfalls thematisiert. Das Kapitel liefert somit eine umfassende Darstellung der strukturellen und prozeduralen Veränderungen, die der Vertrag mit sich bringt.
III. Bewertung ausgewählter Aspekte: Dieses Kapitel analysiert kritisch ausgewählte Aspekte des Vertrags von Lissabon. Es befasst sich mit den Kompetenzproblemen im Mehrebenensystem, der Effizienz der Entscheidungsstrukturen im Rat, der zukünftigen institutionellen Gewichtsverteilung, der Steigerung der demokratischen Legitimation und einer abschließenden Gesamtbewertung. Jeder dieser Punkte wird detailliert untersucht und mit Argumenten und Beispielen untermauert. Die Analyse der Kompetenzprobleme verdeutlicht beispielsweise die Herausforderungen der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ebenen der EU, während die Diskussion um effiziente Entscheidungsstrukturen im Rat die institutionellen Mechanismen und deren Wirksamkeit beleuchtet. Die Bewertung der demokratischen Legitimation untersucht die Auswirkungen des Vertrags auf die demokratische Repräsentation und Partizipation. Insgesamt bietet das Kapitel eine differenzierte und fundierte Einschätzung der Auswirkungen des Vertrags von Lissabon.
IV. EU-Reform und Türkeibeitritt: Dieses Kapitel behandelt den Zusammenhang zwischen der EU-Reform durch den Vertrag von Lissabon und der Frage des Türkeibeitritts. Es argumentiert, dass aufgrund der politischen Bedeutung und der Größe der türkischen Bevölkerung eine Reform der EU unerlässlich ist, um einen möglichen Beitritt zu ermöglichen. Die genauen Argumente und Beispiele, wie der Türkeibeitritt die EU-Reform beeinflusst und umgekehrt, werden hier ausführlich dargelegt und analysiert.
Schlüsselwörter
Vertrag von Lissabon, EU-Reform, Türkeibeitritt, institutionelle Änderungen, Entscheidungsstrukturen, demokratische Legitimation, Kompetenzverteilung, Mehrebenensystem, Aufnahmefähigkeit der EU, Kopenhagener Kriterien.
Häufig gestellte Fragen zum Lissabonner Vertrag
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text bietet eine umfassende Analyse des Vertrags von Lissabon und seiner Auswirkungen auf die Europäische Union (EU), insbesondere im Hinblick auf die Aufnahmefähigkeit der EU für einen möglichen Beitritt der Türkei. Er untersucht institutionelle und verfahrenstechnische Neuerungen und bewertet deren Bedeutung für die zukünftige Entwicklung der EU.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themenschwerpunkte: Institutionelle Reformen der EU durch den Vertrag von Lissabon; Auswirkungen des Vertrags auf die Entscheidungsfindungsprozesse; Bewertung der demokratischen Legitimation der EU nach Lissabon; Rolle des Vertrags im Kontext des möglichen Türkeibeitritts; Kompetenzverteilung und -probleme im mehrstufigen EU-System.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text gliedert sich in fünf Kapitel: I. Einleitung: Einführung in den Kontext des Türkeibeitritts und die Notwendigkeit von EU-Reformen, Vorstellung des Lissabonner Vertrags als Reformversuch. II. Überblick über wesentliche Neuerungen im Lissabonner Vertrag: Detaillierte Darstellung der institutionellen, verfahrenstechnischen und sachpolitischen Neuerungen des Vertrags. III. Bewertung ausgewählter Aspekte: Kritische Analyse ausgewählter Aspekte des Vertrags, z.B. Kompetenzprobleme, Entscheidungsstrukturen, demokratische Legitimation. IV. EU-Reform und Türkeibeitritt: Zusammenhang zwischen EU-Reform und der Frage des Türkeibeitritts. V. Schlusswort: Zusammenfassung und Schlussfolgerungen (nicht explizit im Snippet enthalten).
Welche institutionellen Änderungen werden im Text beschrieben?
Der Text beschreibt unter anderem die Einrichtung des Europäischen Rates mit einem Präsidenten, die Rolle des Hohen Vertreters für die Außen- und Sicherheitspolitik, die Auswirkungen der längeren Amtszeit des Präsidenten des Europäischen Rates und die Bündelung der Funktionen des EU-Außenkommissars und des EU-Außenbeauftragten.
Wie bewertet der Text die demokratische Legitimation der EU nach Lissabon?
Der Text untersucht die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon auf die demokratische Repräsentation und Partizipation. Eine detaillierte Bewertung der Steigerung der demokratischen Legitimation findet sich im Kapitel III.
Welche Rolle spielt der Türkeibeitritt im Text?
Der Türkeibeitritt ist ein zentraler Aspekt des Textes. Er wird als wichtiger Faktor für die Notwendigkeit von EU-Reformen dargestellt und im Zusammenhang mit der Aufnahmefähigkeit der EU und dem Vertrag von Lissabon analysiert.
Welche Schlüsselwörter sind im Text relevant?
Schlüsselwörter sind: Vertrag von Lissabon, EU-Reform, Türkeibeitritt, institutionelle Änderungen, Entscheidungsstrukturen, demokratische Legitimation, Kompetenzverteilung, Mehrebenensystem, Aufnahmefähigkeit der EU, Kopenhagener Kriterien.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text ist für akademische Zwecke bestimmt und eignet sich für die Analyse der im Lissabonner Vertrag enthaltenen Themen.
- Quote paper
- Dr. Gerald G. Sander (Author), 2009, Der Vertrag von Lissabon und die Aufnahmefähigkeit der EU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133987