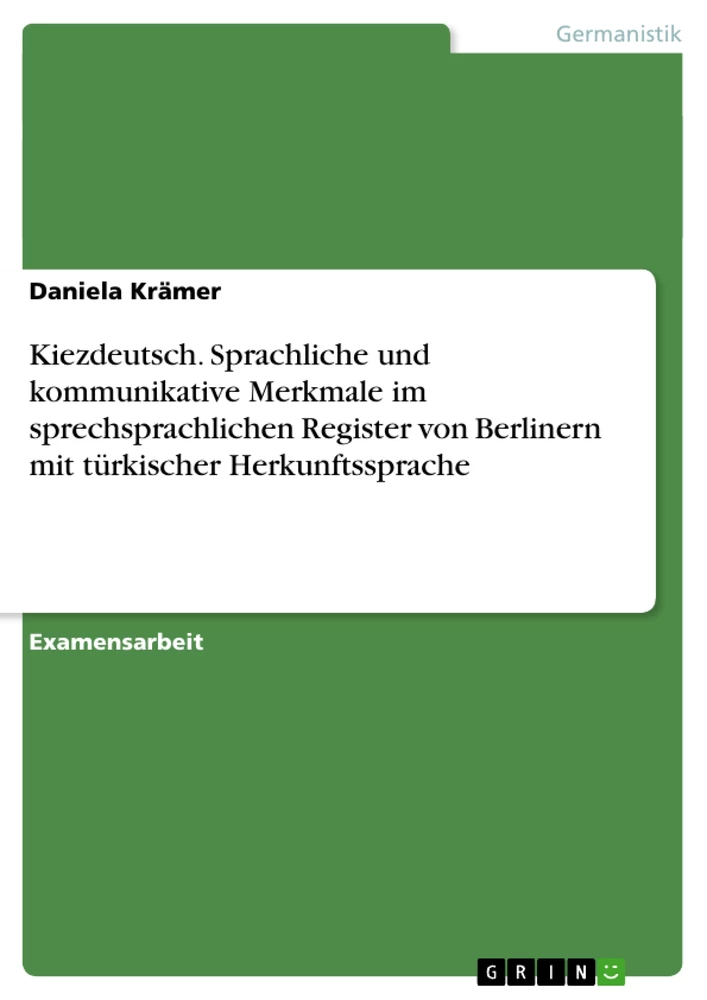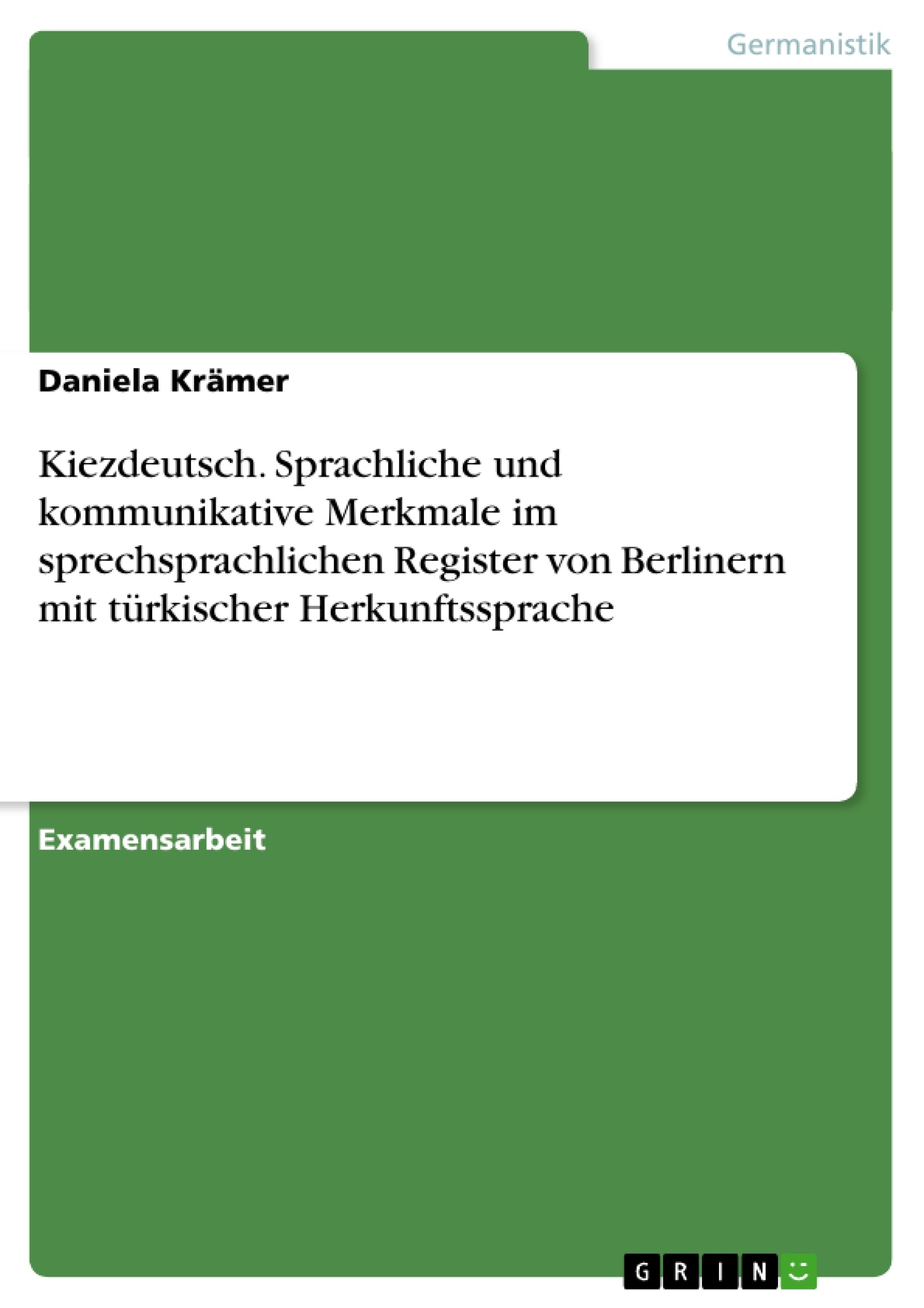„Wallah, ischwöre! Lassma Gesundbrunncenta gehn, lan!“ Diese Art zu sprechen ist in den letzten Jahren unter den Jugendlichen in Deutschland immer öfter zu beobachten. Das so genannte „Türkendeutsch“, „Kiezdeutsch“ oder „Kanak Sprak“ ist Gegenstand dieser Arbeit.
Diese Form der Jugendsprache, die man vor allem in vielen deutschen Großstädten findet, hat sich in den letzten Jahren zu einem Ethnolekt entwickelt, der nicht nur unter Heranwachsenden nicht-deutscher Herkunftssprache, sondern auch in anderen sozialen Gruppen und den Medien wieder auftaucht. Er hat sich von einer Sprache, die in der ersten Generation der Migranten als eine Art Übergangsdialekt zu fungieren schien, zu einem offenbar festen Bestandteil der deutschen Sprachvariationen entwickelt.
Das Gastarbeiterdeutsch der ersten Generation, das noch auf geringen Deutschkenntnissen beruhte, entwickelte sich in den neunziger Jahren zu einer ethnolektalen Varietät des Deutschen. Diese Varietät wird vor allem von jungen, türkischstämmigen Männern gesprochen, die zwar in Deutschland aufgewachsen sind, sich hier aber dennoch nicht völlig zugehörig fü̈hlen. Die zweite und dritte Generation der damaligen Gastarbeiter macht in einigen Gegenden Deutschlands mittlerweile über 50 Prozent der Bevölkerung aus. An den Rand der Gesellschaft gedrückt, identifizieren sie sich eher mit dem von der Gesellschaft auferlegten Stereotyp eines Türken.
Diese Arbeit soll eventuelle Unterschiede innerhalb der Gruppe, die den Ethnolekt benutzt, untersuchen. Es wird vermutet, dass dieser bei männlichen Sprechern ausgeprägter ist als bei weiblichen, und dass er teilweise bewusst zur Abschreckung anderer eingesetzt wird. Des Weiteren gilt es zu prüfen, ob die soziale und kulturelle Orientierung Einfluss auf die Sprecher hat und ob und wann Registerwechsel stattfinden. Ist dieser „Gettoslang“ vielleicht sogar die neue Berliner Unterschichtensprache? Ein besonderer Fokus soll außerdem auf die mir aufgefallene sprachliche Kreativität der Jugendlichen gelegt werden. Merkmale, die in anderen Untersuchungen noch keine Beachtung gefunden haben, stehen im Zentrum dieser Arbeit, ebenso wie das umfangreiche, innovative Vokabular der jungen Sprecher.
Meine Ausü̈hrungen beruhen auf Daten verschiedener Quellen. Zum einen werde ich mich auf aktuelle Forschungsberichte und deren Ergebnisse beziehen, zum anderen wurden von mir selbst Interviews mit 67 Jugendlichen durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die aktuelle Situation der Türken in Deutschland
- 2.1 Die soziale und politische Situation
- 2.2 Der soziolinguistische Hintergrund
- 2.2.1 Gastarbeiterdeutsch
- 2.2.2 Das Deutsch der zweiten und dritten Generation
- 2.3 Zur Interviewgruppe
- 3. Begriffsbestimmung
- 3.1 Varietät, Stil und Register
- 3.2 Soziolekt, Slang und Jugendsprache
- 3.3 Begriffsbestimmung des Ethnolekts „Kanak Sprak“
- 3.4 Begriffsbestimmung Code-Switching, Code-Mixing und Language Crossing
- 4. Forschungsüberblick
- 4.1 Hinnenkamp: „Gemischt Sprechen“ als Act of Identity
- 4.2 Auer/Dirim: Kanak Sprak bei nicht-türkischen Sprechern
- 4.3 Kallmeyer/ Keim: „Kommunikativer soziokultureller Stil“ in Mannheim
- 4.4 Jannis Androutsopoulos: Einfluss der Medien
- 5. Der Ethnolekt Kanak Sprak - Korpusanalyse
- 5.1 Inhalt und Gliederung der Korpusanalyse
- 5.2 Datenerhebung: Vorgehensweise und eventuelle Probleme
- 5.2.1 Differenzierung des Korpus
- 5.2.2 Eventuelle Probleme
- 5.2.2.1 Zwischenmenschliche Schwierigkeiten
- 5.2.2.2 Technische Schwierigkeiten
- 5.3 Korpusanalyse - Die Grundmerkmale der Kanak Sprak
- 5.3.1 Phonetik/ Phonologie
- 5.3.2 Prosodische Merkmale
- 5.3.3 Morphologie und Syntax
- 5.3.4 Lexikon und Diskursorganisation
- 5.3.5 Außer sprachliche Merkmale
- 5.4 Sprachliche Besonderheiten in Berlin Wedding
- 5.4.1 „Reime - Meime“
- 5.4.2 Onomatopoetische Elemente
- 5.4.3 Geheimsprache „Ohne Rotkohl“
- 5.5 Geschlechtspezifische Unterschiede
- 6. Kanak Sprak als Ausdruck soziokultureller Identität
- 7. Reaktionen auf die „Kanak Sprak“
- 7.1 Reaktionen der Mehrheitsgesellschaft auf die „Kanak Sprak“
- 7.2 Repräsentation in den Medien
- 7.3 Kanak Sprak - Die neue Berliner Unterschichtensprache?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Ethnolekt „Kanak Sprak“, der vor allem unter Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund in deutschen Großstädten gesprochen wird. Ziel ist es, die sprachlichen Merkmale dieser Varietät zu analysieren und ihren Zusammenhang mit soziokultureller Identität zu beleuchten. Dabei werden auch die Reaktionen der Mehrheitsgesellschaft und die mediale Repräsentation betrachtet.
- Sprachliche Merkmale des Ethnolekts „Kanak Sprak“
- Soziokulturelle Hintergründe und Identität der Sprecher
- Vergleich mit anderen Jugendsprachen und Varietäten
- Reaktionen der Mehrheitsgesellschaft und mediale Darstellung
- „Kanak Sprak“ als Ausdruck von Zugehörigkeit und Abgrenzung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema „Kanak Sprak“ ein und beschreibt die Relevanz dieser Jugendsprache in deutschen Großstädten. Sie skizziert die Entwicklung vom Gastarbeiterdeutsch zum Ethnolekt und benennt die Forschungsfragen der Arbeit, die sich mit sprachlichen Unterschieden innerhalb der Sprechergruppe, dem Einfluss der sozialen und kulturellen Orientierung und der Frage nach Registerwechseln beschäftigen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der sprachlichen Kreativität der Jugendlichen und bisher unbeachteten Merkmalen.
2. Die aktuelle Situation der Türken in Deutschland: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die soziale und sprachliche Situation der türkischen Bevölkerung in Deutschland. Es beleuchtet die soziopolitischen Bedingungen und den soziolinguistischen Hintergrund, einschließlich der Entwicklung des Gastarbeiterdeutschen und des Deutschen der zweiten und dritten Generation. Der Abschnitt zur Interviewgruppe beschreibt die Zusammensetzung der befragten Jugendlichen und gibt Kontext für die folgende Analyse.
3. Begriffsbestimmung: Hier werden wichtige Fachbegriffe wie Varietät, Stil, Register, Soziolekt, Slang, Jugendsprache, Ethnolekt, Code-Switching, Code-Mixing und Language Crossing definiert, um ein gemeinsames Verständnis der verwendeten Terminologie zu gewährleisten und die wissenschaftliche Grundlage der Arbeit zu sichern. Diese präzise Definition der Begriffe ist entscheidend für die objektive Analyse der Sprachdaten.
4. Forschungsüberblick: Das Kapitel bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema „Türkendeutsch“. Es werden die wichtigsten Studien und deren Ergebnisse zu den Themen „Gemischt Sprechen“ als Identitätsausdruck, die Verwendung von „Kanak Sprak“ bei nicht-türkischen Sprechern, der „Kommunikative soziokulturelle Stil“ und der Einfluss der Medien auf die Sprachentwicklung vorgestellt und kritisch bewertet. Die Auseinandersetzung mit dem bestehenden Forschungsstand legt die Grundlage für die eigene Analyse.
5. Der Ethnolekt Kanak Sprak - Korpusanalyse: Dieser zentrale Teil der Arbeit präsentiert die detaillierte Analyse des erhobenen Sprachmaterials. Die Kapitel beschreiben die Vorgehensweise bei der Datenerhebung, die Herausforderungen (zwischenmenschliche und technische Schwierigkeiten) und die Methodik der Korpusanalyse. Die Analyse der sprachlichen Merkmale (Phonetik/Phonologie, Prosodie, Morphologie, Syntax, Lexikon, Diskursorganisation und außer sprachliche Merkmale) sowie die sprachlichen Besonderheiten im Berliner Wedding (Reime, Onomatopoetische Elemente, Geheimsprache) werden ausführlich dargestellt. Die Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Unterschiede rundet die Analyse ab.
6. Kanak Sprak als Ausdruck soziokultureller Identität: Dieses Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen dem Ethnolekt „Kanak Sprak“ und der soziokulturellen Identität der Sprecher. Es wird untersucht, wie die Sprache als Mittel der Identitätsbildung, der Abgrenzung und der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe dient. Die Analyse zeigt, wie die sprachliche Praxis soziale und kulturelle Aspekte widerspiegelt.
7. Reaktionen auf die „Kanak Sprak“: Der siebte Abschnitt analysiert die Reaktionen der Mehrheitsgesellschaft und der Medien auf den Ethnolekt „Kanak Sprak“. Es wird untersucht, wie die Sprache wahrgenommen, interpretiert und bewertet wird und welche gesellschaftlichen und politischen Implikationen sich daraus ergeben. Die Betrachtung der medialen Repräsentation verdeutlicht, wie „Kanak Sprak“ in der öffentlichen Debatte konstruiert und positioniert wird.
Schlüsselwörter
Kanak Sprak, Türkendeutsch, Kiezdeutsch, Ethnolekt, Jugendsprache, Soziolekt, Migrationshintergrund, Sprachvariation, Identität, Code-Switching, Code-Mixing, Sprachwandel, Berlin, Korpusanalyse, Soziolinguistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Der Ethnolekt Kanak Sprak"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert den Ethnolekt „Kanak Sprak“, eine Jugendsprache, die hauptsächlich von Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund in deutschen Großstädten gesprochen wird. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der sprachlichen Merkmale, ihrer Verbindung zur soziokulturellen Identität der Sprecher und den Reaktionen der Mehrheitsgesellschaft sowie der medialen Darstellung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, die aktuelle Situation der Türken in Deutschland, Begriffsbestimmung, Forschungsüberblick, Korpusanalyse des Kanak Sprak, Kanak Sprak als Ausdruck soziokultureller Identität und Reaktionen auf den Kanak Sprak. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas und baut aufeinander auf.
Was wird unter „Kanak Sprak“ verstanden?
„Kanak Sprak“ ist ein Ethnolekt, eine Sprachvarietät, die mit einer bestimmten ethnischen Gruppe verbunden ist. In diesem Fall handelt es sich um Jugendliche mit türkischem Migrationshintergrund in Deutschland. Die Arbeit definiert den Begriff präzise und grenzt ihn von ähnlichen Begriffen wie Soziolekt, Jugendsprache und anderen Sprachvarietäten ab.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Korpusanalyse, die auf der Erhebung und Auswertung von Sprachdaten basiert. Die Datenerhebung wird detailliert beschrieben, inklusive der Herausforderungen und der angewandten Methodik. Die Analyse umfasst phonetische, phonologische, morphologische, syntaktische und lexikalische Merkmale sowie die Diskursorganisation und außer-sprachliche Merkmale. Geschlechtsspezifische Unterschiede werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die sprachlichen Merkmale des Kanak Sprak, den Zusammenhang mit der soziokulturellen Identität der Sprecher, Vergleiche mit anderen Jugendsprachen, Reaktionen der Mehrheitsgesellschaft und die mediale Darstellung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der sprachlichen Kreativität und bisher unbeachteten Merkmalen.
Welche Ergebnisse liefert die Korpusanalyse?
Die Korpusanalyse beschreibt detailliert die sprachlichen Besonderheiten des Kanak Sprak, einschließlich phonetischer, phonologischer, morphologischer, syntaktischer und lexikalischer Merkmale sowie der Diskursorganisation und außer-sprachlicher Elemente. Spezifische Beispiele aus dem Berliner Wedding (z.B. Reime, Onomatopoetika, Geheimsprache) werden ebenfalls analysiert.
Wie wird der Zusammenhang zwischen „Kanak Sprak“ und Identität dargestellt?
Die Arbeit untersucht, wie „Kanak Sprak“ als Mittel der Identitätsbildung, der Abgrenzung und der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe dient. Die Analyse zeigt, wie sprachliche Praxis soziale und kulturelle Aspekte widerspiegelt und zur Konstruktion von Identität beiträgt.
Wie werden die Reaktionen auf „Kanak Sprak“ beschrieben?
Die Arbeit analysiert die Reaktionen der Mehrheitsgesellschaft und der Medien auf den Ethnolekt „Kanak Sprak“, einschließlich der Wahrnehmung, Interpretation und Bewertung der Sprache und der daraus resultierenden gesellschaftlichen und politischen Implikationen. Die mediale Repräsentation und die Konstruktion von „Kanak Sprak“ in der öffentlichen Debatte werden ebenfalls untersucht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kanak Sprak, Türkendeutsch, Kiezdeutsch, Ethnolekt, Jugendsprache, Soziolekt, Migrationshintergrund, Sprachvariation, Identität, Code-Switching, Code-Mixing, Sprachwandel, Berlin, Korpusanalyse, Soziolinguistik.
- Quote paper
- Daniela Krämer (Author), 2008, Kiezdeutsch. Sprachliche und kommunikative Merkmale im sprechsprachlichen Register von Berlinern mit türkischer Herkunftssprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133981