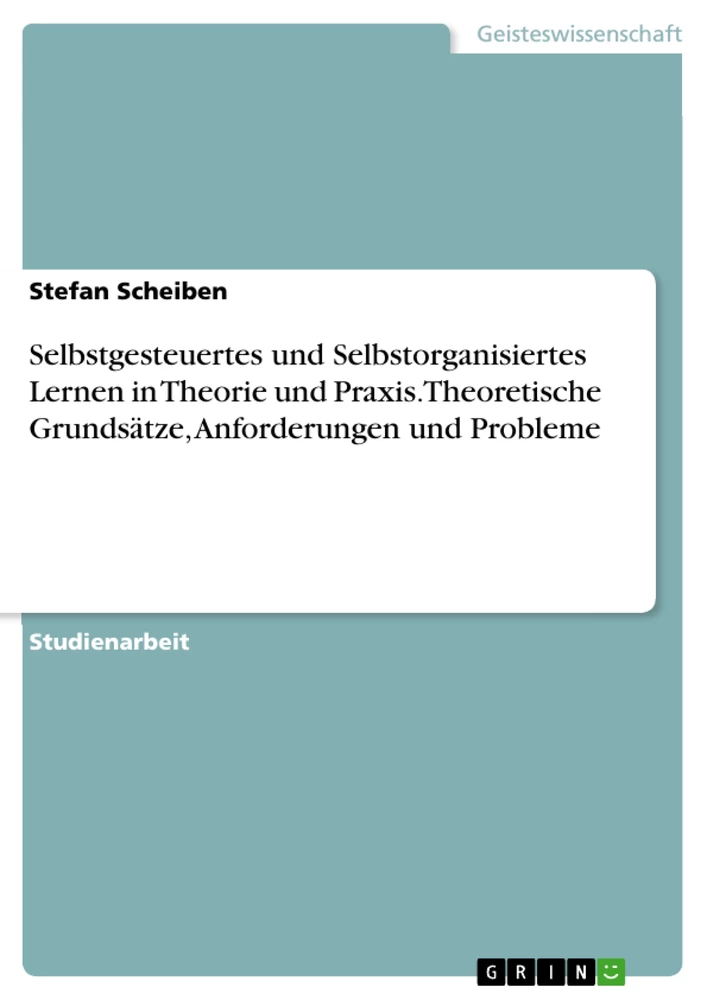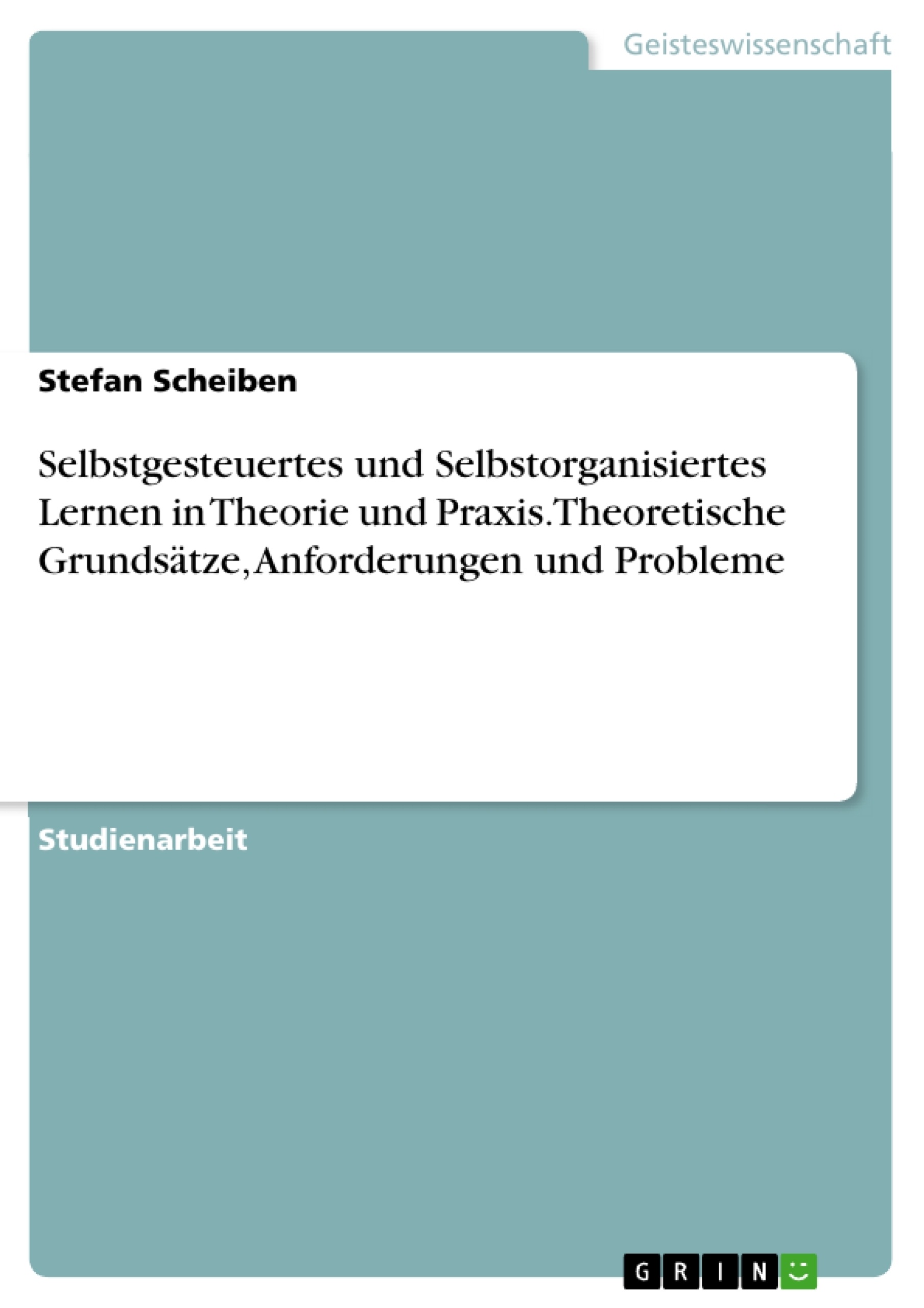Eine präzise Definition des Konzeptes des selbst gesteuerten bzw. selbst organisierten Lernens scheint derzeit nicht zu existieren. Möglicherweise liegt dies nicht primär an fachlichen Mängeln, sondern am Untersuchungsgegenstand selbst, der an die entsprechende Situation angepasst gedacht werden muss.
Eine Selbststeuerung von Lernprozessen setzt natürlich ein gewisses Menschenbild voraus. Dieses entstammt der humanistischen Psychologie: Im Prinzip ist der Mensch konstruktiv. Zwar wird das Individuum durch äußere Zwänge eingeschränkt, er hat jedoch gewisse Grundbedürfnisse. Eines davon ist, sich zu entfalten und zu entwickeln, kurz: zu lernen.
Was wir tun, hängt davon ab, welche Bedeutung wir den Dingen zumessen. Der Sinn von Handlungen ist. Der Sinn von Handlungen ist also objektiv von außen gegeben, sondern ist abhängig vom individuellen Handlungsplan.
Zwar nimmt der Mensch Reize auf, er reagiert jedoch reflektiert. Die Signale von außen werden vom Einzelnen im Kontext seiner gesellschaftlichen und biografischen Situation interpretiert. Er ist also nicht einfach konditioniert, sondern, behält die aktive Kontrolle.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Definition: Selbstgesteuertes und Selbstorganisiertes Lernen
- 2. Theoretische Grundsätze
- 3. Das zugrunde liegende Menschenbild
- 4. Das Dilemma der Lernziele
- 5. Versuche des selbstgesteuerten Lernens
- 6. Anforderungen an Lernen als geplantes Handeln
- 7. Probleme der Selbststeuerung
- 8. Die Rolle des Pädagogen
- 9. Verantwortlichkeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht selbstgesteuertes und selbstorganisiertes Lernen in Theorie und Praxis. Ziel ist es, das Konzept zu definieren, die zugrundeliegenden theoretischen Prinzipien zu erläutern und die Herausforderungen und Möglichkeiten dieser Lernform aufzuzeigen.
- Definition und Abgrenzung selbstgesteuerten und selbstorganisierten Lernens
- Theoretische Grundlagen und das zugrundeliegende Menschenbild
- Herausforderungen und Probleme bei der Selbststeuerung im Lernprozess
- Die Rolle des Pädagogen im Kontext selbstgesteuerten Lernens
- Verantwortlichkeiten von Lernenden und Lehrenden
Zusammenfassung der Kapitel
1. Definition: Selbstgesteuertes und Selbstorganisiertes Lernen: Dieses Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten bei der präzisen Definition von selbstgesteuertem und selbstorganisiertem Lernen. Es analysiert die Definition der Kultusministerkonferenz, kritisiert deren Einschränkung auf institutionelles Lernen und betont den Unterschied, aber auch die synonym verwendete Gleichsetzung der beiden Begriffe in der Literatur. Es wird herausgestellt, dass das Fehlen von Fremdsteuerung allein nicht ausreicht, um von selbstorganisiertem Lernen zu sprechen, und die Verankerung des Konzepts in sozialpsychologischen und soziologischen Modellen wird hervorgehoben.
2. Theoretische Grundsätze: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für selbstgesteuertes und selbstorganisiertes Lernen dar. Es betont die Wichtigkeit der Einbettung des Lernprozesses in die Lebenswelt des Individuums, die Notwendigkeit, unbewusste Lernstrategien zu reflektieren und aufzuarbeiten, sowie die kontinuierliche Erweiterung und Überprüfung von Strategien und Alltagswissen. Die Kapitel verdeutlicht, wie Routinewissen problematisiert und neue Methoden eingeübt werden müssen.
3. Das zugrunde liegende Menschenbild: Der Abschnitt erläutert das Menschenbild, welches dem Konzept des selbstgesteuerten und selbstorganisierten Lernens zugrunde liegt. Es werden zentrale Aspekte des symbolischen Interaktionismus diskutiert, wie die Bedeutung der alltäglichen Erfahrung, die subjektive Interpretation von Situationen und die aktive Rolle des Individuums im Lernprozess. Die Kompetenz des Menschen, Situationen basierend auf seinem Alltagswissen zu strukturieren, wird als essentiell für selbstorganisiertes Lernen dargestellt.
4. Das Dilemma der Lernziele: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und kann hier nicht erstellt werden)
5. Versuche des selbstgesteuerten Lernens: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und kann hier nicht erstellt werden)
6. Anforderungen an Lernen als geplantes Handeln: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und kann hier nicht erstellt werden)
7. Probleme der Selbststeuerung: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und kann hier nicht erstellt werden)
8. Die Rolle des Pädagogen: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und kann hier nicht erstellt werden)
9. Verantwortlichkeiten: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und kann hier nicht erstellt werden)
Schlüsselwörter
Selbstgesteuertes Lernen, Selbstorganisiertes Lernen, Lernprozesse, Menschenbild, Symbolischer Interaktionismus, Pädagogik, Reflexion, Alltagswissen, Selbststeuerung, Verantwortung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Selbstgesteuertes und Selbstorganisiertes Lernen
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht selbstgesteuertes und selbstorganisiertes Lernen in Theorie und Praxis. Sie definiert das Konzept, erläutert die zugrundeliegenden theoretischen Prinzipien und zeigt die Herausforderungen und Möglichkeiten dieser Lernform auf.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst die Definition und Abgrenzung selbstgesteuerten und selbstorganisierten Lernens, die theoretischen Grundlagen und das zugrundeliegende Menschenbild, Herausforderungen und Probleme bei der Selbststeuerung im Lernprozess, die Rolle des Pädagogen im Kontext selbstgesteuerten Lernens und die Verantwortlichkeiten von Lernenden und Lehrenden.
Wie wird selbstgesteuertes und selbstorganisiertes Lernen definiert?
Das erste Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten bei der präzisen Definition. Es analysiert die Definition der Kultusministerkonferenz, kritisiert deren Einschränkungen und betont den Unterschied, aber auch die synonym verwendete Gleichsetzung der beiden Begriffe in der Literatur. Es wird hervorgehoben, dass das Fehlen von Fremdsteuerung allein nicht ausreicht, und die Verankerung des Konzepts in sozialpsychologischen und soziologischen Modellen wird hervorgehoben.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Das Kapitel zu den theoretischen Grundsätzen betont die Einbettung des Lernprozesses in die Lebenswelt des Individuums, die Reflexion unbewusster Lernstrategien, die kontinuierliche Erweiterung und Überprüfung von Strategien und Alltagswissen, sowie die Problematisierung von Routinewissen und das Einüben neuer Methoden.
Welches Menschenbild liegt dem Konzept zugrunde?
Der Abschnitt zum Menschenbild diskutiert zentrale Aspekte des symbolischen Interaktionismus, wie die Bedeutung der alltäglichen Erfahrung, die subjektive Interpretation von Situationen und die aktive Rolle des Individuums im Lernprozess. Die Kompetenz des Menschen, Situationen basierend auf seinem Alltagswissen zu strukturieren, wird als essentiell dargestellt.
Welche Rolle spielt der Pädagoge?
(Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und kann hier nicht beantwortet werden)
Welche Probleme der Selbststeuerung werden angesprochen?
(Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und kann hier nicht beantwortet werden)
Welche Anforderungen an Lernen als geplantes Handeln werden gestellt?
(Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und kann hier nicht beantwortet werden)
Welche Versuche des selbstgesteuerten Lernens werden vorgestellt?
(Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und kann hier nicht beantwortet werden)
Was ist das Dilemma der Lernziele?
(Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und kann hier nicht beantwortet werden)
Welche Verantwortlichkeiten werden diskutiert?
(Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und kann hier nicht beantwortet werden)
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Selbstgesteuertes Lernen, Selbstorganisiertes Lernen, Lernprozesse, Menschenbild, Symbolischer Interaktionismus, Pädagogik, Reflexion, Alltagswissen, Selbststeuerung, Verantwortung.
- Arbeit zitieren
- Stefan Scheiben (Autor:in), 2005, Selbstgesteuertes und Selbstorganisiertes Lernen in Theorie und Praxis. Theoretische Grundsätze, Anforderungen und Probleme, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133878