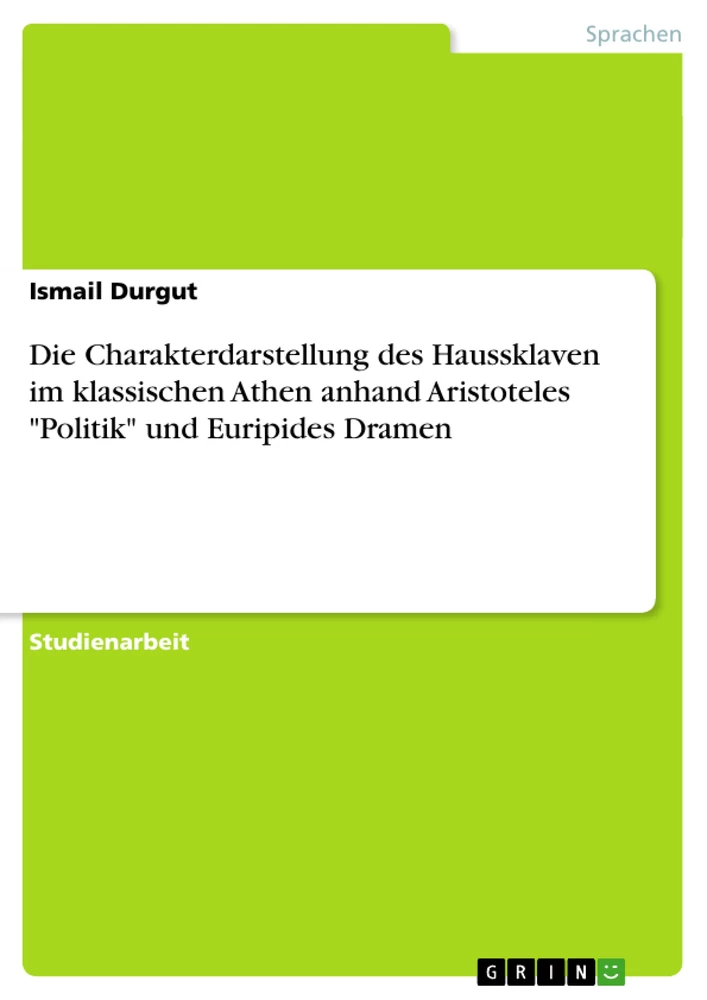Die Sklaverei ist das älteste Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnis, das in der Zersetzung der Urgesellschaft bereits vor der Herausbildung der altorientalischen Klassengesellschaft entstand. In der antiken Mittelmeerwelt entwickelte sich die Sklaverei zur herrschenden Produktionsweise und bestimmte damit einige Jahrhunderte die gesellschaftlichen Beziehungen.
Sklaven waren Menschen, die nicht über sich selbst verfügen konnten und einem anderen gehörten. Der Herr der Sklaven, der Sklavenhalter, besaß nicht nur ihre Arbeitskraft, sondern den ganzen Menschen. Der Mensch wurde Ware.
Die folgende Arbeit befasst sich mit dem Haussklaven im klassischen Griechenland, der sich durch eine besondere Herr-Sklave-Beziehung von den anderen abhebt. Um diese Beziehung besser zu verstehen, soll versucht werden, ein Charakterbild für den idealen Haussklaven zu erstellen.
Zu diesem Zweck wird der Sklave allgemein in die damalige athenische Gesellschaft eingeordnet. Daraufhin wird seine Darstellung in der Philosophie anhand Aristoteles Politik analysiert, weil dieses Werk die bislang vielleicht ausführlichste Quelle zu diesem Thema darstellt. Dem folgt die Darstellung des Dienersklaven in der Literatur anhand Euripides Tragödien. Eine Analyse findet am Beispiel der Medea statt.
Während Aristoteles als ein klarer Befürworter der Sklaverei verstanden wird, behauptet man von Euripides, er sei gegen dieses System gewesen. Es soll ein Versuch stattfinden auf die Frage eine Antwort zu finden, ob sich diese Einstellung in seinen Werken widerspiegelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. DIE ATHENISCHE GESELLSCHAFT IM KLASSISCHEN GRIECHENLAND
- 2.1 BÜRGER
- 2.2 FREIE NICHTBÜRGER
- 2.3 SKLAVEN
- 3. DARSTELLUNG DES HAUSSKLAVEN IN DER PHILOSOPHIE ANHAND ARISTOTELES POLITIK
- 3.1 POLITIK
- 3.2 DER „SKLAVE VON NATUR“
- 4. DARSTELLUNG DES DIENERSKLAVEN IN DER LITERATUR ANHAND EURIPIDES DRAMEN
- 4.1 DIE EURIPIDEISCHE KONZEPTION DES EINFACHEN SKLAVEN
- 4.2 DIE AMME IN EURIPIDES MEDEA
- 5. SCHLUSS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des Haussklaven im klassischen Athen. Ziel ist die Erstellung eines Charakterbildes des idealen Haussklaven, indem dessen Stellung in der athenischen Gesellschaft, seine philosophische Darstellung bei Aristoteles und seine literarische Darstellung in Euripides' Dramen analysiert werden. Die Arbeit beleuchtet die besondere Herr-Sklave-Beziehung im häuslichen Kontext und untersucht, ob sich die angeblich gegensätzlichen Haltungen Aristoteles' (als Befürworter der Sklaverei) und Euripides' (als vermeintlicher Gegner) in ihren Werken widerspiegeln.
- Stellung des Haussklaven in der athenischen Gesellschaft
- Aristoteles' philosophische Sicht auf Sklaverei und den Sklaven
- Darstellung des Sklaven in Euripides' Dramen, insbesondere in der Medea
- Vergleich der Perspektiven Aristoteles' und Euripides'
- Charakterisierung des idealen Haussklaven
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Sklaverei im klassischen Griechenland ein und erläutert die Bedeutung des Haussklaven im Kontext der damaligen Gesellschaft. Sie skizziert den Forschungsansatz, der die Analyse von Aristoteles' Politik und Euripides' Dramen umfasst, um ein Charakterbild des idealen Haussklaven zu erstellen und die unterschiedlichen Perspektiven auf die Sklaverei zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der besonderen Herr-Sklave-Beziehung innerhalb des häuslichen Bereichs, wobei die Geschlechterperspektive mit einbezogen wird. Die Einleitung stellt klar, dass die Arbeit einen Beitrag zum Verständnis der sozialen Dynamik und der moralischen Fragen im Zusammenhang mit der Sklaverei leisten möchte.
2. Die athenische Gesellschaft im klassischen Griechenland: Dieses Kapitel beschreibt die soziale Struktur des klassischen Athen, indem es die Gesellschaft in Bürger, freie Nichtbürger und Sklaven unterteilt. Es wird die Bedeutung der Bürgerbeteiligung am politischen Leben hervorgehoben und die rechtliche und soziale Stellung der Nichtbürger im Vergleich zu den Bürgern erläutert. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Beschreibung der sozialen Mobilität innerhalb der athenischen Gesellschaft, die im Gegensatz zu anderen zeitgenössischen Systemen einen gewissen sozialen Aufstieg ermöglichte. Die Kapitel unterstreichen die Komplexität der athenischen Sozialstruktur und die damit verbundenen Hierarchien und Möglichkeiten des sozialen Wandels. Die Unterteilung in Zensusklassen wird detailliert erklärt und in ihren sozialen und politischen Implikationen dargestellt.
3. Darstellung des Haussklaven in der Philosophie anhand Aristoteles Politik: Dieses Kapitel analysiert Aristoteles' Sicht auf Sklaverei, insbesondere im Kontext seiner "Politik". Es untersucht den Begriff des "Sklaven von Natur" und seine Bedeutung für das aristotelische Verständnis von Sklaverei. Die Analyse konzentriert sich auf die philosophischen Argumente und die ethischen Implikationen von Aristoteles' Position. Der Abschnitt befasst sich mit der Frage, inwieweit Aristoteles' Werk Aufschluss über die Beziehung zwischen Herr und Haussklave gibt und ob dies ein idealisiertes oder realistisches Bild darstellt. Es wird untersucht, welche Eigenschaften Aristoteles einem idealen Sklaven zuschreibt.
4. Darstellung des Dienersklaven in der Literatur anhand Euripides Dramen: Dieses Kapitel widmet sich der Darstellung des Sklaven in den Tragödien Euripides', insbesondere am Beispiel der Medea. Die Analyse konzentriert sich auf die Frage, wie Euripides das Thema Sklaverei literarisch behandelt und ob sich in seinen Werken eine Ablehnung der Sklaverei widerspiegelt. Die Rolle der Amme in der Medea wird im Detail untersucht, um die Komplexität der Sklavenexistenz und deren Beziehung zum Herrn zu veranschaulichen. Der Fokus liegt auf der literarischen Gestaltung und den impliziten oder expliziten Botschaften des Autors im Umgang mit dem Thema Sklaverei.
Schlüsselwörter
Haussklave, klassische griechische Gesellschaft, Athen, Aristoteles, Politik, Euripides, Medea, Sklaverei, Herr-Sklave-Beziehung, Charakterbild, Philosophie, Literatur, soziale Hierarchie, Zensusklassen, soziale Mobilität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Darstellung des Haussklaven im klassischen Athen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Darstellung des Haussklaven im klassischen Athen. Sie erstellt ein Charakterbild des idealen Haussklaven durch Analyse seiner Stellung in der athenischen Gesellschaft, seiner philosophischen Darstellung bei Aristoteles und seiner literarischen Darstellung in Euripides' Dramen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Herr-Sklave-Beziehung im häuslichen Kontext und dem Vergleich der Perspektiven von Aristoteles und Euripides.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit analysiert Aristoteles' „Politik“ für die philosophische Perspektive und Euripides' Dramen, insbesondere die „Medea“, für die literarische Darstellung des Haussklaven. Der Fokus liegt auf der Analyse der Herr-Sklave-Beziehung im häuslichen Kontext unter Berücksichtigung der Geschlechterperspektive.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Charakterbild des idealen Haussklaven zu erstellen und die unterschiedlichen Perspektiven auf Sklaverei bei Aristoteles (als vermeintlicher Befürworter) und Euripides (als vermeintlicher Gegner) zu vergleichen und zu analysieren. Sie will ein Beitrag zum Verständnis der sozialen Dynamik und der moralischen Fragen im Zusammenhang mit der Sklaverei im klassischen Athen leisten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, die athenische Gesellschaft, die philosophische Darstellung bei Aristoteles, die literarische Darstellung bei Euripides und Schlussfolgerung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik und trägt zum Gesamtverständnis bei.
Welche Aspekte der athenischen Gesellschaft werden behandelt?
Das Kapitel über die athenische Gesellschaft beschreibt die soziale Struktur, unterteilt in Bürger, freie Nichtbürger und Sklaven. Es beleuchtet die Bürgerbeteiligung am politischen Leben, die rechtliche und soziale Stellung der Nichtbürger und die soziale Mobilität innerhalb des athenischen Gesellschaftssystems. Die Zensusklassen und deren soziale und politische Implikationen werden detailliert erklärt.
Wie wird Aristoteles' Sicht auf Sklaverei dargestellt?
Der Abschnitt über Aristoteles analysiert dessen „Politik“ und den Begriff des „Sklaven von Natur“. Es werden die philosophischen Argumente und ethischen Implikationen von Aristoteles' Position untersucht und die Frage behandelt, inwieweit sein Werk Aufschluss über die Beziehung zwischen Herr und Haussklave gibt.
Wie wird Euripides' Darstellung des Sklaven behandelt?
Das Kapitel zu Euripides konzentriert sich auf die Darstellung des Sklaven in seinen Tragödien, insbesondere in der „Medea“. Die Analyse untersucht, ob sich in seinen Werken eine Ablehnung der Sklaverei widerspiegelt und analysiert detailliert die Rolle der Amme in der „Medea“.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Haussklave, klassische griechische Gesellschaft, Athen, Aristoteles, Politik, Euripides, Medea, Sklaverei, Herr-Sklave-Beziehung, Charakterbild, Philosophie, Literatur, soziale Hierarchie, Zensusklassen, soziale Mobilität.
- Quote paper
- Ismail Durgut (Author), 2009, Die Charakterdarstellung des Haussklaven im klassischen Athen anhand Aristoteles "Politik" und Euripides Dramen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133794