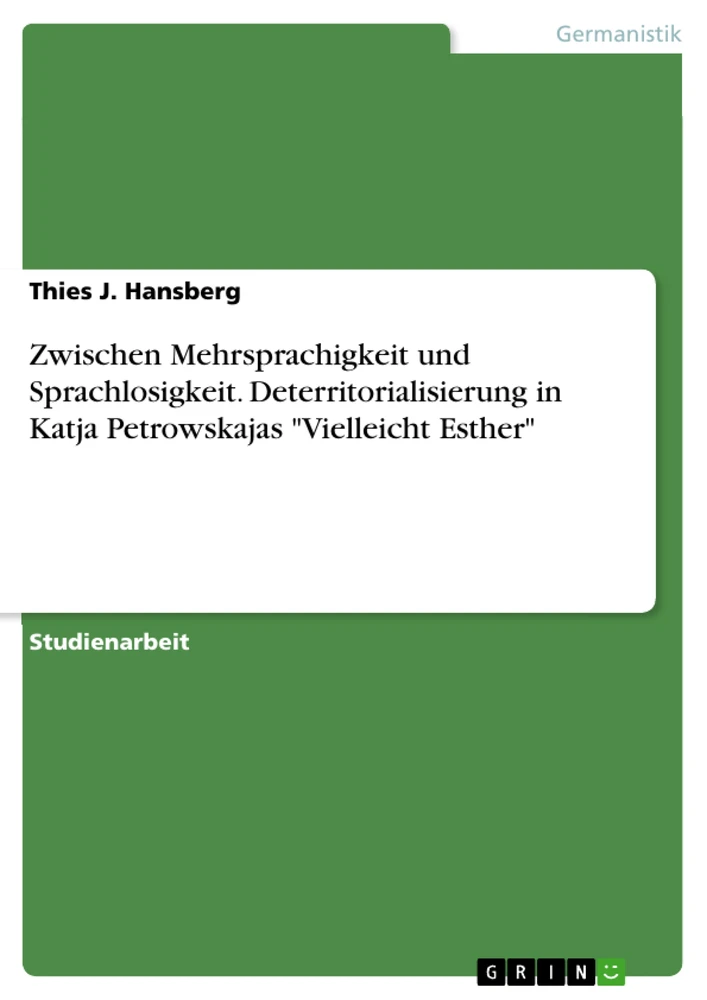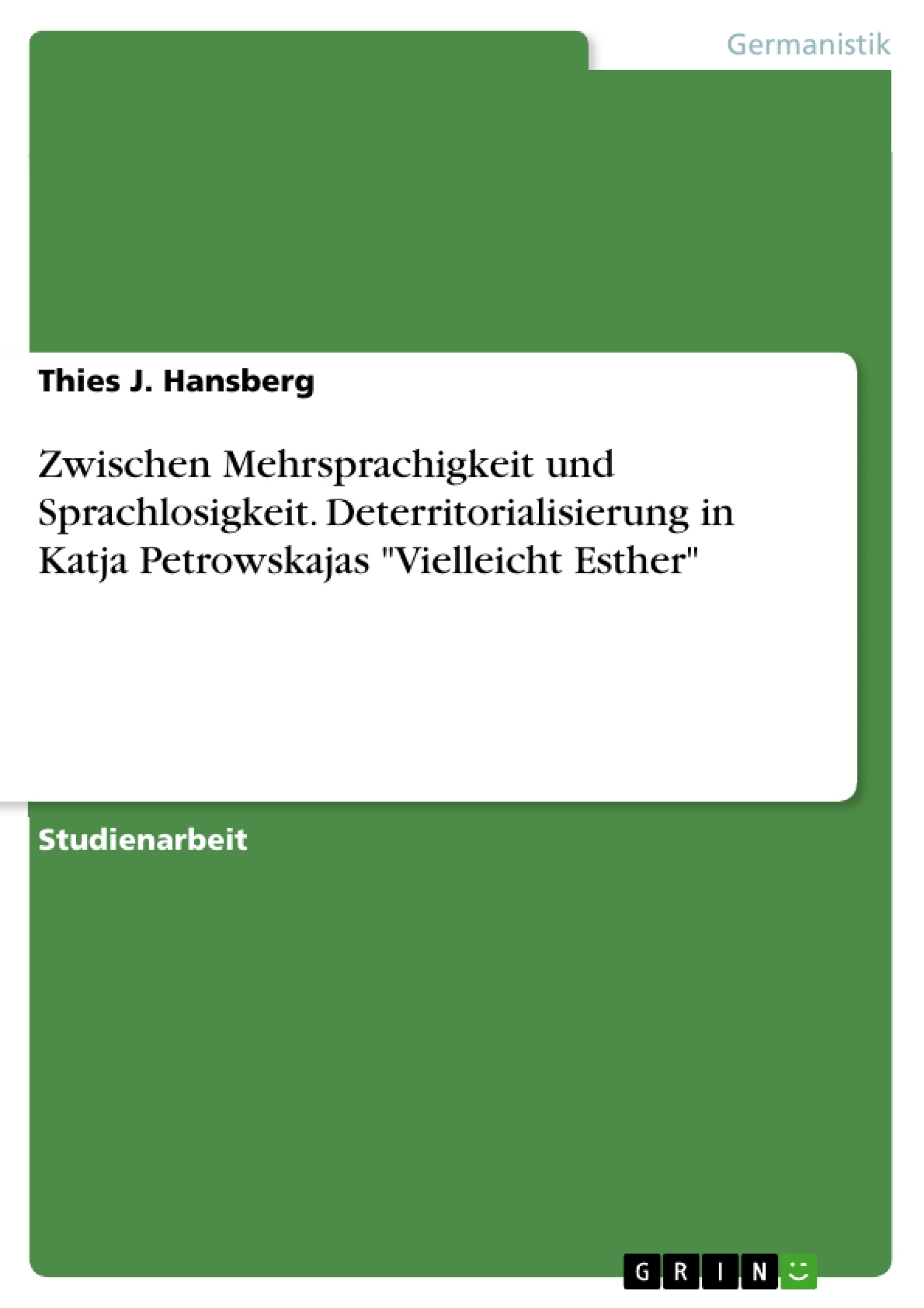Im Folgenden soll "Vielleicht Esther" von Katja Petrowskaja im Kontext der Mehrsprachigkeit, von der das Werk lebt, betrachtet werden: Was veranlasst die Erzählerin, im Deutschen, der Sprache der Täter*innen des Nationalsozialismus, ihre Literatursprache zu suchen (und zu finden)? Welche Rolle spielt die russische Sprache als Ausgangs- und Sozialisationssprache der Erzählerin, warum entscheidet sie sich gegen sie? Im Zeichen soziologischer Ansätze zur Theorie der Mehrsprachigkeit soll auch darauf eingegangen werden, inwiefern Katja Petrowskaja eine Sprache entwirft, die sich als Akt der Desintegration im Sinne Max Czolleks und als Beispiel der Literatur der Deterritorialisierung lesen lässt, sodass sie sich schließlich im "sprachlichen Zwischenraum" befindet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. VIELLEICHT ESTHER ALS POSTMONOLINGUALES ZEUGNIS.
- 2.1. MEHRSPRACHIGKEIT UND DETERRITORIALISIERUNG
- 2.2. AUS DEM RUSSISCHEN
- 2.3. INS DEUTSCHE.
- 3. ZUSAMMENFASSUNG....
- 4. LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert Katja Petrowskajas Roman "Vielleicht Esther" im Kontext der Mehrsprachigkeit, indem sie die Sprachwahl der Erzählerin und ihre Bedeutung im Rahmen der Familiengeschichte und der Erfahrung des Nationalsozialismus beleuchtet. Die Arbeit untersucht die Rolle des Deutschen als Sprache der Täter*innen und des Russischen als Sprache der Sozialisation und des historischen Traumas, sowie die Auswirkungen der Mehrsprachigkeit auf die Gestaltung der Erinnerung.
- Sprachliche Heimat und Deterritorialisierung
- Die Bedeutung des Russischen als imperiale und verdrängende Sprache
- Das Jiddische als verloren gegangene Muttersprache
- Die Konstruktion von Identität in der Mehrsprachigkeit
- Der "sprachliche Zwischenraum" als Ort der Desintegration
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und stellt den Roman "Vielleicht Esther" von Katja Petrowskaja vor. Die Autorin wird als eine Schriftstellerin vorgestellt, die in der deutschen Sprache schreibt, obwohl Russisch ihre Erstsprache ist. Die Einleitung beleuchtet die Problematik der "sprachlichen Heimat" und die Suche nach einem Ort der Zugehörigkeit. Außerdem wird die Frage nach der Rolle der Sprache(n) in der Erinnerung und der Darstellung der Familiengeschichte aufgeworfen.
- Vielleicht Esther als postmonolinguales Zeugnis: Dieses Kapitel analysiert die Mehrsprachigkeit des Romans "Vielleicht Esther" und erklärt, wie die Autorin verschiedene Sprachen einsetzt, um die Komplexität ihrer Familiengeschichte und die Erfahrungen des Nationalsozialismus widerzuspiegeln. Es wird erläutert, warum Petrowskaja sich bewusst für das Deutsche als Sprache ihres Romans entschieden hat, trotz der Geschichte dieser Sprache als Sprache der Täter*innen des Nationalsozialismus.
- Mehrsprachigkeit und Deterritorialisierung: In diesem Kapitel wird das Konzept der Mehrsprachigkeit im Kontext des Romans "Vielleicht Esther" weiter beleuchtet. Es wird diskutiert, wie die Autorin verschiedene Sprachen integriert, um ihre Familiengeschichte zu dekonstruieren und eine postmonolinguale Perspektive einzunehmen. Der Abschnitt beleuchtet auch die Bedeutung des "sprachlichen Zwischenraums" als Ort der Desintegration und der Deterritorialisierung.
- Aus dem Russischen: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Russischen als Sprache der Erzählerin und analysiert, warum sie sich gegen diese Sprache als Sprache ihrer Literatur entscheidet. Es wird erläutert, dass Russisch für Petrowskaja nicht nur die Sprache ihrer Sozialisation ist, sondern auch die Sprache der Sowjetunion, eine Sprache, die andere Sprachen verdrängt und eine imperiale Prägung hat.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit den Themen Mehrsprachigkeit, Deterritorialisierung, Sprachlosigkeit, Erinnerung, Familiengeschichte, Nationalsozialismus, Russisch, Deutsch, Jiddisch, "sprachlicher Zwischenraum" und postmonolinguale Gesellschaft.
- Quote paper
- Thies J. Hansberg (Author), 2022, Zwischen Mehrsprachigkeit und Sprachlosigkeit. Deterritorialisierung in Katja Petrowskajas "Vielleicht Esther", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1337211