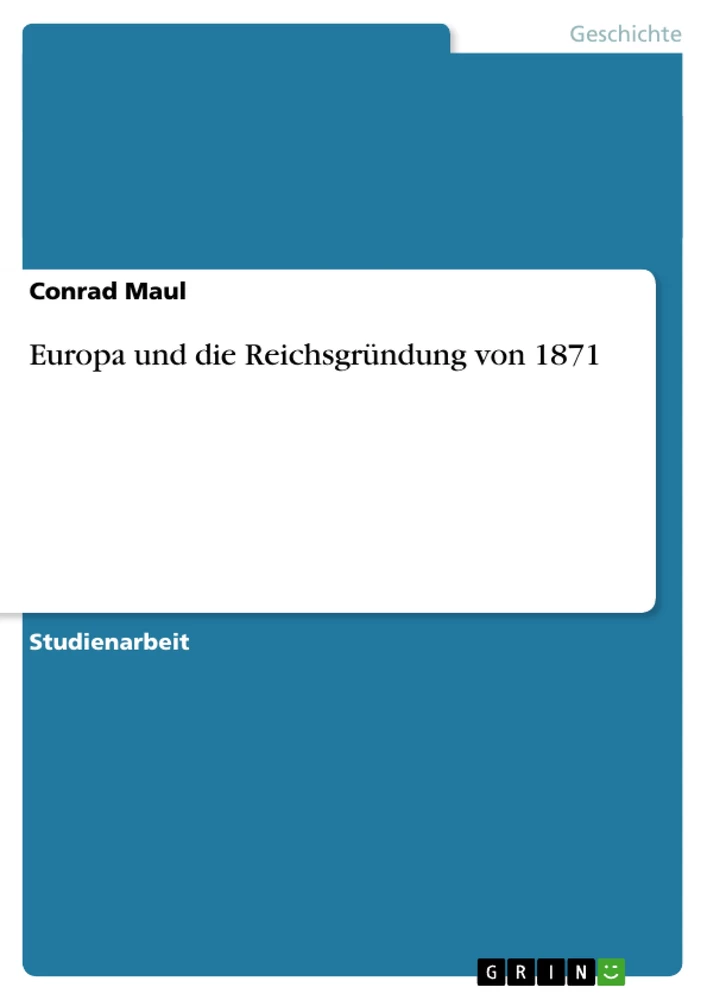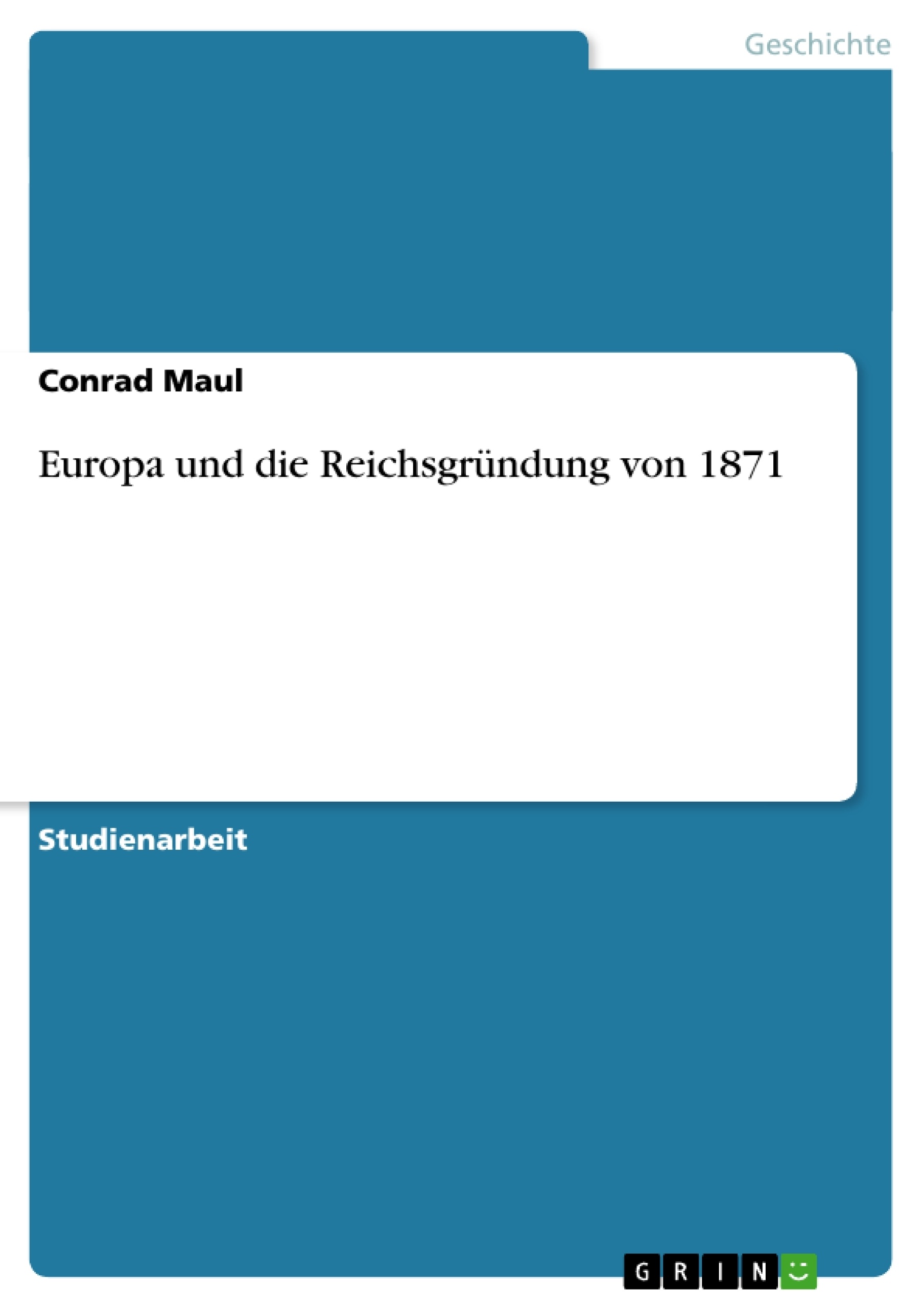Mit der Reichsgründung vom 18. Januar 1871 wird die deutsche Einheitsbestrebung im Rahmen der kleindeutschen Lösung vollendet. Jenes Ereignis stellt ohne Zweifel eine Zäsur in der deutschen Geschichte dar. Grund genug zu fragen, wie der Rest Europas die Reichsgründung wahrnimmt? So rücken die Urteile, die die anderen über Deutschland fällen, in den Mittelpunkt dieser Betrachtung. Das Urteil Deutschlands über sich selbst oder über andere wird dementsprechend ausgeblendet. Weiterhin sollen weder der preußisch-österreichische Krieg, noch der deutsch-französische Krieg genauer untersucht werden. Höchstens die Ursachen und Folgen jener Kriege können Eingang in diese Arbeit finden. Zudem muss auf eine konkrete Darstellung der Politik Bismarcks und dessen Absichten verzichtet werden. Im Gegensatz zur thematischen Abgrenzung erscheint die chronologische Begrenzung schwieriger, da Ausnahmen die Regel bilden. Jedoch soll der Zeitraum nach 1866 bis 1871 grundsätzlich beleuchtet werden. In bibliographischer Hinsicht fällt sofort auf, dass die überwiegende Literatur veraltet ist. Mit der Aufgabe, die Reichsgründung aus europäischer Perspektive zu betrachten, erscheint es ratsam, die einzelnen Großmächte in der Reihenfolge Frankreich, Österreich-Ungarn, Russland und Großbritannien zu untersuchen. Im Fazit sollen dann die einzelnen Ergebnisse in aller Klarheit wiedergegeben werden. Abschließend soll ein Exkurs unternommen werden, der das Verhältnis von Nationalstaatlichkeit und europäischen Gleichgewicht z. Z. des deutschen Einigungsprozesses aufzeigt. Was die nicht-deutschen Europäer über die Reichsgründung 1871 denken, bleibt abzuwarten. Angefangen mit dem Staat Frankreich, der von der deutschen Einigung am meisten betroffen ist, soll nun die gestellte Frage auf langsamen Weg beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Frankreich
- Österreich-Ungarn
- Russland
- Großbritannien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wahrnehmung der Reichsgründung von 1871 aus der Perspektive der europäischen Großmächte. Sie konzentriert sich auf die Zeit nach 1866 bis 1871 und analysiert die Reaktionen Frankreichs, Österreich-Ungarns, Russlands und Großbritanniens auf den deutschen Einigungsprozess. Der preußisch-österreichische und der deutsch-französische Krieg werden nur im Hinblick auf ihre Ursachen und Folgen betrachtet. Bismarcks Politik und dessen Absichten werden nicht im Detail untersucht.
- Die Vielschichtigkeit der französischen Reaktion auf die deutsche Einigung
- Die Rolle des Nationalitätsprinzips und des europäischen Gleichgewichts in der europäischen Außenpolitik
- Die Bedeutung des preußisch-österreichischen Krieges für die Wahrnehmung der deutschen Einigung
- Die unterschiedlichen Positionen innerhalb Frankreichs zur deutschen Einigung
- Das Verhältnis von Nationalstaatlichkeit und europäischem Gleichgewicht während des deutschen Einigungsprozesses
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung erläutert die Zielsetzung der Arbeit, welche die Wahrnehmung der deutschen Reichsgründung von 1871 durch die europäischen Großmächte untersucht. Sie grenzt den Untersuchungszeitraum (nach 1866 bis 1871) und den Fokus der Analyse ab (Reaktionen der europäischen Mächte, ohne detaillierte Betrachtung des preußisch-österreichischen und deutsch-französischen Krieges oder Bismarcks Politik). Die Arbeit wählt eine chronologische Struktur und konzentriert sich auf Frankreich, Österreich-Ungarn, Russland und Großbritannien. Die methodische Herausforderung besteht in der Veralterung der verfügbaren Literatur und der Schwierigkeit, eine einheitliche Meinung in den untersuchten Ländern darzustellen.
Frankreich: Dieses Kapitel analysiert die divergierenden französischen Reaktionen auf den deutschen Einigungsprozess. Es zeigt die Widersprüchlichkeit der französischen Außenpolitik unter Napoleon III., der einerseits das Nationalitätsprinzip für Deutschland akzeptierte, andererseits eine Status-quo-Politik verfolgte. Die Arbeit unterscheidet zwischen liberalen/demokratischen/radikalen Positionen, die das Nationalitätsprinzip befürworteten, und einer traditionell-realistischen Haltung, die ein geteiltes Deutschland bevorzugte. Die anfänglichen Sympathien für die deutsche Einigung wichen nach dem preußisch-österreichischen Krieg einer negativen Bewertung, verstärkt durch Bismarcks Politik und die preußischen Gebietsansprüche. Die „Politik der Trinkgelder“ Napoleons III. – der Versuch, durch Kompensationen den französischen Einfluss zu sichern – scheiterte. Diese widersprüchliche Politik Napoleons trug maßgeblich zum Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges bei.
Schlüsselwörter
Reichsgründung 1871, deutsche Einigung, europäische Großmächte, Frankreich, Österreich-Ungarn, Russland, Großbritannien, Nationalitätsprinzip, europäisches Gleichgewicht, Bismarck, Napoleon III., öffentliche Meinung, Außenpolitik.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: "Wahrnehmung der Reichsgründung 1871 durch die europäischen Großmächte"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Reaktionen der europäischen Großmächte Frankreich, Österreich-Ungarn, Russland und Großbritannien auf die deutsche Reichsgründung von 1871. Der Fokus liegt auf der Zeit nach 1866 bis 1871 und analysiert die unterschiedlichen Perspektiven und Positionen der genannten Länder.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Vielschichtigkeit der französischen Reaktion, die Rolle des Nationalitätsprinzips und des europäischen Gleichgewichts in der europäischen Außenpolitik, die Bedeutung des preußisch-österreichischen Krieges für die Wahrnehmung der deutschen Einigung, die unterschiedlichen Positionen innerhalb Frankreichs zur Einigung und das Verhältnis von Nationalstaatlichkeit und europäischem Gleichgewicht während des Einigungsprozesses. Bismarcks Politik wird nur marginal betrachtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Frankreich, Österreich-Ungarn, Russland und Großbritannien sowie ein Fazit. Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung und Methodik. Die einzelnen Länderkapitel analysieren die jeweilige Reaktion auf die deutsche Einigung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit folgt einer chronologischen Struktur und konzentriert sich auf die Reaktionen der vier genannten Großmächte. Sie berücksichtigt die unterschiedlichen Positionen innerhalb der einzelnen Länder (z.B. liberale vs. konservative Positionen in Frankreich).
Welche methodischen Herausforderungen gab es?
Die Arbeit erwähnt die Schwierigkeit, aufgrund der Veralterung der verfügbaren Literatur und der Divergenz der Meinungen in den untersuchten Ländern, eine einheitliche Meinung in den untersuchten Ländern darzustellen.
Welche Rolle spielt der Deutsch-Französische Krieg in der Arbeit?
Der Deutsch-Französische Krieg wird nur im Hinblick auf seine Ursachen und Folgen in Bezug auf die Reaktionen der Großmächte betrachtet, nicht aber detailliert analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind Reichsgründung 1871, deutsche Einigung, europäische Großmächte, Frankreich, Österreich-Ungarn, Russland, Großbritannien, Nationalitätsprinzip, europäisches Gleichgewicht, Bismarck, Napoleon III., öffentliche Meinung, Außenpolitik.
Was ist die zentrale These oder Aussage der Arbeit?
Die zentrale These lässt sich nicht direkt aus dem gegebenen Text extrahieren, aber der Text deutet darauf hin, dass die Arbeit die unterschiedlichen und teils widersprüchlichen Reaktionen der europäischen Großmächte auf den Prozess der deutschen Einigung untersuchen und analysieren wird.
- Quote paper
- Conrad Maul (Author), 2007, Europa und die Reichsgründung von 1871, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133672