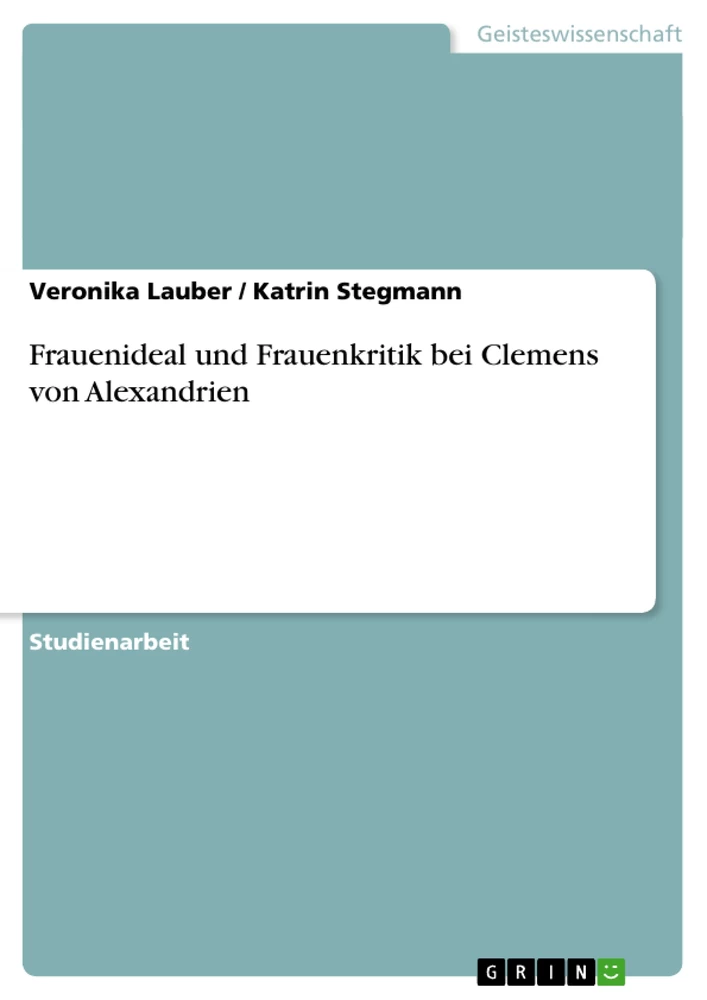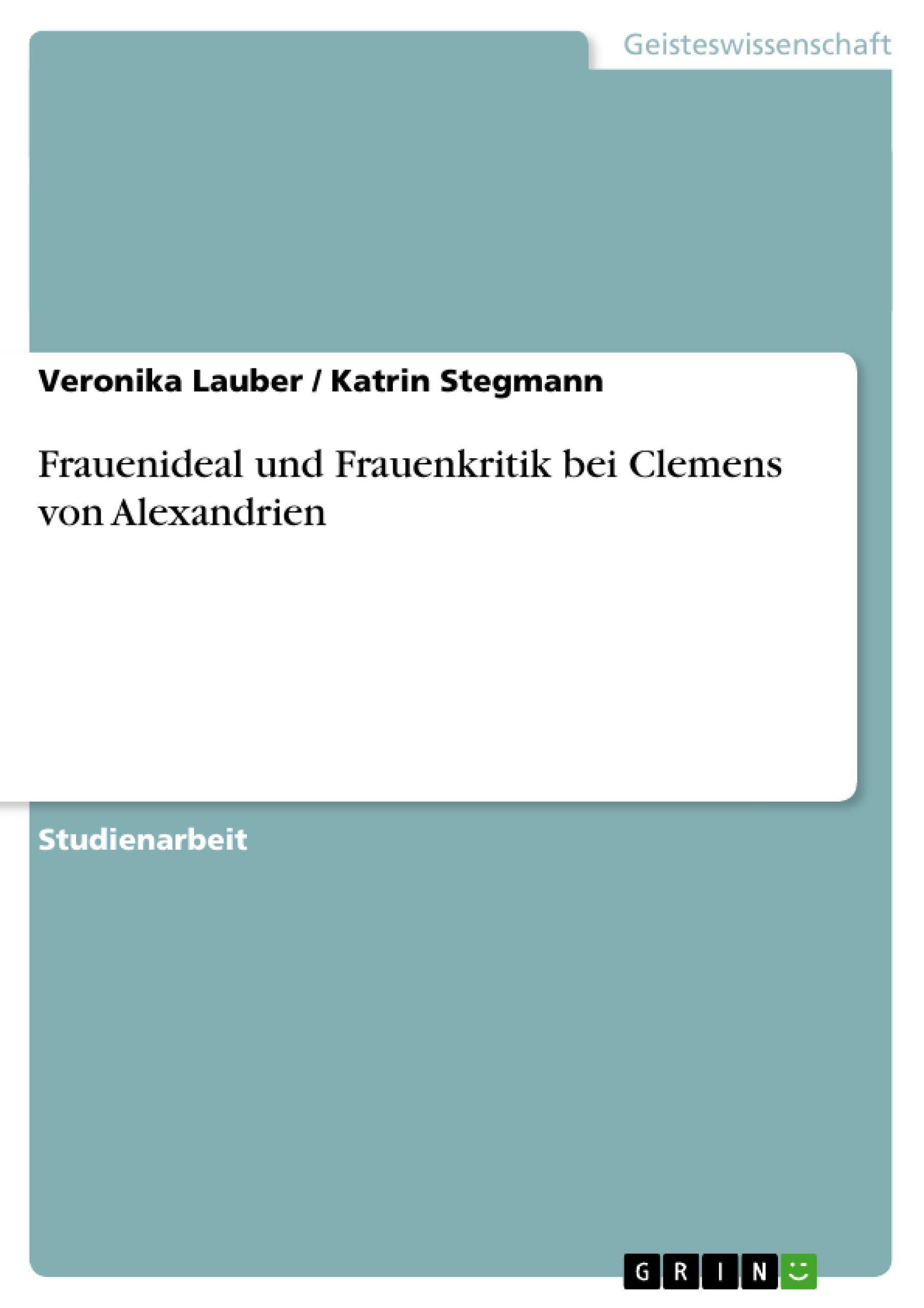Mann – Frau, Stärke – Schwäche, Selbständigkeit – Abhängigkeit; – dieser Konflikt der Geschlechter begleitet die gesamte Menschheitsgeschichte schon seit jeher, seit Adam und Eva, bis hin in die heutige, in die aktuelle Gegenwart. Nicht zu leugnen ist allerdings die enorme Entwicklung, die sich seitdem vollzogen hat, die – beinahe – Gleichstellung, die wir in der heutigen Zeit erfahren. Dass dies nicht immer der Fall war, wurde uns in diesem Seminar mehr als einmal vor Augen geführt. Die Frau als Dienerin, als schamvoll Untergebene des Ehemannes begleitete uns Stunde für Stunde.
Mit dieser „Geschichte des Versagens und Scheiterns in der Beziehung zwischen den Geschlechtern“ im Hinterkopf wollen wir nun den Blick richten auf Clemens von Alexandrien, der im Zwiespalt zwischen diesen Vorstellungen seiner Zeit und dem vergleichsweise fortschrittlichen Gedankengut der stoischen Philosophen versuchte, einen Weg für die Kirche in Sicht auf Frauen zu finden. Auch wenn dieser Weg voll Widersprüchlichkeiten ist, hat er doch Hoffnung auf Gleichberechtigung gestreut und somit einen großen Schritt in die „richtige“ Richtung gewagt.
Mit ausgewählten Texten aus seiner Feder möchten wir nun in der folgenden Arbeit versuchen, diese seine Sicht zu veranschaulichen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 3 gemeinsame Bearbeitung
2. Clemens von Alexandrien
2.1 Leben 4 V. Lauber
2.2 Hauptwerke
3. Kerngedanken
4. Frauenideal
5. Frauenkritik
6. Widersprüchlichkeiten 13 K. Stegmann
7. Fazit
8 Literaturverzeichnis 17 gemeinsame Bearbeitung
1. Einleitung
Mann – Frau, Stärke – Schwäche, Selbständigkeit – Abhängigkeit; – dieser Konflikt der Geschlechter begleitet die gesamte Menschheitsgeschichte schon seit jeher, seit Adam und Eva, bis hin in die heutige, in die aktuelle Gegenwart. Nicht zu leugnen ist allerdings die enorme Entwicklung, die sich seitdem vollzogen hat, die – beinahe – Gleichstellung, die wir in der heutigen Zeit erfahren. Dass dies nicht immer der Fall war, wurde uns in diesem Seminar mehr als einmal vor Augen geführt. Die Frau als Dienerin, als schamvoll Untergebene des Ehemannes begleitete uns Stunde für Stunde.
Mit dieser „Geschichte des Versagens und Scheiterns in der Beziehung zwischen den Geschlechtern“[1] im Hinterkopf wollen wir nun den Blick richten auf Clemens von Alexandrien, der im Zwiespalt zwischen diesen Vorstellungen seiner Zeit und dem vergleichsweise fortschrittlichen Gedankengut der stoischen Philosophen versuchte, einen Weg für die Kirche in Sicht auf Frauen zu finden. Auch wenn dieser Weg voll Widersprüchlichkeiten ist, hat er doch Hoffnung auf Gleichberechtigung gestreut und somit einen großen Schritt in die „richtige“ Richtung gewagt.
Mit ausgewählten Texten aus seiner Feder möchten wir nun in der folgenden Arbeit versuchen, diese seine Sicht zu veranschaulichen.
2. Clemens von Alexandrien
Um den Nährboden zu verstehen, auf den dieses Gedankengut gefallen ist und Frucht getragen hat, ist es notwendig, die biographischen Umstände und Einflüsse, die sein Leben entscheidend geprägt haben, kurz zu umreißen.
2.1 Leben
Da sich das Leben des Clemens von Alexandrien nur bruchstückhaft rekonstruieren lässt und die Angaben in der Literatur auch nicht immer hundertprozentig übereinstimmen, ist es nur möglich, sich einen kurzen Überblick zu verschaffen:
Clemens von Alexandrien, eigentlich Titus Flavius Clemens, wurde als Heide zwischen 140 und 150 n. Chr. wahrscheinlich in Athen geboren. Er ging durch die Schule der Philosophen und als er schließlich zum Christentum fand, reiste er von Athen aus in verschiedenste Länder um nach geeigneten christlichen Lehrern zu suchen u.a. in Griechenland, Ägypten und Unteritalien.
Um 175 ließ er sich bei Pantaenus in Alexandrien nieder und unterrichtete dort als Lehrer in dessen Katechetenschule.[2]
Der Gründer und erste bekannte Lehrer und Leiter der Katechetenschule von Alexandria war Pantaenus, ein stoisch vorgebildeter Missionar, nach dessen Tod um 200 n.Chr. Clemens die Leitung der Schule übernahm und sie entscheidend prägte.
Die Christenverfolgung um 202 zwang Clemens wohl zur Flucht aus Alexandria; mit hoher Wahrscheinlichkeit war er danach in Jerusalem tätig und starb dort zwischen 211 und 215.[3]
2.2 Hauptwerke
„Da er aber bestrebt ist, uns in heilsamem, stufenweisem Fortschreiten zur Vollkommenheit zu führen, verwendet der in jeder Hinsicht liebreiche Logos die vortreffliche und für eine wirksame Ausbildung zweckmäßige Erziehungsweise, indem er zuerst ermahnt, dann erzieht und zuletzt lehrt.“[4]
Entlang dieses seines Erziehungsplans (ermahnen – erziehen – lehren) kann man die drei Hauptwerke des Clemens von Alexandrien zeichnen:
In seiner „Protreptikós prós héllēnas“, der „Mahnrede an die Griechen“ versucht er, den Heiden die „Unzulänglichkeit ihrer seitherigen Religion, Philosophie und Lebensweise“[5] aufzuzeigen und sie für das Christentum zu werben.
Sein „Paidagogos“, der „Erzieher“, soll sowohl schon getauften Christen als auch Katechumenen praktische Anweisungen geben hinsichtlich der christlichen Lebensweise bis hin zu Fragen des Essens, Schlafens und Kleidens. Bei diesen Texten fiel sowohl uns als auch den Teilnehmern des Seminars zunehmend auf, wie konkret, lebensnah und für jedermann verständlich der Schreibstil gehalten ist.
Anspruchsvoller in der Ausdrucksweise gestaltet sich dagegen das dritte Hauptwerk des Clemens von Alexandria, die sogenannten „Stromateis“, die „Teppiche“. Der Name ergibt sich aus der nicht sonderlich systematischen, sondern bunt durcheinander gewürfelten Reihenfolge der großen Vielfalt an grundsätzlich theologischen, ethischen und hermeneutischen Schriften über die christliche Weltanschauung als wahre Erkenntnis, adressiert an bereits getaufte Christen.
Für die Betrachtung der Sicht auf Frauenideal und Frauenkritik des Clemens von Alexandrien sind vor allem der Paidagogos und die Stromateis von größerer Bedeutung.
3. Kerngedanken
Clemens brachte in seinen Werken erstmals die klassische antike Bildung mit in die entstehende christliche Theologie ein. Er versuchte damit, Wissenschaft und Religion in Einklang zu bringen, da er es als die Aufgabe eines wahren Christen betrachtete, sich das Christentum denkend anzueignen. Zwar nahm er das Wort Gottes dabei als höchste Richtschnur, jedoch bedarf es seiner Ansicht nach der Philosophie, um von dem bloßen Autoritätsglauben zu höherer Erkenntnis zu gelangen.
[...]
[1] Heine, S., S. 20
[2] Kathechetenschulen waren die frühesten theologischen Bildungsstätten. Sie waren nach dem Muster der heidnischen Philosophenschulen eingerichtet und beinhalteten Unterricht in allen Gebieten der Theologie, Rhetorik, klassischer Literatur und Philosophie.
[3] Neymeyr, U., S. 45 ff.
[4] Paidagogos I.3.3
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist ein Auszug aus einem akademischen Text über Clemens von Alexandrien. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung und die ersten Abschnitte, die das Leben, die Hauptwerke und Kerngedanken von Clemens von Alexandrien beschreiben, sowie einige Hintergrundinformationen zu seinem Einfluss und Kontext.
Was beinhaltet das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Punkte: 1. Einleitung, 2. Clemens von Alexandrien (Leben und Hauptwerke), 3. Kerngedanken, 4. Frauenideal, 5. Frauenkritik, 6. Widersprüchlichkeiten, 7. Fazit, und 8. Literaturverzeichnis.
Wer war Clemens von Alexandrien?
Clemens von Alexandrien (Titus Flavius Clemens) war ein christlicher Gelehrter und Theologe, der zwischen 140 und 150 n. Chr. geboren wurde. Er war Leiter der Katechetenschule in Alexandria und versuchte, klassische Bildung und christliche Theologie in Einklang zu bringen.
Was sind seine Hauptwerke?
Seine Hauptwerke sind: "Protreptikós prós héllēnas" (Mahnrede an die Griechen), "Paidagogos" (Erzieher) und "Stromateis" (Teppiche).
Was ist die Bedeutung der Katechetenschule von Alexandria?
Die Katechetenschule von Alexandria war eine der frühesten theologischen Bildungsstätten, die nach dem Vorbild heidnischer Philosophenschulen eingerichtet war. Sie bot Unterricht in Theologie, Rhetorik, klassischer Literatur und Philosophie.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Die zentralen Themen der Arbeit sind Clemens von Alexandriens Leben, seine Hauptwerke, seine Kerngedanken sowie seine Sicht auf Frauenideal und Frauenkritik.
Was sind die "Stromateis"?
Die "Stromateis" (Teppiche) sind das dritte Hauptwerk von Clemens von Alexandrien. Es handelt sich um eine Sammlung theologischer, ethischer und hermeneutischer Schriften über die christliche Weltanschauung.
Warum wird auf die "Geschichte des Versagens und Scheiterns in der Beziehung zwischen den Geschlechtern" hingewiesen?
Dies dient als Hintergrund, um den Kontext zu beleuchten, in dem Clemens von Alexandrien wirkte. Seine Arbeit wird als ein Versuch dargestellt, angesichts der traditionellen Unterordnung der Frau einen fortschrittlicheren Weg für die Kirche zu finden.
- Quote paper
- Veronika Lauber (Author), Katrin Stegmann (Author), 2009, Frauenideal und Frauenkritik bei Clemens von Alexandrien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133620