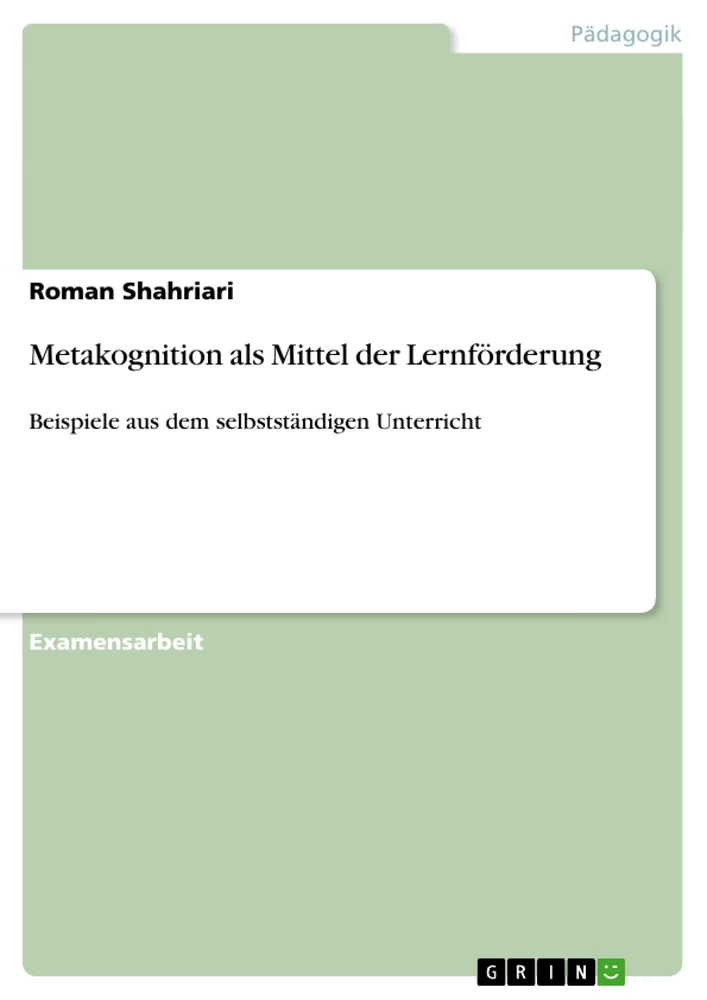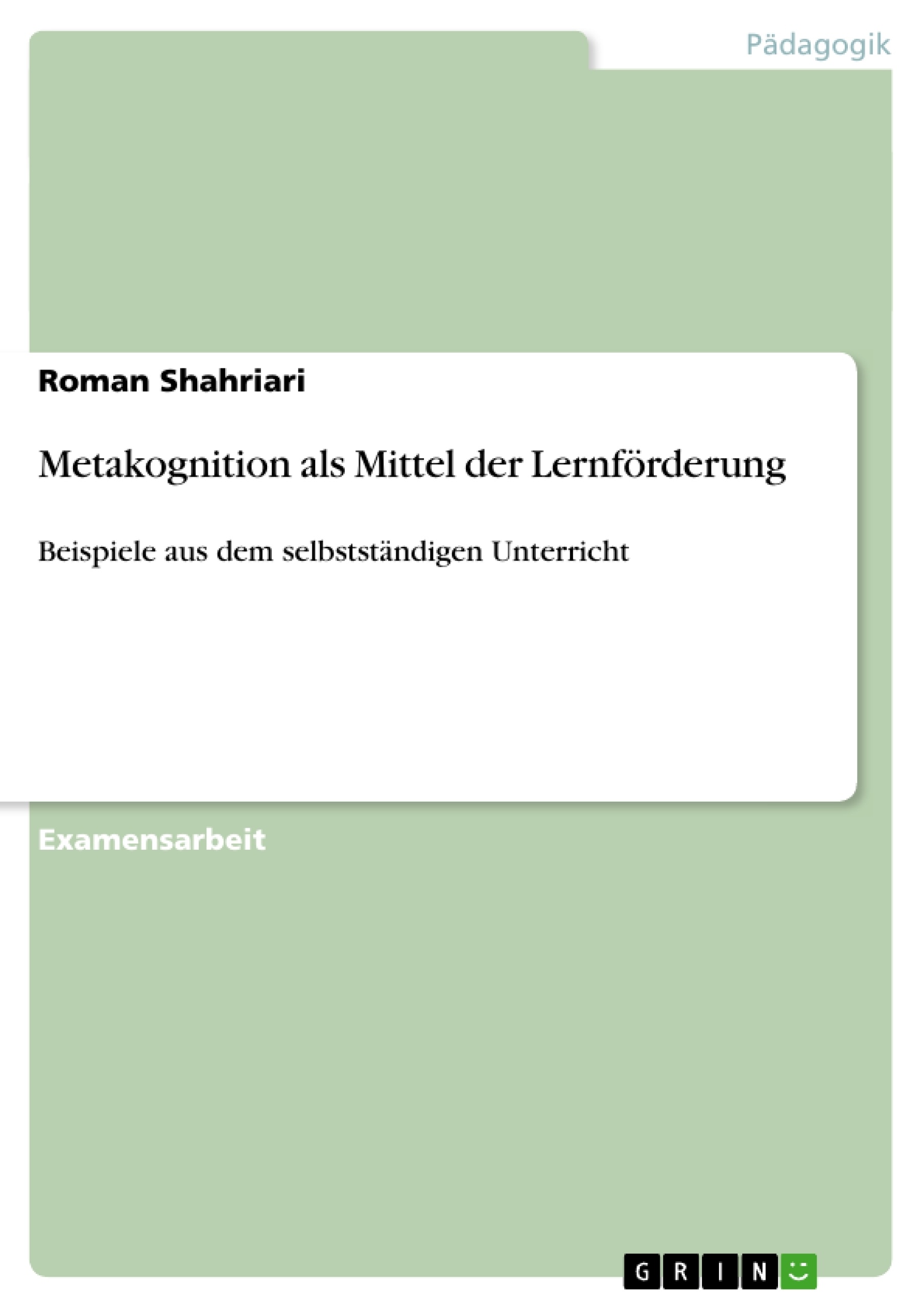Wie lernen Menschen? Wie lernen Kinder? Auf welche altersspezifischen Voraussetzungen und Bedingungen stoßen Pädagogen dabei? Wie können Lehrerinnen und Lehrer das Lernen ihrer Schülerinnen und Schüler bestmöglich fördern?
Die kontruktivistisch orientierte pädagogische Psychologie, die ihren Blick auf die kognitiven und emotionalen Strukturen beim Lernen richtet, hat sich in den letzten Jahren mit einer Schlüsselkompetenz beschäftigt, ohne die nachhaltige Lernprozesse nicht denkbar sind: Metakognition. Denn die bewusste Reflexion und Kontrolle des eigenen – idealerweise: selbstregulierten – Denk- und Lernprozesses ist eine wichtige Voraussetzung, um in einer Welt des lebenslangen Lernens erfolgreich zu sein.
Metakognitive Fähigkeiten sind besonders wichtig beim Lernen aus Texten; Metakognition ist z.B. dafür verantwortlich, ob und wie spezielle Lesestrategien eingesetzt werden.
Wie kann die Lehrkraft in der Schule diese Erkenntnisse der Forschung nutzen?
Neben einem ausführlichen theoretischen Teil (konstruktivistische Lerntheorien, selbstreguliertes Lernen, Lernstrategien, das Konzept Metakognition) bildet das Zentrum dieser zweiten Staatsexamensarbeit eine empirische Untersuchung in einer 7. Klasse eines Berliner Gymnasiums. In den Fächern Geschichte und Sozialkunde wurde hier über einen Zeitraum von acht Wochen versucht, Lesekompetenz mittels Metakognition zu fördern. Die Untersuchungsergebnisse werden global (gesamte Klasse) und mikroskopisch (drei Lerner) vorgestellt, analysiert und reflektiert. Ein umfangreiches aktuelles Literaturverzeichnis schließt die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Statt einer Einleitung: Zwei Beobachtungen aus dem Unterricht
- I. Theoretischer Teil
- 1. Lebenslanges Lernen – eine Forderung der Gegenwart
- 2. Der Lernbegriff in der Pädagogischen Psychologie
- 3. Konsequenzen (I): Konstruktivistische Lerntheorien in Allgemeinen Didaktiken
- 4. Konsequenzen (II): Selbstreguliertes Lernen und Lernstrategien
- 4.1 Selbstreguliertes Lernen
- 4.2 Lernstrategien
- 5. Das Konzept Metakognition
- 5.1 Der Metakognitionsbegriff
- 5.2 Metakognitives Wissen - die erste Komponente der Metakognition (Flavell)
- 5.3 Metakognitive Kontrolle – die zweite Komponente der Metakognition (Brown)
- 5.4 Eine Weiterentwicklung - Das Metakognitionsmodell von Pintrich et al. (2000)
- 6. Metakognition als Mittel der Lernförderung (I) – Ergebnisse der Forschung
- 6.1 Verbessert Metakognition die Lernleistung?
- 6.2 Wie verbessert Metakognition die Lernleistung?
- 6.3 Wann verbessert Metakognition die Lernleistung?
- 6.4 Ontogenetische Bedingungen der Metakognition
- 6.4.1 Präadoleszente Lerner und die Verfestigung des Leistungsmotivs
- 6.4.2 Adoleszente Lerner - meist nicht am Ende ihrer metakognitiven Grenzen
- II. Praktischer Teil
- 1. Metakognition als Mittel der Lernförderung (II) – Eine Untersuchung
- 1.1 Hypothesen
- 1.2 Untersuchungsdesign
- 1.2.1 Der Metakognitionsfragebogen
- 1.2.2 Das Lerntagebuch
- 1.3 Indikatoren der Lernförderung: Lesekompetenz
- 1.4 Untersuchungstexte
- 1.5 Geschichtstest
- 1.6 Vorbereitung der Lerngruppen
- 2. Die Ausgangslage: Wissen über Strategien und metakognitives Niveau
- 3. Begleitende Maßnahmen im Unterricht: Strategie- & Metakognitionsübungen
- 4. Untersuchungsergebnisse: Analyse einzelner Lernerinnen und Lerner
- 5. Überprüfung der Hypothesen
- 6. Reflexion der Untersuchung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Metakognition in der Lernförderung. Ziel ist es, die Wirksamkeit metakognitiver Strategien im Unterricht zu belegen und deren Anwendung im Kontext selbstständigen Lernens zu evaluieren. Die Studie analysiert die Lernerfahrungen von Schülerinnen und Schülern, um die Auswirkungen auf ihre Lernleistung und ihr Selbstkonzept zu ermitteln.
- Lebenslanges Lernen und seine Bedeutung in der heutigen Wissensgesellschaft
- Konstruktivistische Lerntheorien und selbstreguliertes Lernen
- Das Konzept der Metakognition und deren Komponenten
- Empirische Untersuchung zum Einfluss metakognitiver Strategien auf die Lernleistung
- Analyse individueller Lernerfahrungen und deren Auswirkungen auf das Selbstkonzept
Zusammenfassung der Kapitel
Statt einer Einleitung: Zwei Beobachtungen aus dem Unterricht: Diese Einleitung präsentiert zwei Fallstudien – Jiahan und Carlo – die unterschiedliche Lernstrategien und metakognitive Fähigkeiten aufweisen. Jiahan demonstriert effektives, strategisches Lernen und metakognitive Kontrolle, während Carlo Schwierigkeiten mit Konzentration und Selbstregulation zeigt. Der Kontrast verdeutlicht die Bedeutung metakognitiver Fähigkeiten für Lernerfolg und Selbstkonzept und motiviert die Forschungsarbeit.
I. Theoretischer Teil: Dieser Teil dient der theoretischen Fundierung der Arbeit. Er behandelt Konzepte wie lebenslanges Lernen im Kontext der Wissensgesellschaft, konstruktivistische Lerntheorien, selbstreguliertes Lernen und Lernstrategien. Besonders detailliert wird das Konzept der Metakognition mit ihren Komponenten (metakognitives Wissen und metakognitive Kontrolle) und verschiedenen Modellen (z.B. Pintrich et al.) vorgestellt. Der Abschnitt legt die theoretischen Grundlagen für die empirische Untersuchung im zweiten Teil dar, indem er die Bedeutung der Metakognition für erfolgreiche Lernprozesse hervorhebt.
II. Praktischer Teil: Dieser Teil beschreibt die empirische Untersuchung zur Förderung des Lernens mittels Metakognition. Die Methodik, Hypothesen, das Untersuchungsdesign (einschliesslich des Metakognitionsfragebogens und des Lerntagebuchs), die verwendeten Texte und der Geschichtstest werden detailliert erläutert. Es folgt die Analyse der Ausgangslage, die Beschreibung der im Unterricht eingesetzten Strategien und Metakognitionsübungen, sowie die Auswertung der Untersuchungsergebnisse an einzelnen Beispielen. Dieser Teil integriert die Ergebnisse der Untersuchung, um die Wirksamkeit der metakognitiven Interventionen zu belegen.
Schlüsselwörter
Metakognition, Lernförderung, Selbstreguliertes Lernen, Lernstrategien, Konstruktivismus, Wissensgesellschaft, Lebenslanges Lernen, Empirische Untersuchung, Selbstkonzept, Lernleistung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Metakognition und Lernförderung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Metakognition bei der Lernförderung. Sie analysiert die Wirksamkeit metakognitiver Strategien im Unterricht und deren Einfluss auf die Lernleistung und das Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern.
Welche Themen werden im theoretischen Teil behandelt?
Der theoretische Teil behandelt Konzepte wie lebenslanges Lernen, konstruktivistische Lerntheorien, selbstreguliertes Lernen, Lernstrategien und detailliert das Konzept der Metakognition mit ihren Komponenten (metakognitives Wissen und metakognitive Kontrolle) und verschiedenen Modellen (z.B. Pintrich et al.).
Welche Methoden wurden im praktischen Teil angewendet?
Der praktische Teil beschreibt eine empirische Untersuchung. Es werden die Methodik, Hypothesen, das Untersuchungsdesign (mit Metakognitionsfragebogen und Lerntagebuch), die verwendeten Texte und der Geschichtstest detailliert erläutert. Die Analyse umfasst die Ausgangslage, die im Unterricht eingesetzten Strategien und Metakognitionsübungen sowie die Auswertung der Ergebnisse an Einzelbeispielen.
Welche konkreten Forschungsfragen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht, ob und wie metakognitive Strategien die Lernleistung verbessern und welche Rolle individuelle Faktoren wie Alter und Motivation spielen. Sie analysiert die Lernerfahrungen von Schülern und deren Auswirkungen auf ihr Selbstkonzept.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die konkreten Untersuchungsergebnisse werden im HTML-Dokument detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf der Analyse einzelner Lerner und der Überprüfung der aufgestellten Hypothesen. Die Ergebnisse zeigen die Wirksamkeit metakognitiver Interventionen auf die Lernleistung auf.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in einen theoretischen und einen praktischen Teil gegliedert. Der theoretische Teil behandelt die Grundlagen der Metakognition und des Lernens. Der praktische Teil beschreibt eine empirische Untersuchung zur Wirksamkeit metakognitiver Strategien. Zusätzlich beinhaltet sie eine Einleitung mit Fallbeispielen, eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste der Schlüsselbegriffe.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Metakognition, Lernförderung, Selbstreguliertes Lernen, Lernstrategien, Konstruktivismus, Wissensgesellschaft, Lebenslanges Lernen, Empirische Untersuchung, Selbstkonzept und Lernleistung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Pädagogen, Lehramtsstudierende, Lernforscher und alle, die sich mit Lernprozessen und Lernförderung auseinandersetzen.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text mit detaillierten Ergebnissen und der vollständigen Methodik ist im HTML-Dokument enthalten, welches die Kapitelübersichten, das Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und die Zusammenfassung der Kapitel beinhaltet.
- Quote paper
- Roman Shahriari (Author), 2007, Metakognition als Mittel der Lernförderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133504