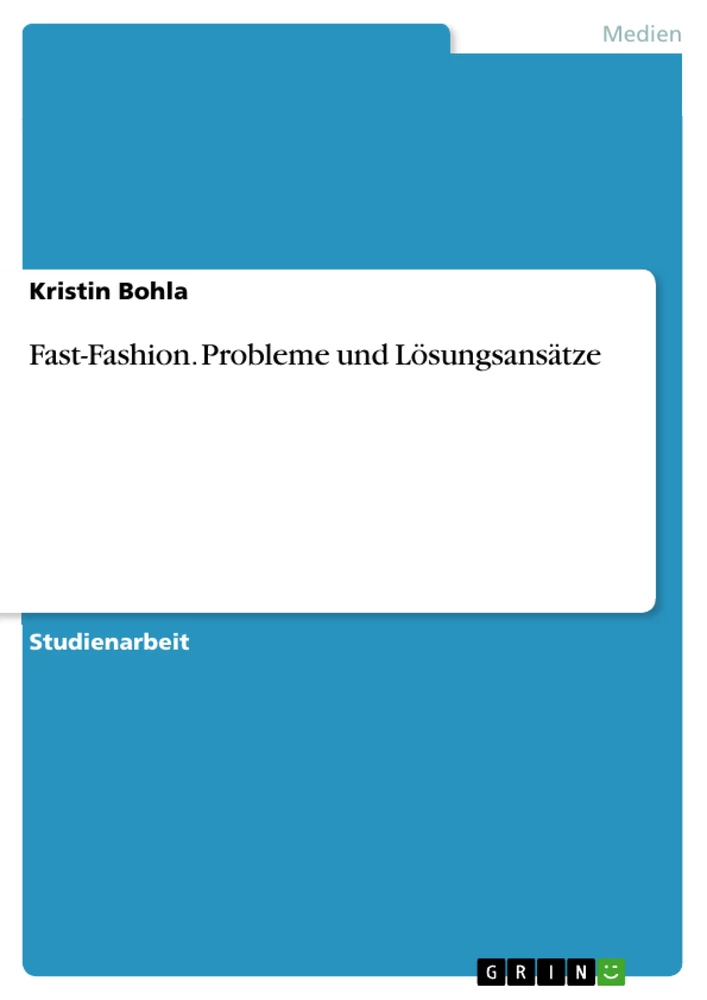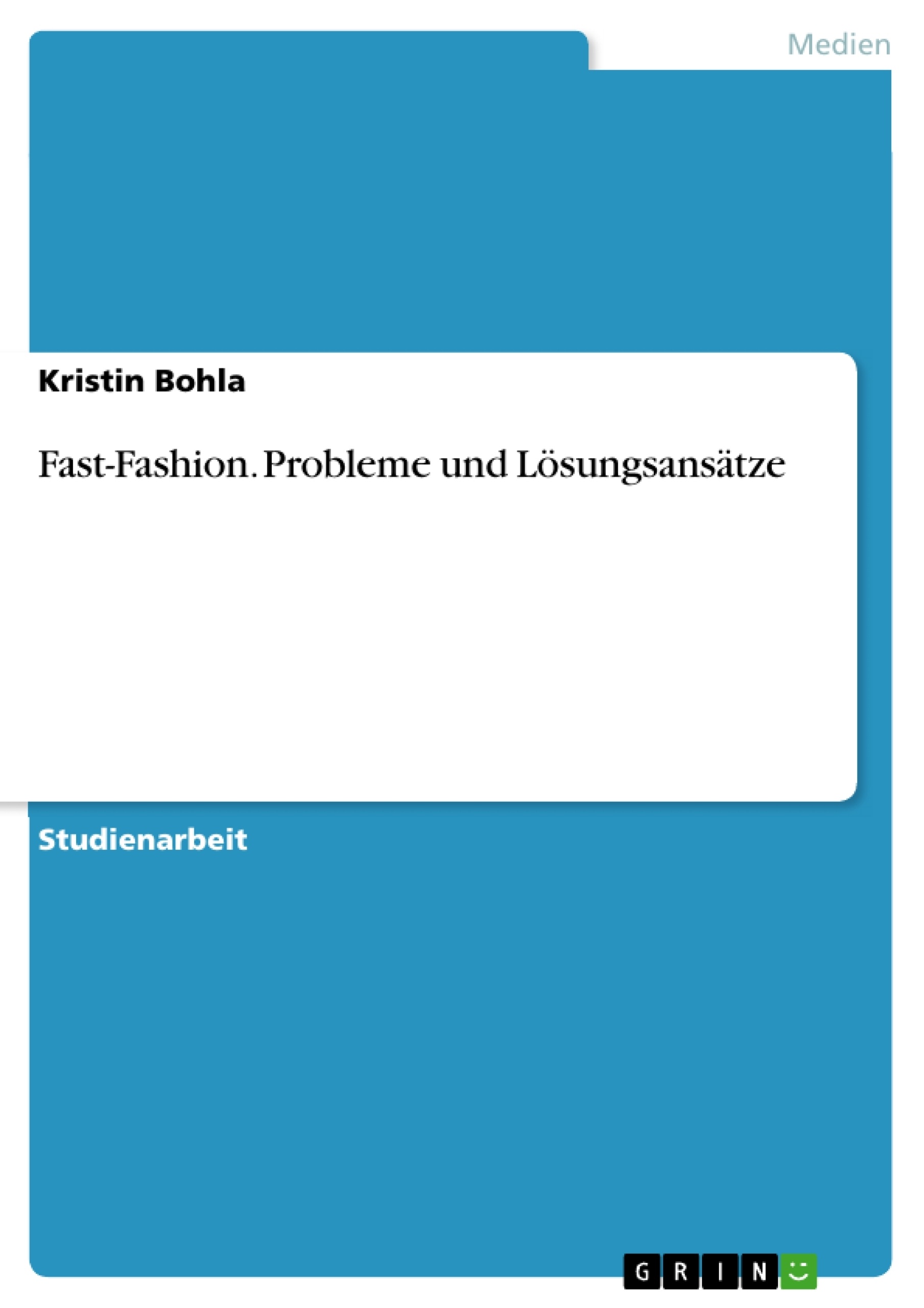Das Ziel dieser Seminararbeit ist es, den Problemen der Fast Fashion Industrie auf den Grund zu gehen, aber auch gleichzeitig nach Lösungsansätzen und Alternativen zu suchen. Es wird zum einen die Produktion in den Herstellungsländern angeschaut, wobei hauptsächlich auf Bangladesch Bezug genommen wird. Neben den Auswirkungen auf den Menschen und die Umwelt wird dann noch der spannende Vergleich von billigen und teuren Markenklamotten in der Herstellung betrachtet. Danach geht es zurück nach Deutschland, wo der Kauf und Konsum näher beleuchtet sowie die Gründe und ebenso die Auswirkungen untersucht werden. Am Ende wird dann nach Alternativen zur Fast Fashion Industrie gesucht und gute Siegel vorgestellt.
Kleider machen Leute, diesen Spruch kennt sicher jeder. Aber was macht Kleidung mit den Leuten? Was macht sie mit denen, die sie herstellen und mit denen, die sie tragen? Immer wieder wird in den Medien von den Zuständen bei der Herstellung unserer Kleidung in den Entwicklungsländern berichtet. Dokumentationen wie der Markencheck auf ARD über die Modeketten H&M, Kik und C&A schauten hinter die Kulissen. Greenpeace versucht immer und immer wieder durch Kampagnen und Werbung die Zustände in den Vordergrund zu rücken. Für viel Aufsehen hat 2013 der Einsturz des Rana–Plazas-Gebäudes gesorgt, einer Textilfabrik in Bangladesch, wobei über 1000 Menschen gestorben sind. Doch diese Aufmerksamkeit ist nur von kurzer Dauer und gerät leicht in Vergessenheit. Stattdessen wird immer mehr und immer billiger produziert, immer mehr Werbung gemacht und der Verbraucher wird dazu angeregt, massenhaft neue Kleidung zu konsumieren. Dieses Phänomen wird Fast-Fashion Industrie genannt. Sie hat umfangreiche und negative Auswirkungen auf die Umwelt und auf den Menschen und genau deshalb ist dieses Thema wichtig.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fast-Fashion
- Definition
- Konsumverhalten - Daten und Fakten
- Produktion in den Herstellungsländern
- Auswirkungen auf den Menschen - Bangladesch
- Auswirkungen auf die Umwelt
- Vergleich von billigen und teuren Klamotten in der Herstellung
- Kauf und Konsum in den Verbrauchsländern - Deutschland
- Slow-Fashion
- Alternativen
- Siegel
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Probleme der Fast-Fashion-Industrie und sucht nach Lösungsansätzen und Alternativen. Die Arbeit analysiert die Produktion in den Herstellungsländern, insbesondere Bangladesch, unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Ein Vergleich zwischen der Herstellung billiger und teurer Kleidung wird ebenso durchgeführt wie eine Betrachtung des Kauf- und Konsumverhaltens in Deutschland. Abschließend werden Alternativen zur Fast-Fashion und relevante Siegel vorgestellt.
- Auswirkungen der Fast-Fashion auf Mensch und Umwelt
- Analyse des Konsumverhaltens in Bezug auf Fast-Fashion
- Vergleich der Produktionsbedingungen von günstiger und teurer Kleidung
- Vorstellung von Alternativen zur Fast-Fashion (Slow Fashion)
- Bewertung von Siegeln im Kontext nachhaltiger Kleidung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Fast-Fashion ein und benennt die Problematik der Produktionsbedingungen in Entwicklungsländern sowie den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Sie hebt die Bedeutung des Themas hervor und skizziert den Aufbau und die Ziele der Arbeit, die darin bestehen, die Probleme der Fast-Fashion-Industrie zu beleuchten und nach Lösungsansätzen zu suchen. Der Bezug auf den Einsturz des Rana Plaza Gebäudes in Bangladesch unterstreicht die Dringlichkeit des Themas.
Fast-Fashion: Dieses Kapitel definiert den Begriff Fast-Fashion und illustriert ihn anhand eines Beispiels aus dem Konsumverhalten in Industrieländern. Es beschreibt die Strategien der Hersteller und Händler, die durch künstliche Veralterung von Produkten und gezielte Marketingkampagnen eine stetige Nachfrage nach neuen Kleidungsstücken erzeugen. Der Vergleich zwischen der eigentlichen Funktion von Kleidung und dem aktuellen Konsumverhalten verdeutlicht die Diskrepanz zwischen Notwendigkeit und Wunsch. Die kritische Betrachtung des Konsumverhaltens deckt auf, wie der Wunsch nach Individualität durch den Kauf von günstiger Massenware ad absurdum geführt wird.
Schlüsselwörter
Fast-Fashion, Slow Fashion, Konsumverhalten, Produktionsbedingungen, Bangladesch, Nachhaltigkeit, Umweltbelastung, Menschenrechte, Siegel, Alternativen, Textilindustrie.
FAQ: Seminararbeit - Fast Fashion
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht kritisch die Fast-Fashion-Industrie, ihre Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, und sucht nach nachhaltigen Alternativen. Der Fokus liegt auf den Produktionsbedingungen in Entwicklungsländern (insbesondere Bangladesch), dem Konsumverhalten in Industrieländern (Deutschland) und der Gegenbewegung der Slow Fashion. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu Fast Fashion, Produktion in den Herstellungsländern, Konsum in Deutschland, Slow Fashion und ein Fazit. Sie analysiert Daten und Fakten zum Konsumverhalten, vergleicht die Herstellungskosten und -bedingungen von günstiger und teurer Kleidung und bewertet relevante Siegel für nachhaltige Kleidung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Auswirkungen von Fast Fashion auf Mensch und Umwelt, analysiert das Konsumverhalten im Kontext von Fast Fashion, vergleicht die Produktionsbedingungen von günstiger und teurer Kleidung, stellt Alternativen wie Slow Fashion vor und bewertet Siegel im Bereich nachhaltiger Kleidung.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Fast Fashion (mit Definition und Konsumverhalten), Produktion in den Herstellungsländern (Auswirkungen auf Mensch und Umwelt in Bangladesch, Vergleich der Herstellung von billiger und teurer Kleidung), Kauf und Konsum in Deutschland, Slow Fashion (Alternativen und Siegel) und Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Aspekte.
Was wird unter "Fast Fashion" verstanden?
Die Arbeit definiert den Begriff Fast Fashion und beschreibt die Strategien der Hersteller und Händler, die durch künstliche Veralterung von Produkten und Marketingkampagnen eine hohe Nachfrage nach neuen Kleidungsstücken erzeugen. Es wird der Gegensatz zwischen der eigentlichen Funktion von Kleidung und dem aktuellen Konsumverhalten beleuchtet, der die Diskrepanz zwischen Notwendigkeit und Wunsch verdeutlicht.
Welche Rolle spielt Bangladesch in der Seminararbeit?
Bangladesch dient als Beispiel für die negativen Auswirkungen der Fast-Fashion-Produktion auf die Menschen in den Herstellungsländern. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen auf die Bevölkerung und die Umwelt, insbesondere im Zusammenhang mit den Produktionsbedingungen in der Textilindustrie.
Welche Alternativen zu Fast Fashion werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert Slow Fashion als Alternative zu Fast Fashion. Sie beleuchtet verschiedene Ansätze und relevante Siegel, die für nachhaltige und ethisch produzierte Kleidung stehen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Fast Fashion, Slow Fashion, Konsumverhalten, Produktionsbedingungen, Bangladesch, Nachhaltigkeit, Umweltbelastung, Menschenrechte, Siegel, Alternativen, Textilindustrie.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Seminararbeit?
(Der genaue Inhalt des Fazits ist in der gegebenen Vorschau nicht vollständig dargestellt, aber es lässt sich erwarten, dass das Fazit die Ergebnisse der Analyse zusammenfasst und Schlussfolgerungen zu den Auswirkungen von Fast Fashion und den Möglichkeiten nachhaltigerer Konsum- und Produktionsweisen zieht.)
- Quote paper
- Kristin Bohla (Author), 2020, Fast-Fashion. Probleme und Lösungsansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1334943