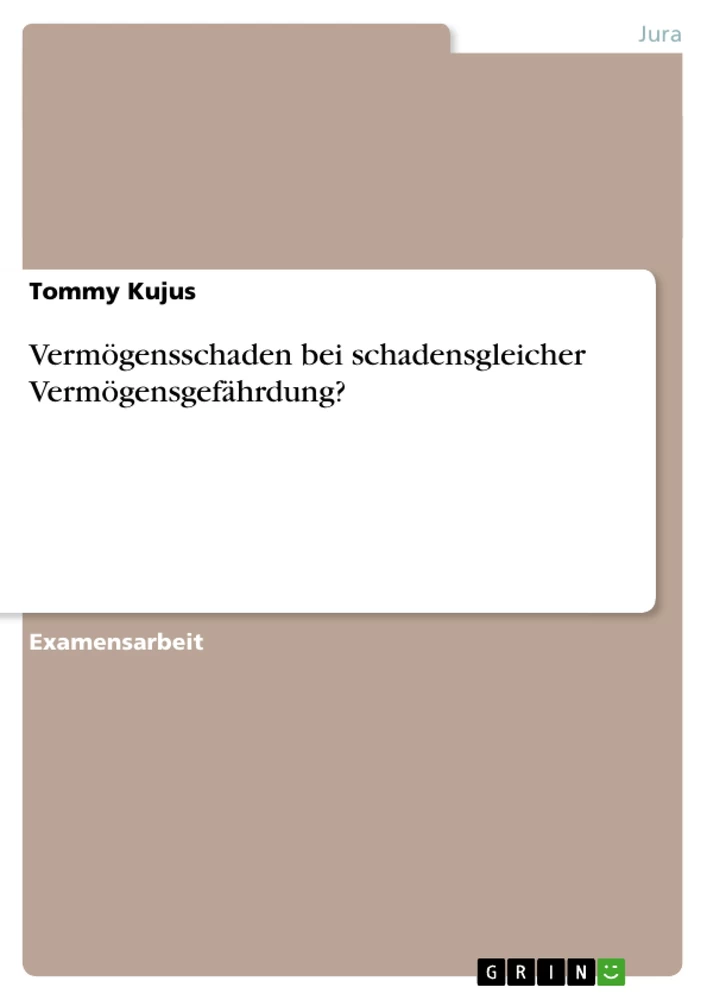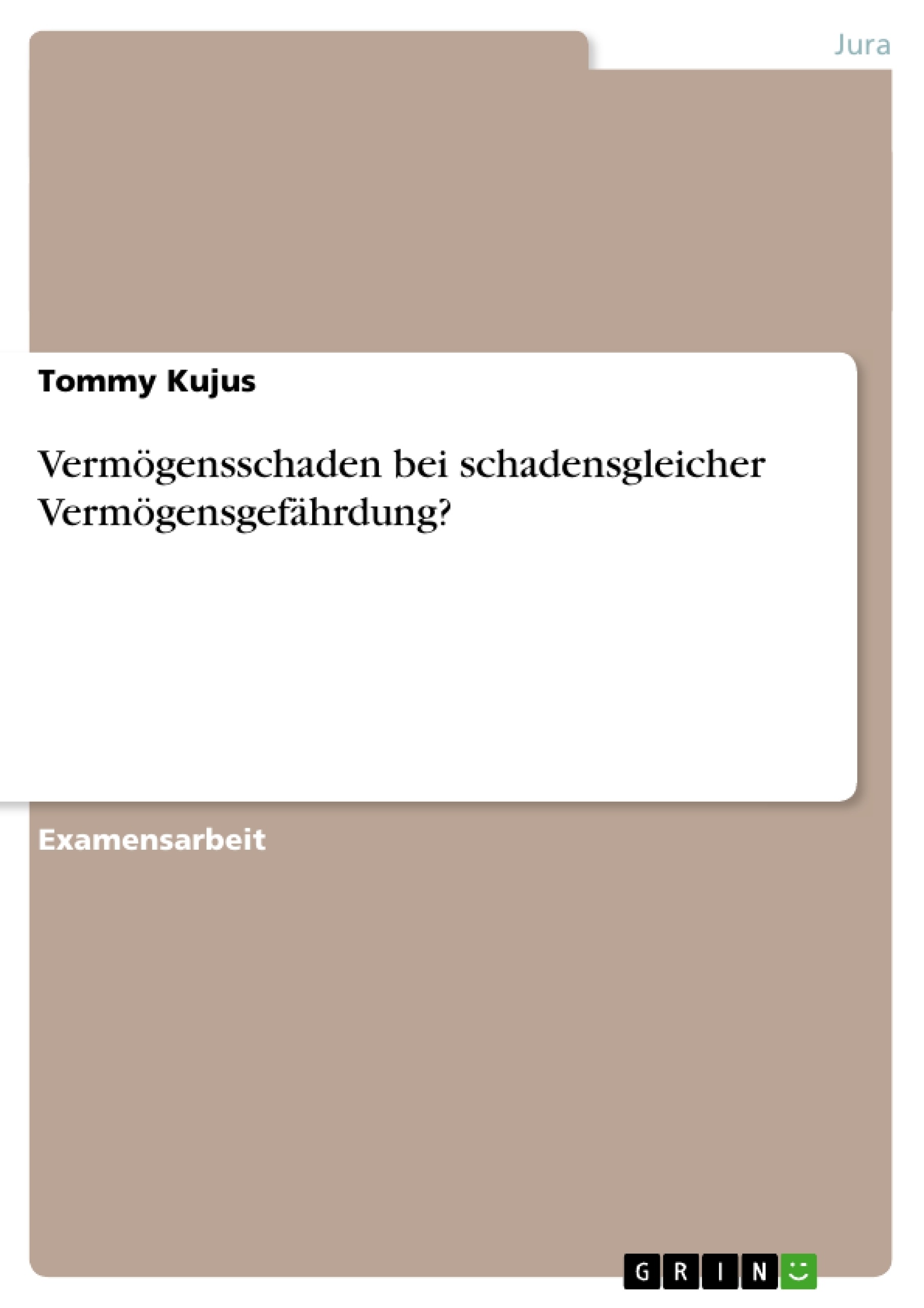Die Vermögensdelikte der §§ 263 ff. StGB setzen zur Tatvollendung stets einen eingetretenen Vermögensschaden voraus. So plausibel, wie dies auf den ersten Blick erscheinen mag, so schwierig ist die dogmatische bzw. wissenschaftliche Konkretisierung.
Dabei hat die notwendige Unterscheidung zwischen vermögensrelevanten und vermögensirrelevanten Gefährdungen im heutigen Wirtschaftsverkehr, in dem zunehmend auf Kreditierungen und andere sogenannte Risikogeschäfte gesetzt wird, stark zugenommen. Üblicherweise wird hier die Figur der "schadensgleichen Vermögensgefährdung" als zulässiges und vor allem erforderliches Mittel angesehen, die Straftatbestände der §§ 263 ff. handhabbar zu machen.
Die vorliegende Arbeit untersuch nun, ob diese These haltbar ist. Ob also bereits die Gefährdung des Vermögens einem sich schon realisierten Schaden gleichgestellt werden kann. Dies erfolgt insbesondere unter kritischer Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung des BGH.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Vermögensbegriff des StGB
- Meinungsstand
- Stellungnahme
- Der Vermögensschaden
- Die Vermögensgefährdung als Schaden?
- Rechtliche Zulässigkeit
- Kritik
- Stellungnahme
- Einschränkungsmodelle
- Schrifttum
- Rechtsprechung
- Stellungnahme
- Rechtliche Zulässigkeit
- Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die rechtliche Zulässigkeit der „schadensgleichen Vermögensgefährdung“ im deutschen Strafrecht, insbesondere im Kontext der Vermögensdelikte der §§ 263 ff. StGB. Die Analyse konzentriert sich auf die Frage, ob die Gefährdung des Vermögens einem bereits realisierten Schaden gleichgestellt werden kann.
- Der Vermögensbegriff im Strafgesetzbuch (StGB)
- Die Definition und Bestimmung des Vermögensschadens
- Die rechtliche Zulässigkeit der „schadensgleichen Vermögensgefährdung“
- Kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Einschränkungsmodellen
- Analyse der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Vermögensdelikte im deutschen Strafrecht ein und skizziert die Problematik der dogmatischen Konkretisierung des Vermögensschadens. Sie hebt die zunehmende Relevanz der Unterscheidung zwischen vermögensrelevanten und vermögensirrelevanten Gefährdungen im modernen Wirtschaftsverkehr hervor und kündigt die Untersuchung der „schadensgleichen Vermögensgefährdung“ an. Der Fokus liegt auf der Frage, ob eine Gefährdung des Vermögens einem realisierten Schaden gleichgestellt werden kann.
Der Vermögensbegriff des StGB: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Meinungen zum Vermögensbegriff im StGB. Es werden der rein juristische, der personale, der rein wirtschaftliche und der juristisch-ökonomische Vermögensbegriff diskutiert und kritisch bewertet. Die Arbeit plädiert letztendlich für einen juristisch-ökonomischen Vermögensbegriff, der sowohl den wirtschaftlichen Wert als auch die rechtliche Anerkennung von Gütern berücksichtigt. Die Argumentation stützt sich auf eine detaillierte Analyse der Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze und ihrer Konsequenzen für die Strafbarkeit.
Der Vermögensschaden: Hier wird der Vermögensschaden unter Berücksichtigung der zuvor erörterten Vermögensbegriffe definiert. Es wird betont, dass eine wirtschaftliche Betrachtungsweise entscheidend ist und ein Vermögensschaden vorliegt, wenn die erlangte Leistung im Vergleich zur Gegenleistung einen geringeren Wert aufweist. Die Bedeutung des Prinzips der Gesamtsaldierung und die Berücksichtigung sowohl objektiver als auch subjektiver Komponente (individueller Schadenseinschlag) werden erläutert.
Die Vermögensgefährdung als Schaden?: Dieses Kapitel befasst sich mit der zentralen Frage, ob eine Vermögensgefährdung als Schaden im Sinne der §§ 263 ff. StGB angesehen werden kann. Es werden verschiedene kritische Argumente gegen die „schadensgleiche Vermögensgefährdung“ dargelegt, darunter der mögliche Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG, gesetzessystematische Probleme und kriminalpolitische Bedenken. Die verschiedenen Ansätze in der Literatur (Schröder, Cramer, Lenckner) zur Einschränkung des Instituts werden kritisch gewürdigt. Die Rechtsprechung des BGH, insbesondere die Divergenz zwischen dem 1. und 2. Strafsenat, wird umfassend analysiert. Das Kapitel mündet in einer detaillierten Stellungnahme, die die rechtliche Zulässigkeit der „schadensgleichen Vermögensgefährdung“ unter Berücksichtigung der aufgeworfenen Kritikpunkte bewertet.
Schlüsselwörter
Vermögensschaden, Vermögensgefährdung, Strafrecht, Betrug (§ 263 StGB), Untreue (§ 266 StGB), Vermögensbegriff, juristisch-ökonomischer Vermögensbegriff, Bestimmtheitsgebot (Art. 103 Abs. 2 GG), Rechtsprechung BGH, Gefährdungsschaden, Gesamtsaldierung, Eingehungsbetrug.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Die schadensgleiche Vermögensgefährdung im deutschen Strafrecht"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die rechtliche Zulässigkeit der „schadensgleichen Vermögensgefährdung“ im deutschen Strafrecht, insbesondere im Kontext der Vermögensdelikte der §§ 263 ff. StGB. Der Fokus liegt auf der Frage, ob die Gefährdung des Vermögens einem bereits realisierten Schaden gleichgestellt werden kann.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Vermögensbegriff im Strafgesetzbuch (StGB), die Definition und Bestimmung des Vermögensschadens, die rechtliche Zulässigkeit der „schadensgleichen Vermögensgefährdung“, verschiedene Einschränkungsmodelle, und die Analyse der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH).
Welche Vermögensbegriffe werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert den rein juristischen, den personalen, den rein wirtschaftlichen und den juristisch-ökonomischen Vermögensbegriff. Es wird letztendlich für einen juristisch-ökonomischen Vermögensbegriff plädiert, der sowohl den wirtschaftlichen Wert als auch die rechtliche Anerkennung von Gütern berücksichtigt.
Wie wird der Vermögensschaden definiert?
Der Vermögensschaden wird unter Berücksichtigung der erörterten Vermögensbegriffe definiert. Eine wirtschaftliche Betrachtungsweise ist entscheidend: Ein Vermögensschaden liegt vor, wenn die erlangte Leistung im Vergleich zur Gegenleistung einen geringeren Wert aufweist. Das Prinzip der Gesamtsaldierung und die Berücksichtigung sowohl objektiver als auch subjektiver Komponenten (individueller Schadenseinschlag) werden erläutert.
Wie wird die Vermögensgefährdung bewertet?
Das Kapitel zur Vermögensgefährdung befasst sich mit der Frage, ob eine Vermögensgefährdung als Schaden im Sinne der §§ 263 ff. StGB angesehen werden kann. Kritische Argumente gegen die „schadensgleiche Vermögensgefährdung“, mögliche Verstöße gegen das Bestimmtheitsgebot, gesetzessystematische Probleme und kriminalpolitische Bedenken werden dargelegt. Verschiedene Ansätze in der Literatur und die Rechtsprechung des BGH (inkl. der Divergenz zwischen dem 1. und 2. Strafsenat) werden umfassend analysiert. Die Arbeit gibt eine detaillierte Stellungnahme zur rechtlichen Zulässigkeit ab.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Vermögensschaden, Vermögensgefährdung, Strafrecht, Betrug (§ 263 StGB), Untreue (§ 266 StGB), Vermögensbegriff, juristisch-ökonomischer Vermögensbegriff, Bestimmtheitsgebot (Art. 103 Abs. 2 GG), Rechtsprechung BGH, Gefährdungsschaden, Gesamtsaldierung, Eingehungsbetrug.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, Kapitel zum Vermögensbegriff des StGB, zum Vermögensschaden, zur Vermögensgefährdung als Schaden und ein abschließendes Ergebnis. Jedes Kapitel enthält eine detaillierte Diskussion der relevanten Aspekte und eine kritische Auseinandersetzung mit der bestehenden Literatur und Rechtsprechung.
- Quote paper
- Tommy Kujus (Author), 2009, Vermögensschaden bei schadensgleicher Vermögensgefährdung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133492