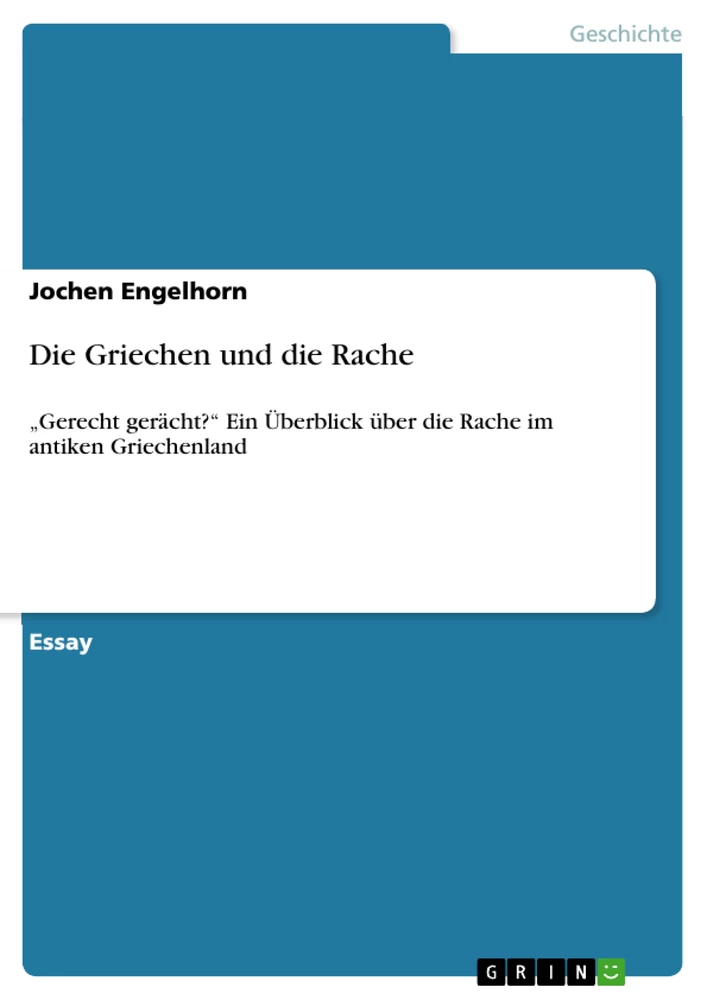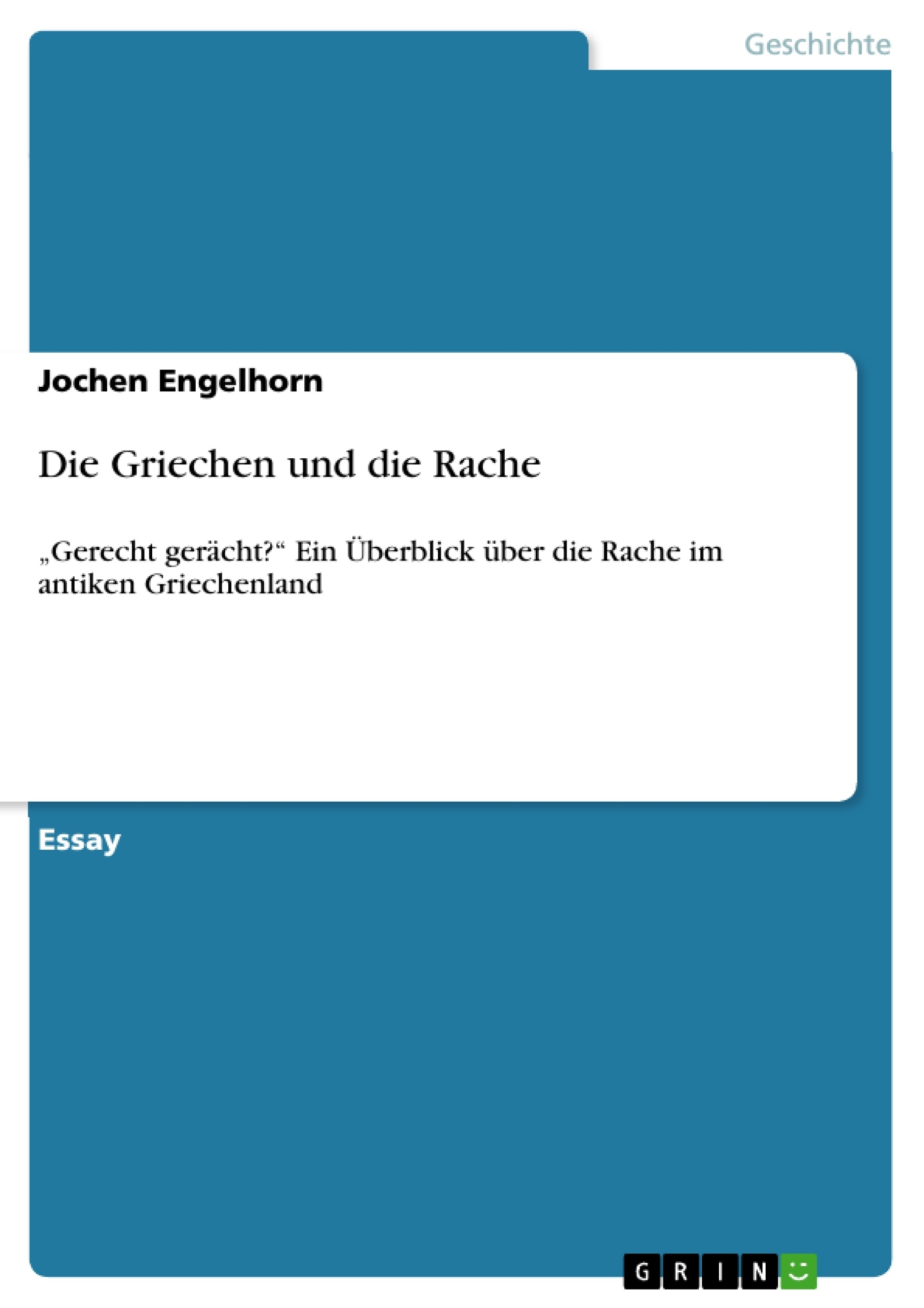„Mord aus Rache für verletztes Ehrgefühl“ lautete die Überschrift einer Meldung der Ludwigsburger Kreiszeitung am 21. Mai diesen Jahres, in der von einem Rachemord eines Taxiunternehmers an seiner Ehefrau berichtet wird. Meldungen wie diese tauchen immer wieder in der Presse auf; Gewalttaten oder gar Mord aus Rache sind jedoch eher die Ausnahme im heutigen Rechtsstaat. Von Eifersüchteleien zwischen Liebschaften und einzelnen grausamen Einzelfällen abgesehen, fristet die Rache im modernen aufgeklärten Staat ihr Dasein als unerwünschte und überflüssige Gefühlsregung. In der heutigen Gesellschaft, in der menschliches Zusammenleben geprägt ist von Selbstbeherrschung und Zurückhaltung, wirkt die Rache wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Rache gilt als unmenschlich, als barbarisch – Menschen, die Vergeltung an anderen ausüben, werden als unkontrolliert und unbeherrscht betrachtet. Der Duden definiert Rache als „eine von Emotionen geleitete persönliche Vergeltung für eine als böse, besonders als persönlich erlittenes Unrecht empfundene Tat“. Sie ist als also eine Handlung, die den Ausgleich eines erlittenen Unrechts bewirken soll; ein emotional gesteuerter Akt, der gegenwärtigen Auffassungen von Recht widerspricht. Denn durch die persönliche Vergeltungstat würde ein Grundprinzip des modernen Staates angetastet, das in großem Maße zur Stabilität der heutigen Gemeinschaft dient: das Gewaltmonopol des Staates.
„Mord aus Rache für verletztes Ehrgefühl“ lautete die Überschrift einer Meldung der Ludwigsburger Kreiszeitung am 21. Mai diesen Jahres, in der von einem Rachemord eines Taxiunternehmers an seiner Ehefrau berichtet wird. Meldungen wie diese tauchen immer wieder in der Presse auf; Gewalttaten oder gar Mord aus Rache sind jedoch eher die Ausnahme im heutigen Rechtsstaat. Von Eifersüchteleien zwischen Liebschaften und einzelnen grausamen Einzelfällen abgesehen, fristet die Rache im modernen aufgeklärten Staat ihr Dasein als unerwünschte und überflüssige Gefühlsregung. In der heutigen Gesellschaft, in der menschliches Zusammenleben geprägt ist von Selbstbeherrschung und Zurückhaltung, wirkt die Rache wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Rache gilt als unmenschlich, als barbarisch – Menschen, die Vergeltung an anderen ausüben, werden als unkontrolliert und unbeherrscht betrachtet. Der Duden definiert Rache als „eine von Emotionen geleitete persönliche Vergeltung für eine als böse, besonders als persönlich erlittenes Unrecht empfundene Tat“. Sie ist als also eine Handlung, die den Ausgleich eines erlittenen Unrechts bewirken soll; ein emotional gesteuerter Akt, der gegenwärtigen Auffassungen von Recht widerspricht. Denn durch die persönliche Vergeltungstat würde ein Grundprinzip des modernen Staates angetastet, das in großem Maße zur Stabilität der heutigen Gemeinschaft dient: das Gewaltmonopol des Staates.
Durch den modernen Rechtstaat wurde die ungezügelte Rache zunehmend zurückgedrängt und durch den Prozessweg ein Mittel bereitgestellt, indirekt Vergeltung unter der Kontrolle des Staates auszuüben. Selbstjustiz und eigenmächtige Vergeltung wurden verdrängt durch ein Gewaltmonopol des Staates, der mit Hilfe von Gesetzen und Strafen ein Gleichgewicht zwischen Opfer und Täter aufrechtzuerhalten versucht. Das Gericht als Ersatzhandlung für menschliche Triebe – heute entscheidet nicht der Einzelne, sondern die durch den Staat verkörperte Gemeinschaft über Vergeltung von Unrecht. Gleichzeitig wirkt auf uns die Anwendung von Rache wie ein barbarischer Akt, wie ein Überbleibsel aus einer archaischen Epoche, in der jeder, der sich in seinen Rechten verletzt fühlte, unmittelbar Vergeltung üben konnte. Wir besitzen zwar den Drang nach Ausgleich, Vergeltung und Genugtuung, doch diesen einzulösen würde den Grundprinzipien unserer heutigen Gesellschaft widersprechen. Doch wie sah dieses Verhältnis in antiken Gesellschaften aus? Welchen Bezug zur Rache besaßen die Menschen im antiken Griechenland? Und wie gingen sie mit dieser um?
Rache war für die Griechen grundsätzlich nichts Negatives – die zahlreichen literarischen Darstellungen und Überlieferungen, die Rachehandlungen beinhalten, vermitteln ein eher positives Bild von Rächerinnen und Rächern. Besonders in der Welt der Götter spielte die Rache zwischen Artgenossen keine geringe Rolle. Vielfältig waren die Ursachen und Formen. So ließ Göttervater Zeus beispielsweise Pandora erschaffen, um Rache für den Feuerraub des Prometheus zu nehmen. Seine Gemahlin, ebenfalls kein unbescholtenes Blatt, wenn es um das Rächen geht, konnte nicht genug von der Rache an ihren Nebenbuhlerinnen bekommen, denn davon gab es bekanntlich nicht wenige. Die Liste ließe sich fast endlos fortsetzen – nicht weniger als vier Göttinnen kümmerten sich um die Rache – Nemesis sowie die drei Rachegöttinnen, die Erinnyen, hatten alle Hände voll zu tun, um ihren Einfluss auf Rache- und Vergeltungsakte spielen zu lassen.
[...]
- Quote paper
- Jochen Engelhorn (Author), 2008, Die Griechen und die Rache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133442