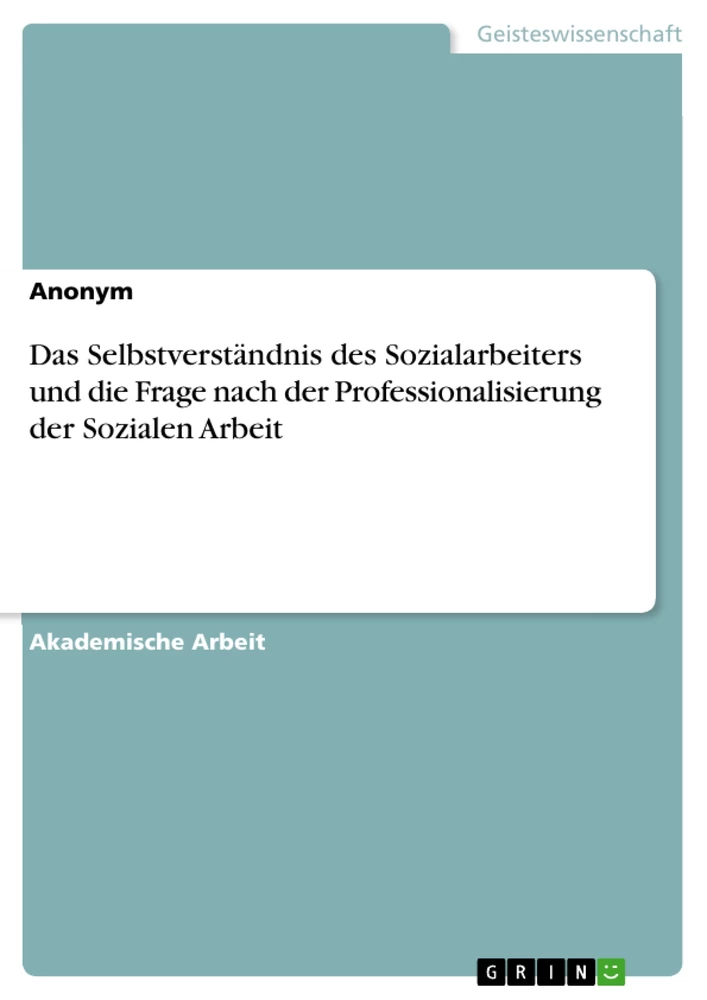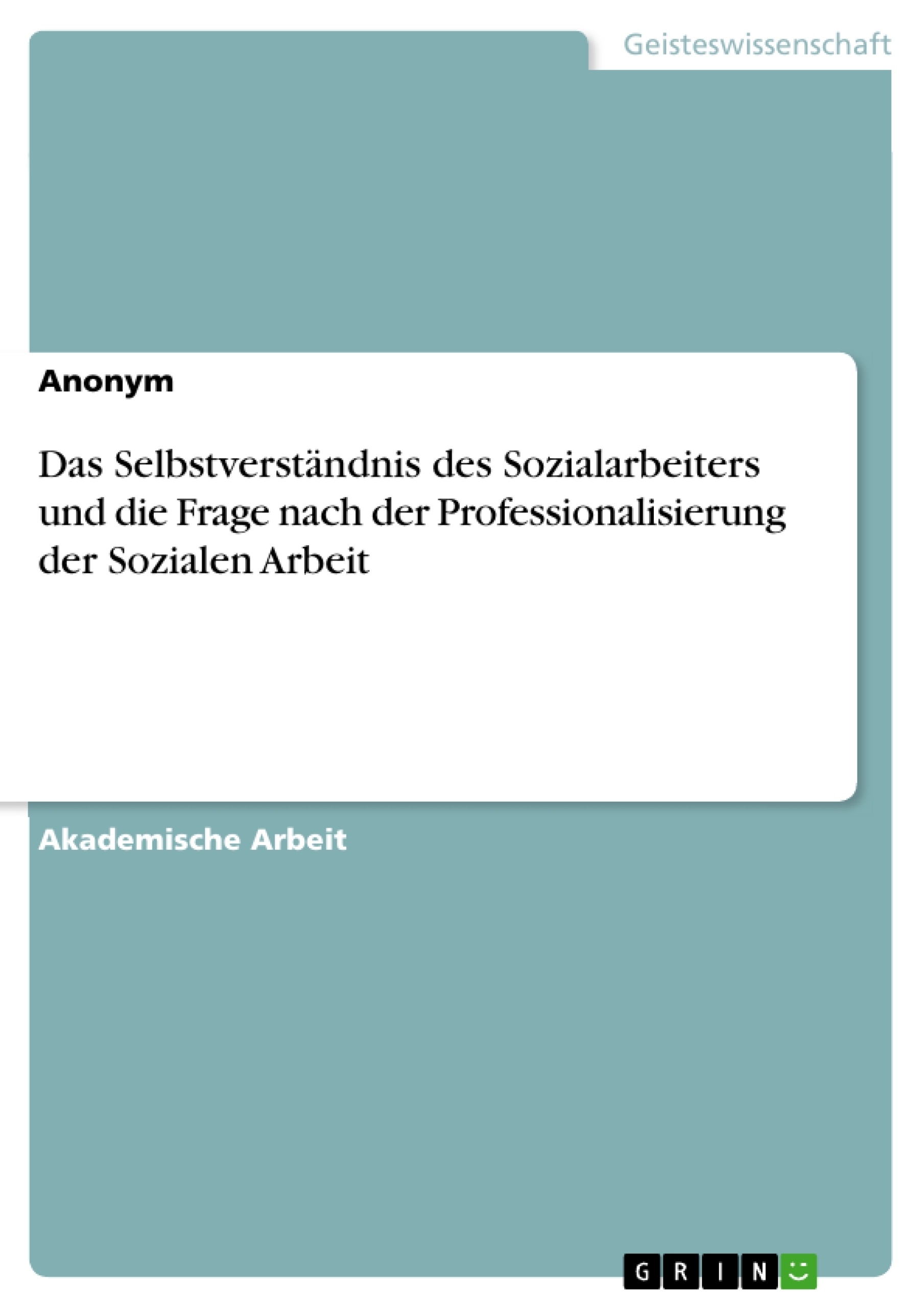Diese Arbeit legt das Selbstverständnis des Sozialarbeiters, die Kriterien der Professionalisierung und das Spannungsfeld von Theorie und Praxis dar. Was ist denn nun das wirklich grundlegende und fundamentale, was die soziale Arbeit bzw. Sozialpädagogik im Alltag des Berufs in der praktischen Tätigkeit hat? Auf was könnte man ein gleichbleibendes Verstehen der sozialen Arbeit gründen? Welches Fachwissen ist grundlegend essenziell und welche Fähigkeiten benötigt der Sozialarbeiter in seiner Arbeit? Welche Eigenständigkeit sollte den Sozialarbeitern gegenüber den Normen der Gesellschaft und im Verhältnis gegenüber den tragenden verwaltenden Institutionen eingeräumt werden?
Jeder, der in der sozialen Arbeit tätig ist, hat zwar eine berufliche Identität in dem Sinne, dass ihm bewusst ist, was er macht, doch diese entspringt meist durch die eigenen Erfahrungen, die im Beruf gemacht wurden und den eigenen Vorstellungen von dem, was die berufliche Tätigkeit im sozialen Bereich leisten soll. Die Identität im Beruf des Sozialen variiert einerseits in der Stabilität und andererseits auch von Mitarbeiter zu Mitarbeiter. Auch innerhalb desselben Arbeitsfeldes kann es gravierende Unterschiede bezogen auf das Selbstverständnis der eigenen Arbeit geben und somit auch was die Praxis in diesem Berufsfeld angeht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung - Einführung des Themas
- Über den Professionalisierungsdiskurs in der sozialen Arbeit
- Selbstverständnis des Sozialarbeiters
- Spannung der sozialen Arbeit zwischen Theorie und Praxis
- Professionalisierung soziale Arbeit
- Fazit und Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Professionalisierungsdiskurs in der sozialen Arbeit und untersucht die Herausforderungen und Ambivalenzen, die mit der Etablierung eines klaren Selbstverständnisses und einer professionellen Identität verbunden sind. Der Fokus liegt auf der Spannungsbeziehung zwischen Theorie und Praxis, der Rolle des Sozialarbeiters als Vermittler zwischen Individuum und Gesellschaft und der Notwendigkeit einer reflektierten Handlungsweise.
- Das Selbstverständnis des Sozialarbeiters
- Die Spannungsbeziehung zwischen Theorie und Praxis
- Die Rolle des Sozialarbeiters als Vermittler zwischen Individuum und Gesellschaft
- Die Herausforderungen der Professionalisierung in der sozialen Arbeit
- Die Bedeutung einer reflektierten Handlungsweise
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung - Einführung des Themas
Die Einleitung beleuchtet die Problematik des fehlenden klaren Selbstverständnisses in der sozialen Arbeit und die daraus resultierende Unsicherheit in Bezug auf Aufgaben, Ziele und Positionierung innerhalb der Gesellschaft. Sie stellt zentrale Fragen zur Rolle des Sozialarbeiters und den Spannungen zwischen verschiedenen Perspektiven und Anforderungen.
Über den Professionalisierungsdiskurs in der sozialen Arbeit
Selbstverständnis des Sozialarbeiters
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Selbstverständnis des Sozialarbeiters im Kontext der Professionalisierung. Es beleuchtet die Rolle des Sozialarbeiters als Vermittler zwischen Individuum und Gesellschaft und die Notwendigkeit einer reflektierten Handlungsweise, die sowohl die Defizite als auch die Ressourcen des Einzelnen berücksichtigt.
Spannung der sozialen Arbeit zwischen Theorie und Praxis
Der Abschnitt thematisiert die Spannungen zwischen theoretischem Wissen und praktischer Anwendung in der sozialen Arbeit. Es werden verschiedene Aspekte wie die Berücksichtigung der eigenen Vorurteile, die Einmischung von Fremden, die Wünsche des Klienten und die eigenen Ziele des Sozialarbeiters beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Aspekten des Professionalisierungsdiskurses in der sozialen Arbeit, darunter das Selbstverständnis des Sozialarbeiters, die Spannungsbeziehung zwischen Theorie und Praxis, die Rolle des Vermittlers zwischen Individuum und Gesellschaft und die Notwendigkeit einer reflektierten Handlungsweise.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Hausarbeit zur Sozialen Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Professionalisierungsdiskurs in der sozialen Arbeit sowie die Herausforderungen bei der Etablierung eines klaren beruflichen Selbstverständnisses.
Welche Rolle nimmt der Sozialarbeiter laut der Arbeit ein?
Der Sozialarbeiter fungiert als Vermittler zwischen dem Individuum und der Gesellschaft, wobei eine reflektierte Handlungsweise essenziell ist.
Warum variiert das Selbstverständnis unter Sozialarbeitern so stark?
Die berufliche Identität entspringt oft individuellen Erfahrungen und persönlichen Vorstellungen darüber, was soziale Arbeit im Alltag leisten soll.
Was wird unter dem Spannungsfeld von Theorie und Praxis verstanden?
Es beschreibt die Herausforderung, theoretisches Fachwissen in der praktischen Tätigkeit anzuwenden, während man gleichzeitig Klientenwünsche und gesellschaftliche Normen berücksichtigt.
Welche Bedeutung hat die reflektierte Handlungsweise?
Sie ist notwendig, um sowohl die Defizite als auch die Ressourcen des Einzelnen objektiv zu bewerten und professionell zu agieren.
Welche Eigenständigkeit wird für Sozialarbeiter diskutiert?
Die Arbeit hinterfragt, wie viel Unabhängigkeit Sozialarbeitern gegenüber gesellschaftlichen Normen und verwaltenden Institutionen eingeräumt werden sollte.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Das Selbstverständnis des Sozialarbeiters und die Frage nach der Professionalisierung der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1333893