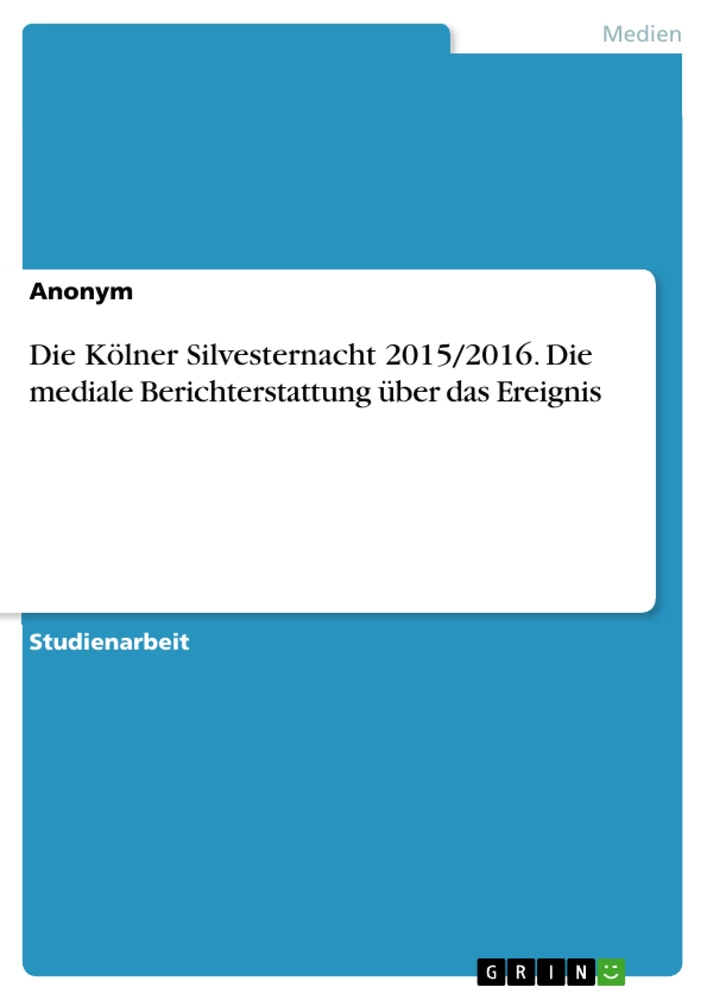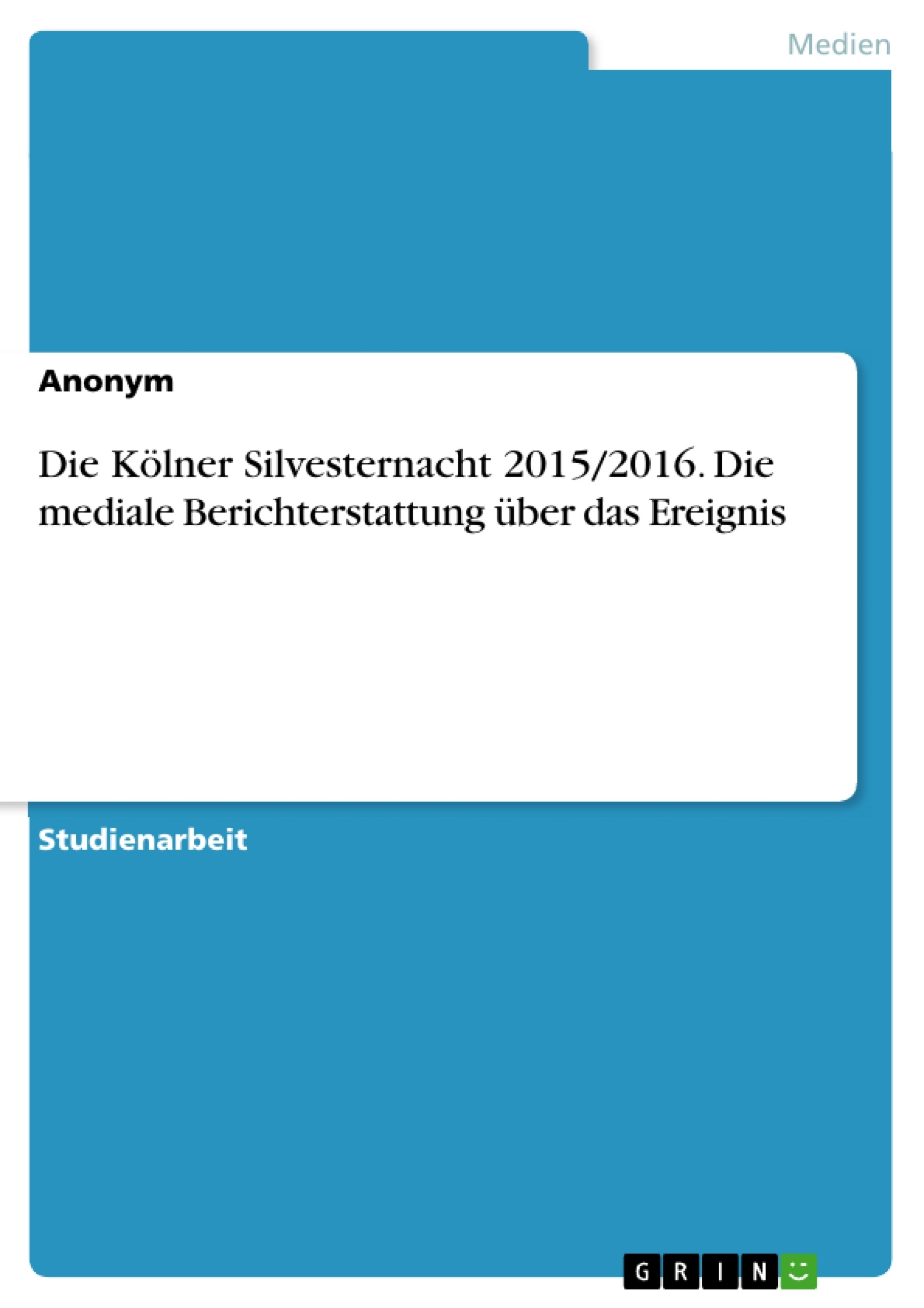Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage: "In welchem Maße werden in der Debatte über die Silvesternacht 2015/16
rassistische Argumentationsmuster verwendet?"
In der Silvesternacht 2015/16 waren in der Gegend um den Kölner Dom und Hauptbahnhof Hunderte von Frauen von sexualisierter Gewalt betroffen. Sowohl vereinzelt als auch in größeren Gruppen belästigten männliche Täter
die Frauen und verhielten sich ihnen gegenüber aufdringlich. Im Zuge dessen kam es vermehrt zu sexuellen Übergriffen.
Die Geschehnisse sind auffällig zögerlich an die Öffentlichkeit gelangt. Erst durch Nachforschungen und Interviews verschiedener Journalist*innen wurden nähere Details dazu bekannt, wie die Polizei die Domplatte evakuiert hat und ab wann die ersten Anzeigen eingereicht wurden.
Im Nachhinein gab es weitreichende Debatten und eine große mediale Präsenz des Themas. Zentraler Bestandteil dieses Diskurses waren die Darstellung der männlichen Täter und ihrer Herkunft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen
- 3. Methodisches Vorgehen
- 3.1 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
- 3.2 Meine Vorgehensweise
- 4. Analyse des Materialkorpus
- 4.1 „Etliche Übergriffe auf Frauen zu Silvester in Köln“
- 4.2 „Polizei und Politik schockiert über Missbrauch an Silvester“
- 4.3 „Übergriffe an Silvester: De Maizière übt massive Kritik an Kölner Sicherheitskonzept“
- 4.4 „Nicht zu fassen“
- 5. Codebuch und Worthäufigkeitstabelle
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die mediale Berichterstattung über die Silvesternacht 2015/16 in Köln, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung rassistischer Argumentationsmuster. Die Arbeit analysiert, wie die Rolle von Sexismus thematisiert wird und wie Täter und Opfer in den ausgewählten Artikeln dargestellt werden. Die zentrale Fragestellung lautet: Inwieweit werden rassistische Argumentationsmuster in der Debatte verwendet und wie präsentieren die Autor*innen und zitierten Akteur*innen die Rolle von Sexismus?
- Analyse rassistischer Argumentationsmuster in der Berichterstattung
- Darstellung von Sexismus in den Artikeln
- Charakterisierung von Tätern und Opfern in der medialen Berichterstattung
- Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring
- Verknüpfung der Analyseergebnisse mit theoretischen Konzepten zu Sexismus und Rassismus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Ereignisse der Kölner Silvesternacht 2015/16, bei denen hunderte Frauen Opfer sexualisierter Gewalt wurden. Die zögerliche Berichterstattung und die anschließenden Debatten werden hervorgehoben. Die Arbeit fokussiert auf die Analyse rassistischer Argumentationsmuster in der Berichterstattung und die Darstellung von Sexismus und der Rolle der beteiligten Akteure. Die Forschungsfrage wird präzise formuliert.
2. Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe Sexismus, sexualisierte Gewalt und Rassismus. Es beleuchtet die Konzepte des „rassistischen Sexismus“ und der „Ethnisierung von Sexismus“ und diskutiert die gesellschaftlichen Machtstrukturen, die diesen Phänomenen zugrunde liegen. Der Bezug zum Grundgesetz und dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz wird hergestellt, um den rechtlichen Kontext zu verdeutlichen. Das Kapitel legt die theoretische Grundlage für die anschließende Analyse.
3. Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es erläutert die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring und spezifiziert die angewandte Methodik im Detail, um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Analyse zu gewährleisten. Die Wahl dieser Methode wird begründet und im Kontext der Forschungsfrage erläutert. Der Abschnitt beschreibt detailliert die Schritte der Analyse und die Auswahl des Materials.
4. Analyse des Materialkorpus: Die Analyse der vier ausgewählten Zeitungsartikel der Süddeutschen Zeitung wird hier präsentiert. Der Abschnitt untersucht, wie die ausgewählten Artikel die Ereignisse darstellen und welche Argumentationsmuster verwendet werden. Es wird analysiert, inwieweit rassistische Stereotype und sexistische Darstellungen zum Tragen kommen und wie die verschiedenen Akteure (Täter, Opfer, Polizei, Politik) präsentiert werden. Die Ergebnisse liefern die Grundlage für die Schlussfolgerungen der Arbeit.
5. Codebuch und Worthäufigkeitstabelle: Dieses Kapitel präsentiert das verwendete Codebuch und die Worthäufigkeitstabelle, die aus der Inhaltsanalyse der ausgewählten Artikel hervorgegangen sind. Diese ermöglichen eine detaillierte und nachvollziehbare Darstellung der Ergebnisse und deren Interpretation im Kontext der Forschungsfrage.
Schlüsselwörter
Kölner Silvesternacht 2015/16, sexualisierte Gewalt, Rassismus, Sexismus, mediale Berichterstattung, qualitative Inhaltsanalyse, Mayring, rassistisches Argumentationsmuster, Täterdarstellung, Opferschutz, Ethnisierung von Sexismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: "Mediale Berichterstattung über die Kölner Silvesternacht 2015/16"
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert die mediale Berichterstattung über die Silvesternacht 2015/16 in Köln, insbesondere im Hinblick auf rassistische Argumentationsmuster und die Darstellung von Sexismus. Der Fokus liegt auf der Frage, wie Täter und Opfer in den ausgewählten Artikeln dargestellt werden und inwieweit sexistische und rassistische Narrative verwendet werden.
Welche Forschungsfrage wird untersucht?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwieweit werden rassistische Argumentationsmuster in der Debatte verwendet und wie präsentieren die Autor*innen und zitierten Akteur*innen die Rolle von Sexismus?
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring. Die Methodik wird detailliert beschrieben, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Die Auswahl der Methode wird im Kontext der Forschungsfrage begründet.
Welches Material wurde analysiert?
Analysiert wurden vier Zeitungsartikel der Süddeutschen Zeitung über die Ereignisse der Kölner Silvesternacht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Analyse rassistischer Argumentationsmuster, Darstellung von Sexismus, Charakterisierung von Tätern und Opfern, Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring und die Verknüpfung der Analyseergebnisse mit theoretischen Konzepten zu Sexismus und Rassismus.
Welche theoretischen Konzepte werden verwendet?
Die Arbeit definiert die zentralen Begriffe Sexismus, sexualisierte Gewalt und Rassismus. Sie beleuchtet die Konzepte des „rassistischen Sexismus“ und der „Ethnisierung von Sexismus“ und diskutiert die gesellschaftlichen Machtstrukturen, die diesen Phänomenen zugrunde liegen. Der rechtliche Kontext wird durch Bezugnahme auf das Grundgesetz und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verdeutlicht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theoretischer Rahmen, Methodisches Vorgehen, Analyse des Materialkorpus, Codebuch und Worthäufigkeitstabelle, und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Was ist im Kapitel "Codebuch und Worthäufigkeitstabelle" enthalten?
Dieses Kapitel präsentiert das verwendete Codebuch und die Worthäufigkeitstabelle, die aus der Inhaltsanalyse hervorgegangen sind. Sie ermöglichen eine detaillierte und nachvollziehbare Darstellung der Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kölner Silvesternacht 2015/16, sexualisierte Gewalt, Rassismus, Sexismus, mediale Berichterstattung, qualitative Inhaltsanalyse, Mayring, rassistisches Argumentationsmuster, Täterdarstellung, Opferschutz, Ethnisierung von Sexismus.
Wo finde ich die detaillierte Analyse der Artikel?
Die detaillierte Analyse der vier ausgewählten Zeitungsartikel der Süddeutschen Zeitung befindet sich im Kapitel "Analyse des Materialkorpus". Hier wird untersucht, wie die Artikel die Ereignisse darstellen und welche Argumentationsmuster verwendet werden.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Die Kölner Silvesternacht 2015/2016. Die mediale Berichterstattung über das Ereignis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1333388