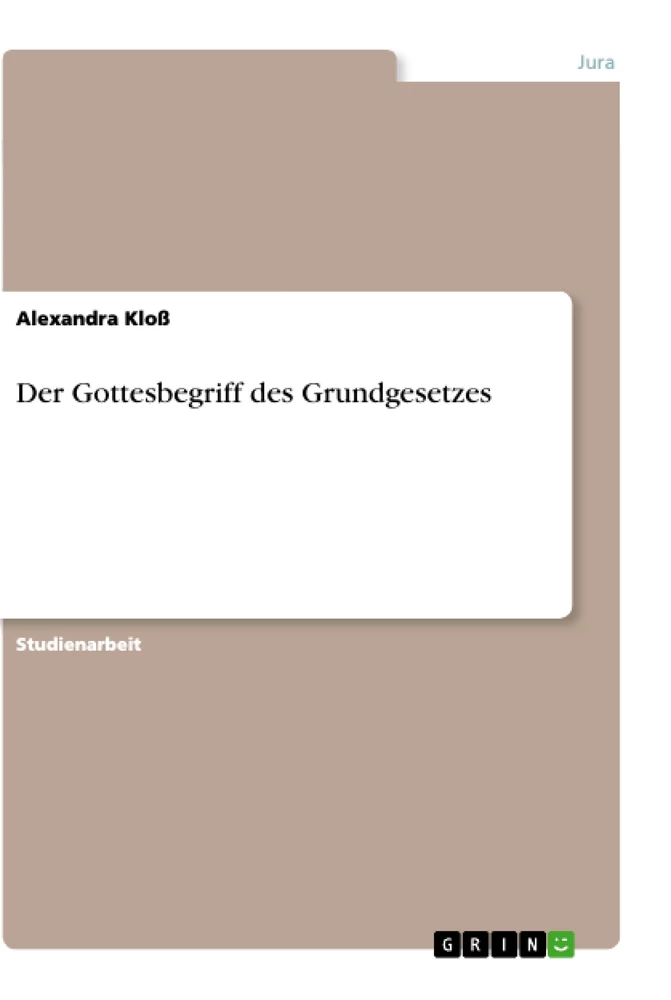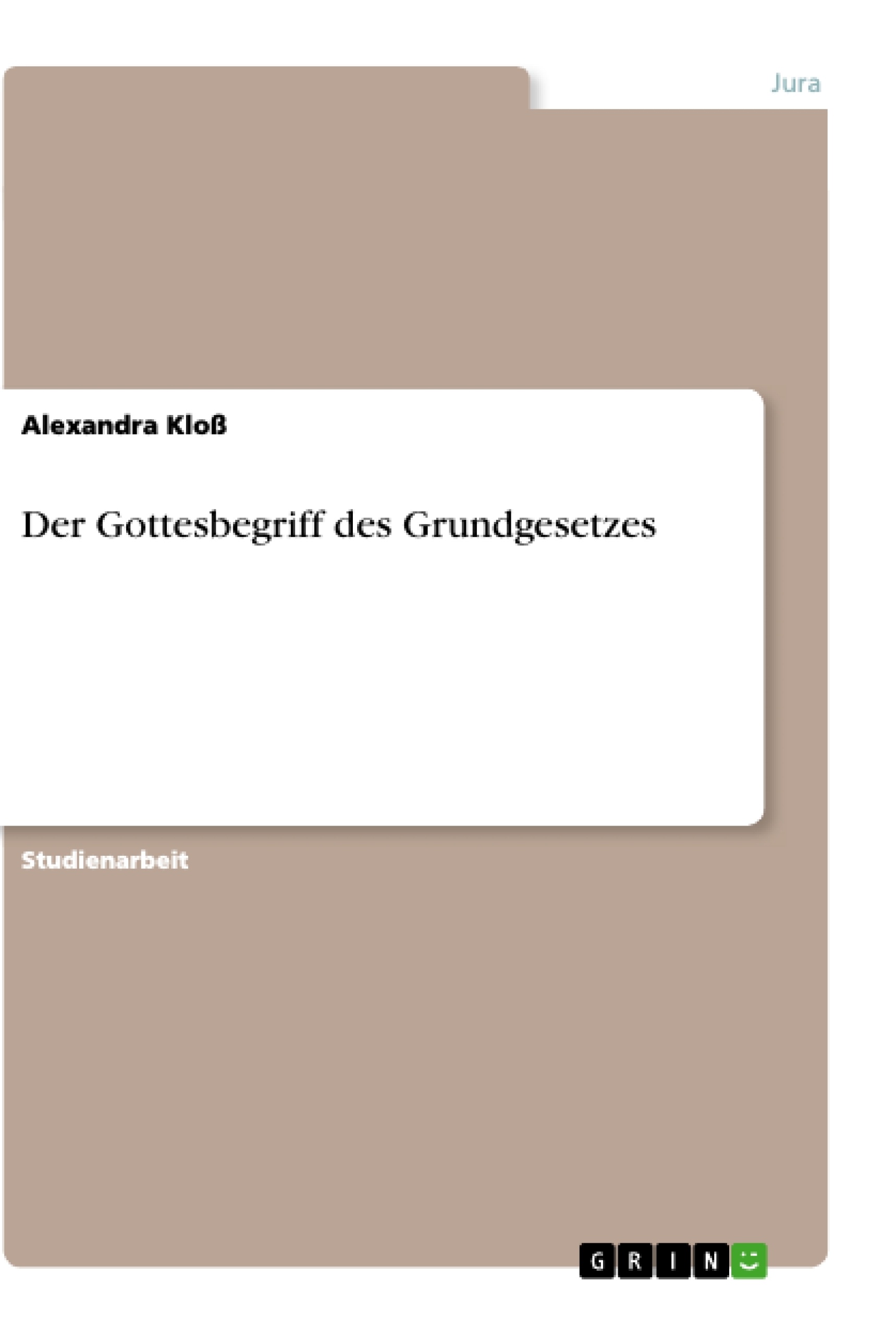„Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen“ so heißt es in der Präambel der deutschen Verfassung. Doch es stellt sich die Frage, um welchen Gott es sich handelt, den jüdischen, christlichen, oder buddhistischen. Oder handelt es um einen offenen Begriff, den jeder für sich selbst ausfüllen kann? An welchen Stellen ist dieser Gott überhaupt zu finden und lässt sich dieser Gottesbegriff mit dem Prinzip der staatlichen Neutralität vereinen? Kurz: wer ist der Gott des Grundgesetzes und der Verfassungen der Länder und gehört er überhaupt an diese Stellen? Wird der Staat so an eine bestimmte Religionsvorstellung gebunden? Soll der Staat ein christlicher sein? Immerhin darf nicht übersehen werden, dass bei der Gründung der Bundesrepublik die stärkste politische Partei sich als christlich bezeichnete.
So steht der Gott des Grundgesetzes auf der Tagesordnung der politischen Diskurse. Die vielfältigen religiös-weltanschaulichen Überzeugungen, die in Deutschland zu finden sind, insbesondere die unterschiedlichen Vorstellungen des Verhältnisses von Kirche zu Staat, lassen den Gottesbegriff zum Reizwort werden. „Die Bezugnahme auf Gott ist zu streichen“ so besagt es der Antrag vom 21.04.1993 der Bündnis90/Die Grünen innerhalb der staatsrechtlichen Debatte im Zuge des Einigungsvertrages. Brisant wurde die Diskussion um den Gottesbegriff des Grundgesetzes bei der Diskussion um die Präambel der europäischen Verfassung. So meinte Wolfgang Ullmann (Bündnis 90/Die Grünen), die Berufung auf Gott sei aus der Verfassung zu streichen. Die Widerreden waren heftig, Schlagzeilen in der Presse aufgeregt: „ Ein Pfarrer will „Gott“ aus dem Grundgesetz streichen lassen.“ So hat das Thema „Gott“ im Grundgesetz eine größere Öffentlichkeit erreicht.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Eine Bestandsaufnahme
- Das Grundgesetz
- 1. Präambel
- 2. Eidesformeln
- 3_ErziehungszieIe und Feiertagsregelungen
- Verfassungen der Länder
- Das Grundgesetz
- C. Die Bedeutung der Präambel
- D. Von welchem Gott sprachen die Väter des Grundgesetzes?
- E. Welches ist der heutige Goä des Grundgesetzes?
- F. Ist dieser Gottesbegriff im Grundgesetz mit den Sfi•ukturprintipien vereinbar?
- G. Wie geht man in anderen Ländern mit dem Gottesbegriff um?
- H. Wie könnte eine Alternative aussehen?
- I. Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Gottesbegriff im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert die Präambel und andere Stellen der Verfassung, in denen Gott erwähnt wird, und untersucht den historischen Kontext der Formulierung. Die Arbeit beleuchtet die Frage, welcher Gott im Grundgesetz gemeint ist und ob dieser Gottesbegriff mit den Strukturprinzipien der Verfassung, insbesondere der staatlichen Neutralität, vereinbar ist. Darüber hinaus werden Verfassungen anderer Länder mit Bezug auf den Gottesbegriff betrachtet, um die deutsche Situation im internationalen Vergleich einzuordnen.
- Der Gottesbegriff in der Präambel des Grundgesetzes
- Der historische Kontext der Formulierung des Gottesbegriffs
- Die Bedeutung des Gottesbegriffs für die Auslegung des Grundgesetzes
- Die Vereinbarkeit des Gottesbegriffs mit den Strukturprinzipien der Verfassung
- Der Gottesbegriff in Verfassungen anderer Länder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentralen Forschungsfragen vor. Sie beleuchtet die aktuelle Debatte um den Gottesbegriff im Grundgesetz und zeigt die Relevanz des Themas auf.
Kapitel B nimmt eine Bestandsaufnahme des Gottesbegriffs im Grundgesetz vor. Es werden die verschiedenen Stellen in der Verfassung analysiert, an denen Gott erwähnt wird, darunter die Präambel, die Eidesformeln und die Erziehungsziele. Außerdem werden die Verfassungen der Länder betrachtet, die ebenfalls einen Gottesbezug aufweisen.
Kapitel C untersucht die Bedeutung der Präambel im Kontext des Grundgesetzes. Es wird dargelegt, dass die Präambel als Teil der Verfassung eine rechtliche Relevanz besitzt und für die Auslegung weiterer Vorschriften des Grundgesetzes von Bedeutung ist.
Kapitel D befasst sich mit der Frage, welcher Gott von den Vätern des Grundgesetzes gemeint war. Es wird die Entstehung des Grundgesetzes im historischen Kontext betrachtet und die Intention der Verfassungsväter beleuchtet.
Kapitel E analysiert den heutigen Gottesbegriff im Grundgesetz. Es wird die Frage erörtert, ob der christliche Gott, der von den Verfassungsvätern gemeint war, auch heute noch relevant ist, oder ob der Begriff Gottes in der Verfassung offen für verschiedene Interpretationen ist.
Kapitel F untersucht, ob der Gottesbegriff im Grundgesetz mit den Strukturprinzipien der Verfassung vereinbar ist. Es werden die religionsrechtlichen Strukturprinzipien, insbesondere die staatliche Neutralität, erörtert und deren Bedeutung für die Auslegung des Gottesbegriffs im Grundgesetz beleuchtet.
Kapitel G betrachtet die Gestaltung des Gottesbegriffs in Verfassungen anderer Länder. Es werden Verfassungen von europäischen Ländern, wie der Schweiz, Griechenland und Irland, analysiert und deren Gottesbezug mit dem deutschen Grundgesetz verglichen.
Kapitel H diskutiert alternative Formulierungen für die Präambel des Grundgesetzes, die den Pluralismus der Gesellschaft besser widerspiegeln könnten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Gottesbegriff, das Grundgesetz, die Präambel, die staatliche Neutralität, die Religionsfreiheit, die Verfassungen der Länder, die historische Kontextualisierung, die Bedeutung des Gottesbegriffs, die Interpretation des Gottesbegriffs, die Vereinbarkeit des Gottesbegriffs mit den Strukturprinzipien der Verfassung, der Vergleich mit anderen Ländern und alternative Formulierungen für die Präambel.
- Quote paper
- Alexandra Kloß (Author), 2007, Der Gottesbegriff des Grundgesetzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133245