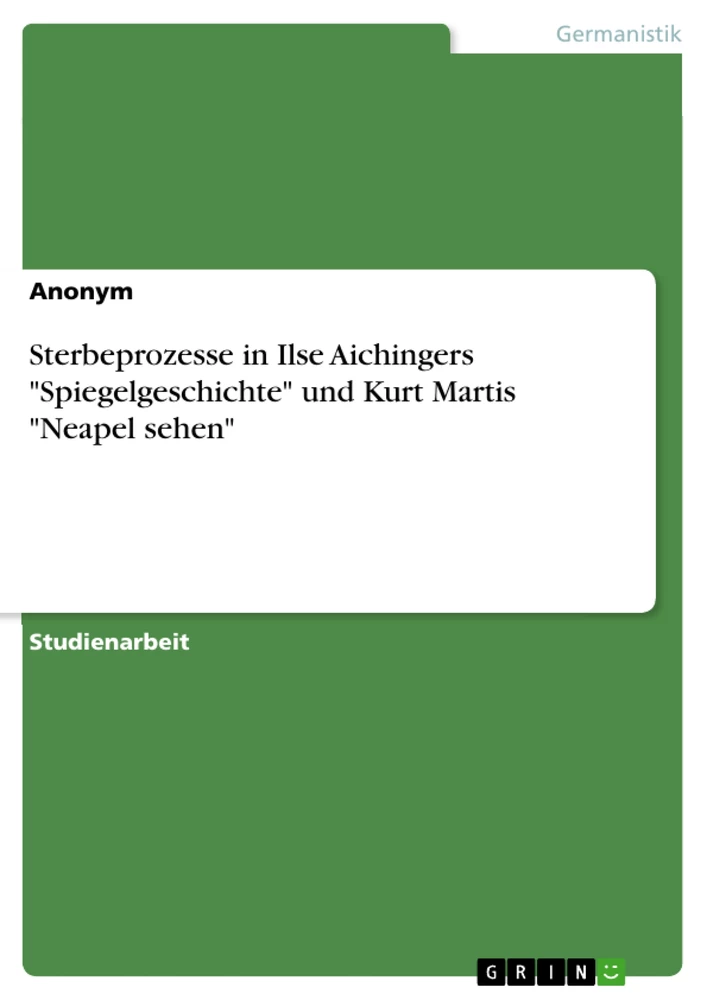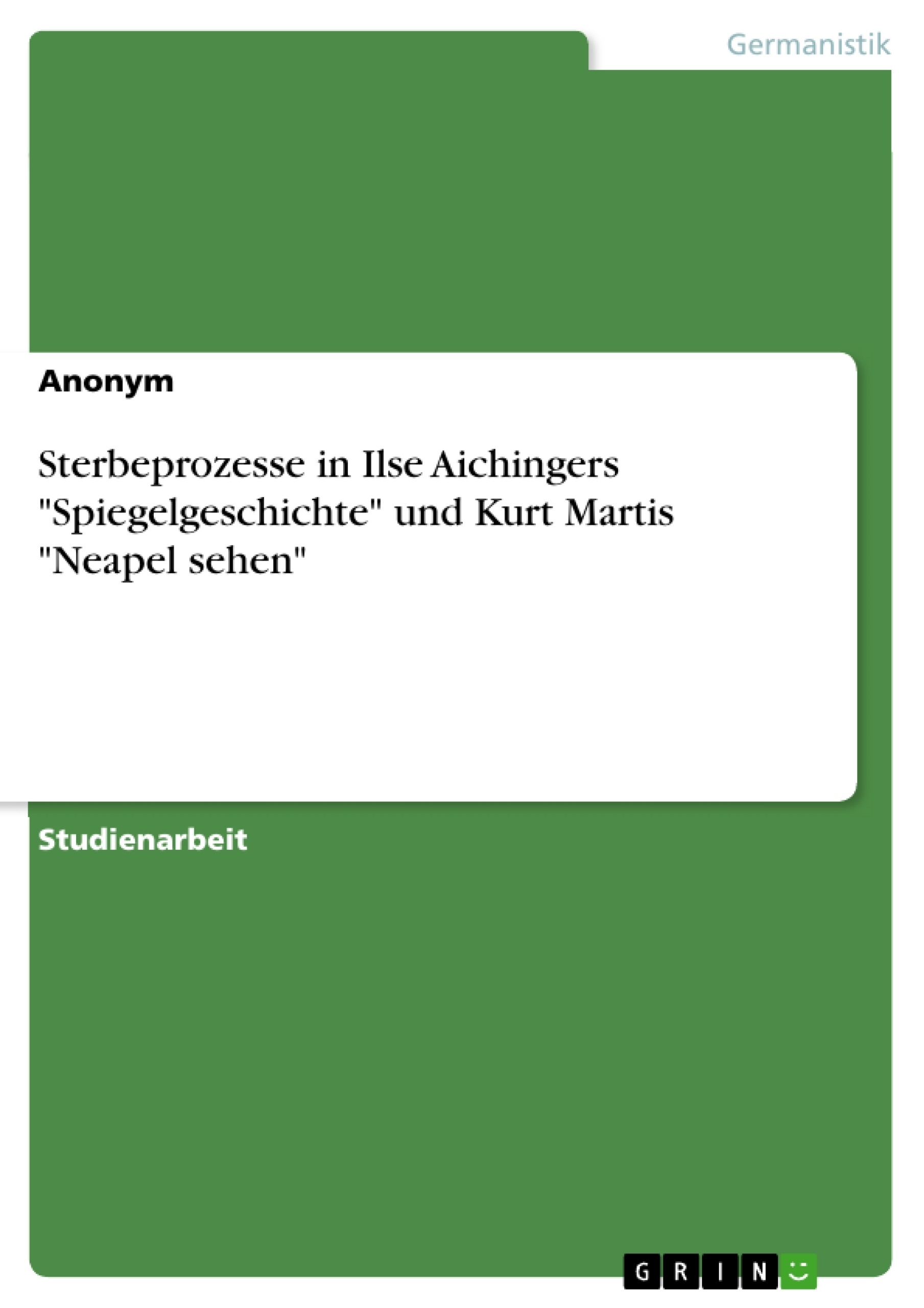Zunächst wird in dieser Hausarbeit darauf eingegangen, welche Faktoren die beiden Erzählungen in der Forschung als Sterbenarrativ auszeichnen. Dabei wird sich zeigen, welche Elemente der sog. "Sterbeerzählung" sich in- und außerhalb der erzählten Welten finden lassen. Ob die beiden Kurzgeschichten als Darstellungen von Sterbeprozessen der Untergattung ‚Sterbeerzählung‘ zuzuordnen sind, muss im Fortgang der Arbeit anhand unterschiedlicher Aspekte und Betrachtungsweisen herausgearbeitet und einzeln im Detail untersucht werden. Den Platz, den die Sterbeerfahrungen selbst in den Erzählungen einnehmen sowie die besonderen Lebensläufe der Protagonisten und die damit einhergehende Gesellschaftskritik stehen dabei im Fokus der Untersuchung.
Die von Andreas Mauz angeführten Merkmale der Sterbeerzählung dienen dabei nicht nur zur Analyse von Kurt Martis "Neapel sehen", sondern auch dem Vergleich beider Geschichten. Dabei wird sich zeigen, dass sich die Präsentation des Erzählten zwar deutlich voneinander unterscheidet, sich die jeweiligen Protagonisten aber trotz dieser erzählerischen Kontraste stärker ähneln als sich auf den ersten Blick vermuten lässt. Dies wird anhand einer inhärenten Gesellschaftskritik sowie der literaturgeschichtlichen Einordnung verdeutlicht. Abschließend wird sich herausstellen, dass die erzählten Selbstreflexionen der "um ihr Leben Betrogenen" und die damit verbundene Gesellschaftskritik den Diskurs über das Sterben exemplarisch markieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Elemente der Sterbeerzählung
- Diskurs vs. Präsentation
- Gesellschaftskritik und Selbstreflexion
- Die Darstellung des Sterbeprozesses
- Der Tod in der Literaturgeschichte
- Der Tod in Neapel sehen und der Spiegelgeschichte
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Sterbeprozessen in Kurt Martis Neapel sehen und Ilse Aichingers Spiegelgeschichte. Ziel ist es, die literarischen Strategien zu analysieren, mit denen die Autoren das Thema Tod und Sterben behandeln und wie diese Erzählungen in den Diskurs um die "Sterbeerzählung" einzuordnen sind. Der Fokus liegt auf der literaturwissenschaftlichen Analyse, wobei philosophische Ansätze lediglich im Kontext betrachtet werden.
- Die Charakterisierung von "Sterbeerzählungen" nach Andreas Mauz.
- Der Vergleich der präsentativen und reflexiven Elemente in beiden Erzählungen.
- Die Rolle der Gesellschaftskritik in der Darstellung des Sterbens.
- Die literaturgeschichtliche Einordnung der Erzählungen im Kontext des Umgangs mit dem Tod im 20. Jahrhundert.
- Die Analyse der Selbstreflexion der Protagonisten im Angesicht des Todes.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und benennt die beiden zu untersuchenden Kurzgeschichten von Kurt Marti und Ilse Aichinger. Sie zitiert Sören Kierkegaard, um unterschiedliche Perspektiven auf das Sterben zu beleuchten und stellt die zentrale Frage nach der Bedeutung des eigenen Todes im Kontext des 20. Jahrhunderts in der westlichen Literatur. Die Arbeit kündigt die methodische Vorgehensweise an, die auf der Analyse der Merkmale der „Sterbeerzählung“ nach Andreas Mauz basiert und einen Vergleich beider Texte vornimmt.
Elemente der Sterbeerzählung: Dieses Kapitel analysiert die Merkmale der Sterbeerzählung nach Andreas Mauz und wendet diese auf Neapel sehen an. Es wird zwischen präsentativer und reflexiver Sterbeerzählung unterschieden. Während die präsentative Form die leiblichen und psychischen Aspekte des Sterbens betont, konzentriert sich die reflexive Form auf die philosophische und theologische Auseinandersetzung mit dem Tod. Das Kapitel argumentiert, dass Neapel sehen eine Mischform aus beiden darstellt, da der Sterbeprozess zwar nur implizit geschildert wird, das Thema Tod aber dennoch im Mittelpunkt steht. Die Analyse von Mauz dient als Grundlage für den Vergleich mit Spiegelgeschichte.
Schlüsselwörter
Sterbeerzählung, Kurt Marti, Ilse Aichinger, Neapel sehen, Spiegelgeschichte, Tod, Sterben, Gesellschaftskritik, Selbstreflexion, Literaturwissenschaft, Andreas Mauz, existenzialistische Bewegung, präsentative Erzählweise, reflexive Erzählweise, Diskursanalyse.
Häufig gestellte Fragen zu der Analyse von "Neapel sehen" und "Spiegelgeschichte"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Sterbeprozessen in Kurt Martis Kurzgeschichte "Neapel sehen" und Ilse Aichingers "Spiegelgeschichte". Im Fokus steht die Untersuchung der literarischen Strategien, mit denen die Autoren das Thema Tod und Sterben behandeln und wie diese Erzählungen in den Diskurs um die "Sterbeerzählung" einzuordnen sind.
Welche Ziele verfolgt die Analyse?
Die Arbeit zielt darauf ab, die literarischen Strategien der Autoren bei der Darstellung des Todes zu analysieren und die Erzählungen im Kontext der "Sterbeerzählung" einzuordnen. Der Schwerpunkt liegt auf der literaturwissenschaftlichen Analyse, wobei philosophische Ansätze nur im Kontext betrachtet werden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Analyse umfasst die Charakterisierung von "Sterbeerzählungen" nach Andreas Mauz, einen Vergleich der präsentativen und reflexiven Elemente in beiden Erzählungen, die Rolle der Gesellschaftskritik, die literaturgeschichtliche Einordnung im Kontext des Umgangs mit dem Tod im 20. Jahrhundert und die Analyse der Selbstreflexion der Protagonisten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Elementen der Sterbeerzählung, ein Kapitel zur Darstellung des Sterbeprozesses in beiden Texten, ein Fazit und ein Literaturverzeichnis. Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die methodische Vorgehensweise vor. Das Kapitel zu den Elementen der Sterbeerzählung analysiert die Merkmale nach Andreas Mauz und wendet diese auf "Neapel sehen" an. Das Kapitel zur Darstellung des Sterbeprozesses vergleicht die beiden Erzählungen.
Welche Methode wird angewendet?
Die Analyse basiert auf der Theorie der "Sterbeerzählung" nach Andreas Mauz. Es wird zwischen präsentativer und reflexiver Sterbeerzählung unterschieden und ein Vergleich der beiden Erzählungen anhand dieser Kategorien durchgeführt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Sterbeerzählung, Kurt Marti, Ilse Aichinger, "Neapel sehen", "Spiegelgeschichte", Tod, Sterben, Gesellschaftskritik, Selbstreflexion, Literaturwissenschaft, Andreas Mauz, existenzialistische Bewegung, präsentative Erzählweise, reflexive Erzählweise, Diskursanalyse.
Wie wird der Tod in den Erzählungen dargestellt?
Die Arbeit untersucht, wie der Sterbeprozess in "Neapel sehen" und "Spiegelgeschichte" literarisch dargestellt wird. Dabei wird der Fokus auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Erzählungen gelegt und die jeweiligen literarischen Strategien analysiert.
Welche Rolle spielt die Gesellschaftskritik?
Die Analyse untersucht, inwieweit die Darstellung des Sterbens in den beiden Erzählungen gesellschaftkritische Aspekte aufweist und wie diese Aspekte im Kontext des 20. Jahrhunderts zu verstehen sind.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Sterbeprozesse in Ilse Aichingers "Spiegelgeschichte" und Kurt Martis "Neapel sehen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1331594