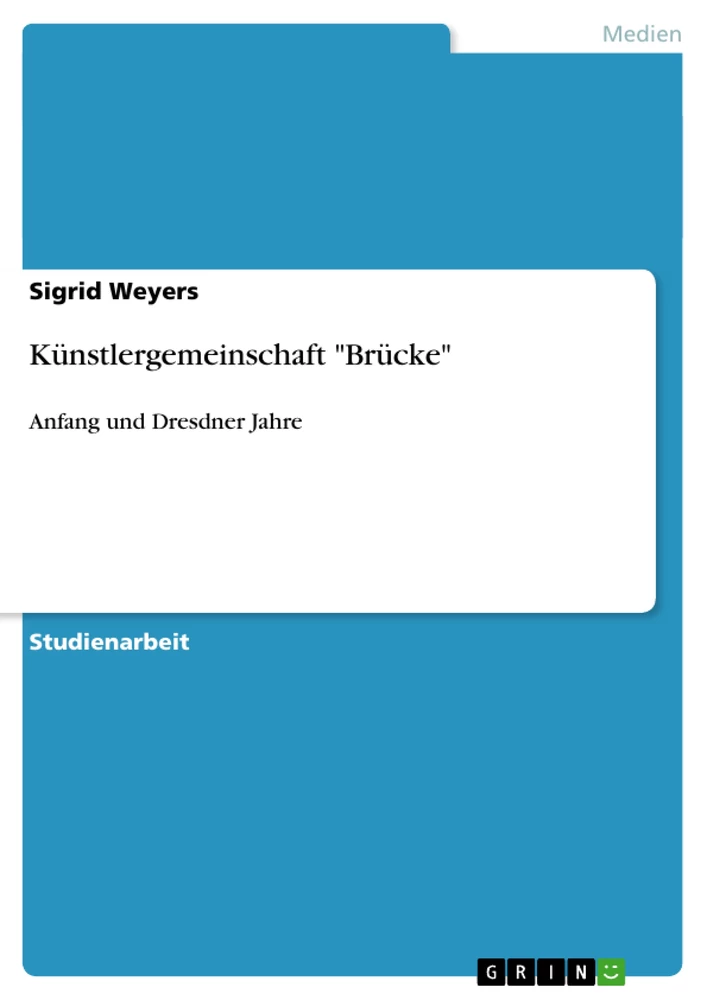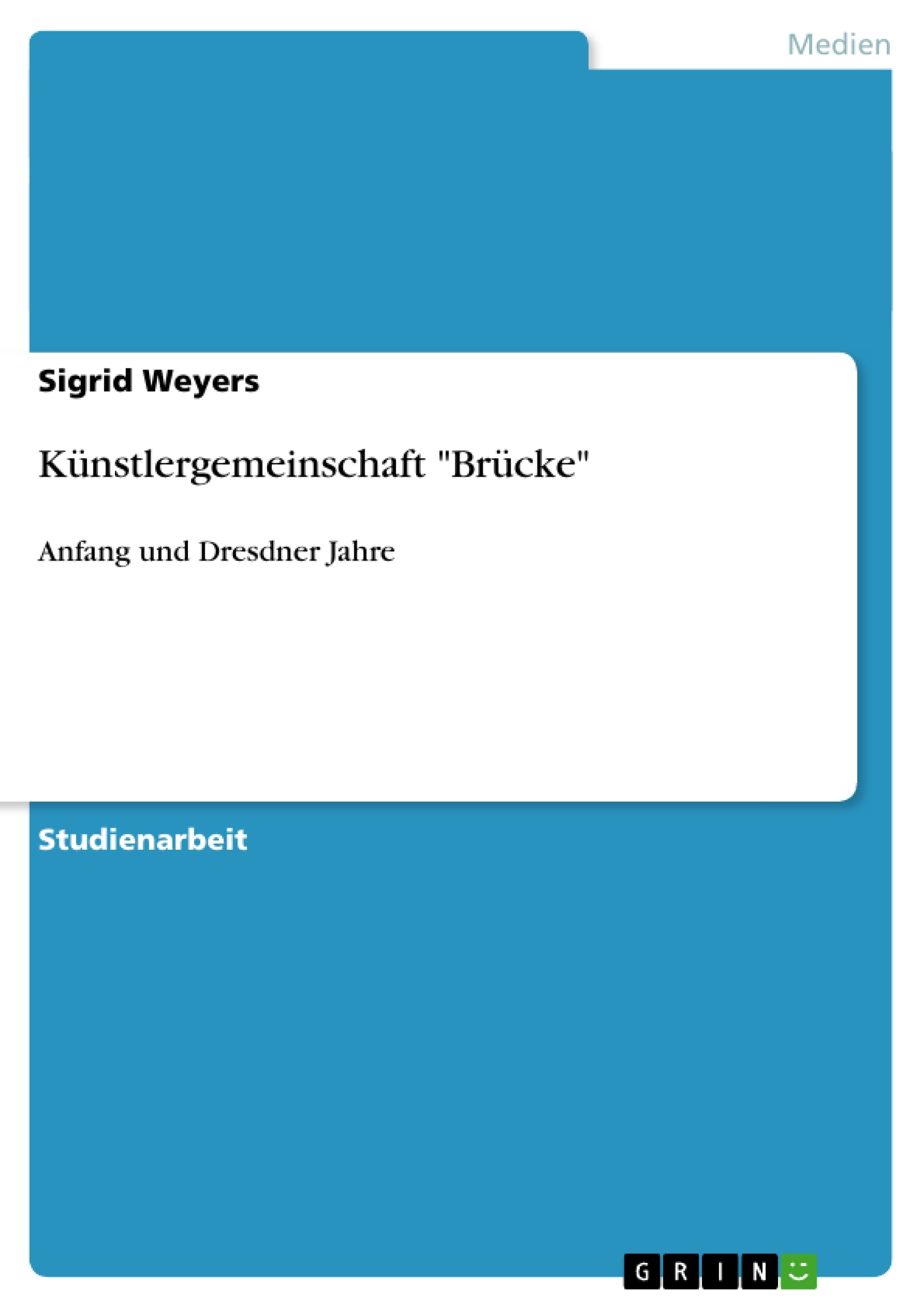Um die Jahrhundertwende ist Dresden königliche Residenz; Beamte und Pensionäre prägen das städtische Leben. Mit Beginn der Industrialisierung wächst in den Randbezirken der Bevölkerungsanteil der Arbeiter und kleinen Handwerker. In den ersten Jahre des 20. Jh. verschärfen sich die sozialen Konflikte, Demonstrationen, Streiks und Aussperrungen bestimmen die politische Situation; Höhepunkt ist der bewaffnete Einsatz der Gendarmerie gegen demonstrierende Arbeiter im Jahr 1905.
Im liberalen Bürgertum finden lebensreformerische Gedanken in vielfältiger Form eine wachsende Zahl von Anhängern: Gleichberechtigung der Frauen, Bodenreform und Sozialprogramme, gesundes Leben, freie Schulen... Das kulturelle Leben der Stadt ist rege, im Theater stehen mit Hauptmann, Ibsen, Gorki und Tschechow, die Dramatiker des Naturalismus, auf dem Programm; 1905 gelangt die Oper "Salome" von Richard Strauss zur Uraufführung. Allerdings gibt es auch gegenläufige Strömungen im Reich: Die Weltausstellung 1889 in Paris, ganz im Zeichen des Gedenkens an die französische Revolution, wird vom Deutschen Reich offiziell boykottiert.
Aber die künstlerische Opposition formiert sich: 1893 wird die Dresdner Sezession gegründet, nur ein Jahr nach der Münchner Sezession, die Berliner Sezession wird erst 1898 folgen. In Dresden zeigen die Galeristen Ernst Arnold und Emil Richter Werke von Vincent van Gogh und Paul Gauguin und beeinflussen damit maßgeblich die junge Künstlergeneration der Stadt.
Am 7. Juni 1905 schließen sich vier Studenten der Technischen Hochschule Dresden zur Künstlergemeinschaft “Brücke” zusammen. Ernst Ludwig Kirchner und Fritz Bleyl kennen sich bereits seit 1901 und stehen unmittelbar vor dem Abschluss ihres Architekturstudiums, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff haben ihr Studium dagegen gerade erst aufgenommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Dresden zu Beginn des 20. Jahrhunderts
- 2 Die Gründung der Künstlergemeinschaft “BRÜCKE”
- 2.1 Programm und Ziele
- 2.2 Impulse, Anregungen, Vorbilder
- 2.3 Auf der Suche nach dem Ursprünglichen
- 2.3.1 Dangast und Moritzburger Seen
- 2.4 Die Druckgraphik
- 3 Die Repräsentanten der BRÜCKE
- 3.1 Ernst Ludwig Kirchner
- 3.2 Fritz Bleyl
- 3.3 Erich Heckel
- 3.4 Karl Schmidt-Rottluff
- 3.5 Max Pechstein
- 3.6 Otto F. Mueller
- 3.7 Emil Nolde, Cuno Amiet, Franz Nölken, Akseli Gallén-Kallela, Lambertus Zijl, Bohumil Kubišta
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und die frühen Jahre der Künstlergemeinschaft „Brücke“ in Dresden. Sie beleuchtet den Kontext der Gründung innerhalb des gesellschaftlichen und künstlerischen Klimas der Stadt um 1900 und analysiert die Ziele und das Programm der Künstlergruppe. Ein weiterer Fokus liegt auf den wichtigsten Künstlern der „Brücke“ und ihrer individuellen Beiträge zur Entwicklung des künstlerischen Stils.
- Dresden um 1900: Sozialer und kultureller Kontext der „Brücke“-Gründung
- Die Programmatik und Ziele der Künstlergemeinschaft „Brücke“
- Einflüsse und Vorbilder der „Brücke“-Künstler
- Die künstlerische Entwicklung der „Brücke“-Mitglieder
- Die Bedeutung der Druckgraphik für die „Brücke“
Zusammenfassung der Kapitel
1 Dresden zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Das Kapitel beschreibt Dresden um die Jahrhundertwende als königliche Residenz, geprägt von Beamten und Pensionären, aber auch vom wachsenden Einfluss der Industrialisierung und der damit einhergehenden sozialen Spannungen. Die Depressionen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts führten zu sozialen Konflikten, die durch Demonstrationen und Streiks gekennzeichnet waren. Gleichzeitig gab es im liberalen Bürgertum Bestrebungen nach Reformen im sozialen und kulturellen Bereich. Das Kapitel hebt den Kontrast zwischen dem offiziellen Boykott der Pariser Weltausstellung 1889 durch das Deutsche Reich und dem Wirken deutscher Künstler wie Max Liebermann hervor. Es verdeutlicht auch die Entstehung der Dresdner Sezession 1893 als Reaktion auf die akademischen Strukturen und deren Einfluss auf junge Künstler wie Erich Heckel, der später zur „Brücke“ gehören wird. Die Galeristen Ernst Arnold und Emil Richter und ihre Präsentation von Werken von Van Gogh und Gauguin werden als wichtige Einflüsse auf die junge Künstlergeneration hervorgehoben. Das Kapitel endet mit der Auflösung der Dresdner Sezession 1901, die den Weg für die Gründung der „Brücke“ ebnet.
Schlüsselwörter
Künstlergemeinschaft Brücke, Dresden, Jugendstil, Expressionismus, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein, Druckgraphik, Sezession, soziale und kulturelle Bedingungen, Moderne Kunst, Van Gogh, Gauguin.
Häufig gestellte Fragen: Entstehung und Frühgeschichte der Künstlergemeinschaft „Brücke“ in Dresden
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die Entstehung und die frühen Jahre der Künstlergemeinschaft „Brücke“ in Dresden. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Kontext der Gründung, den Zielen und dem Programm der Gruppe, sowie den wichtigsten Künstlern und ihren individuellen Beiträgen zur Entwicklung des künstlerischen Stils.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text ist in mehrere Kapitel gegliedert: Kapitel 1 behandelt Dresden zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Kapitel 2 befasst sich mit der Gründung der Künstlergemeinschaft „Brücke“, ihren Zielen, Einflüssen und der Druckgraphik. Kapitel 3 stellt die wichtigsten Repräsentanten der „Brücke“ vor.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte des Textes?
Die Arbeit untersucht die Entstehung und die frühen Jahre der „Brücke“ in Dresden. Sie beleuchtet den Kontext der Gründung im gesellschaftlichen und künstlerischen Klima um 1900, analysiert die Ziele und das Programm der Gruppe und konzentriert sich auf die wichtigsten Künstler und ihre individuellen Beiträge zum künstlerischen Stil. Besondere Aufmerksamkeit wird dem sozialen und kulturellen Kontext Dresdens um 1900, der Programmatik der „Brücke“, den Einflüssen und Vorbildern der Künstler, deren künstlerischer Entwicklung und der Bedeutung der Druckgraphik gewidmet.
Welche Künstler werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die wichtigsten Künstler der „Brücke“, darunter Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein, Otto F. Mueller. Zusätzlich werden Emil Nolde, Cuno Amiet, Franz Nölken, Akseli Gallén-Kallela, Lambertus Zijl und Bohumil Kubišta erwähnt.
Welche Rolle spielte Dresden um 1900 bei der Entstehung der „Brücke“?
Kapitel 1 beschreibt Dresden um die Jahrhundertwende als einen Ort mit sozialen Spannungen zwischen dem traditionellen, königlichen Umfeld und der aufkommenden Industrialisierung. Die sozialen Konflikte, die liberalen Reformbestrebungen und der Einfluss von Künstlern wie Max Liebermann und Galeristen wie Ernst Arnold und Emil Richter, die Werke von Van Gogh und Gauguin präsentierten, werden als wichtige Faktoren für die Entstehung der „Brücke“ im Kontext der Auflösung der Dresdner Sezession im Jahr 1901 hervorgehoben.
Welche Bedeutung hatte die Druckgraphik für die „Brücke“?
Der Text hebt die Bedeutung der Druckgraphik für die „Brücke“ hervor und behandelt dies als einen wichtigen Aspekt der künstlerischen Entwicklung der Gruppe. Weitere Details dazu sind im Kapitel über die Gründung der „Brücke“ zu finden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Künstlergemeinschaft Brücke, Dresden, Jugendstil, Expressionismus, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein, Druckgraphik, Sezession, soziale und kulturelle Bedingungen, Moderne Kunst, Van Gogh, Gauguin.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist übersichtlich gestaltet und beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Diese Struktur ermöglicht einen schnellen Überblick über den Inhalt und die Kernaussagen.
- Quote paper
- M. A. Sigrid Weyers (Author), 2005, Künstlergemeinschaft "Brücke", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133080