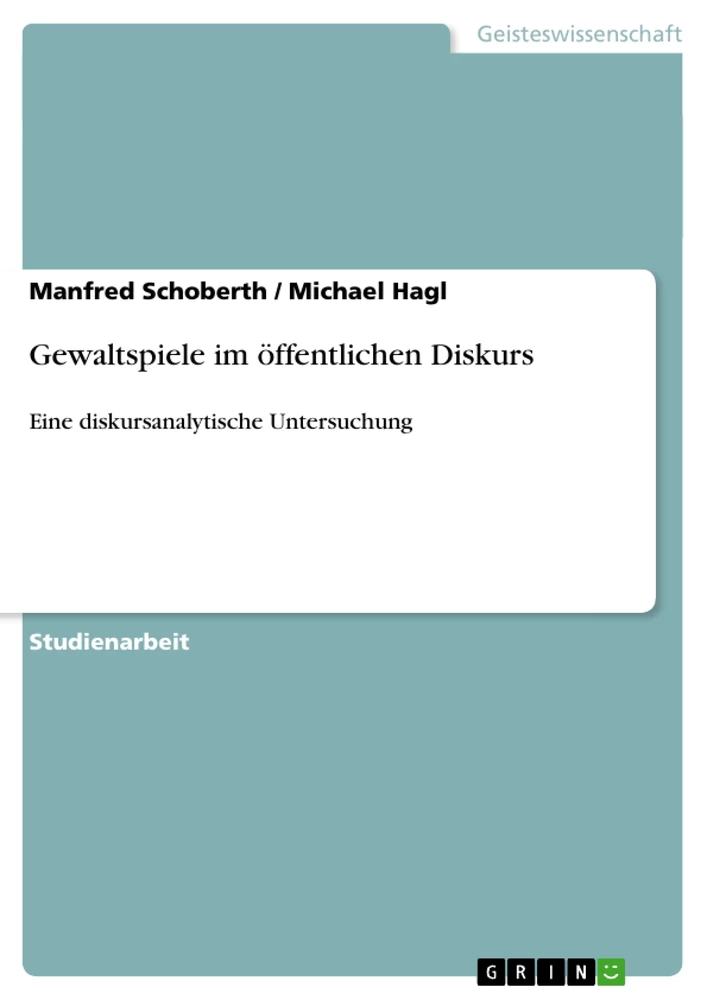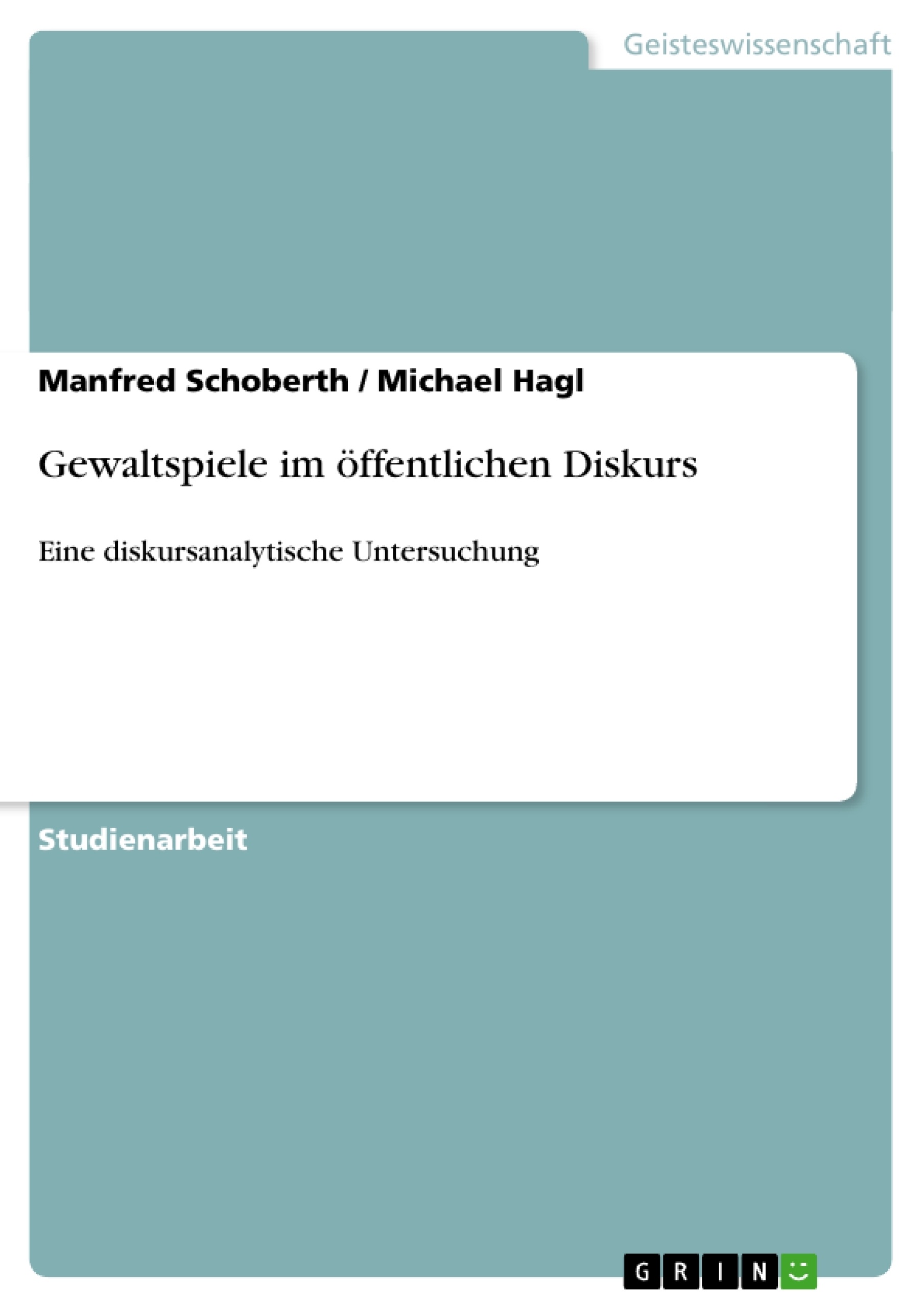Seit den Amokläufen von Emsdetten und Winnenden ist in Deutschland eine nie dagewesene Debatte um und über gewalthaltige Computerspiele entfacht, die schließlich zur Beschränkung der rechtsstaatlichen Verfugnisse jugendlicher und volljähriger Spieler führen sollte. In dieser Arbeit werden die Grundstrukturen jenes Diskurses um die durch Politik und Medien ins Leben gerufenen "Killerspiele" analysiert, und daraus Rückschlüsse auf Funktionsweise und gesamtgesellschaftliches Zusammenwirken von massenmedialer Repräsentation und Gesetzgebung gewonnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Diskursanalytische Vorgehensweise
- Der Diskurs in der Sozialforschung
- Ansätze der Diskursforschung
- Der Datenkorpus
- Computergestützte Verfahren der Datenanalyse
- Auswertung
- Kontra-Positionen
- Differenzierende Positionen
- Zusammenfassung und Interpretation
- Schlussbetrachtung
- Quellenverzeichnis
- Anhang: Datenmaterial
- (www: 1) Killerspiele verbieten - Das ist der falsche Reflex
- (www: 2) Eine Frage der Moral
- (www: 3) Wer aggressiv ist, spielt mehr
- (www: 4) Interview mit Dr. Peter Vorderer
- (www: 5) Expertenstreit um Killerspiele?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der diskursanalytischen Untersuchung des öffentlichen Diskurses über Gewaltspiele. Ziel ist es, die Struktur und Funktionsweise dieses Diskurses zu analysieren und die darin enthaltenen Deutungsmuster zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich dabei nicht auf die Spiele selbst, sondern auf die gesellschaftliche Debatte, die durch sie ausgelöst wird.
- Die Rolle von Gewaltspielen im öffentlichen Diskurs
- Die Konstruktion von Deutungsmustern im Zusammenhang mit Gewaltspielen
- Die Funktionen und Bedeutungen des Diskurses über Gewaltspiele
- Die unterschiedlichen Positionen im Diskurs über Gewaltspiele
- Die Auswirkungen des Diskurses auf die Wahrnehmung von Gewaltspielen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Gewaltspiele im öffentlichen Diskurs ein und beleuchtet die Relevanz des Themas vor dem Hintergrund aktueller Ereignisse. Sie stellt den Zusammenhang zwischen Gewaltspielen und jugendlicher Gewalt her und skizziert die Forschungsfrage der Arbeit.
Das Kapitel "Die Diskursanalytische Vorgehensweise" erläutert die theoretischen Grundlagen der Diskursanalyse und ihre Bedeutung für die qualitative Sozialforschung. Es werden verschiedene Ansätze der Diskursforschung vorgestellt und die spezifische Vorgehensweise der Arbeit erläutert.
Das Kapitel "Auswertung" präsentiert die Ergebnisse der diskursanalytischen Untersuchung. Es werden verschiedene Positionen im Diskurs über Gewaltspiele identifiziert und analysiert, wobei ein besonderer Fokus auf die Kontra- und Differenzierungspositionen gelegt wird.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den öffentlichen Diskurs, Gewaltspiele, Diskursanalyse, Deutungsmuster, Kontra-Positionen, Differenzierungspositionen, Medienwirkung, Jugendgewalt, Soziologie, qualitative Sozialforschung.
- Quote paper
- Manfred Schoberth (Author), Michael Hagl (Author), 2008, Gewaltspiele im öffentlichen Diskurs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133044