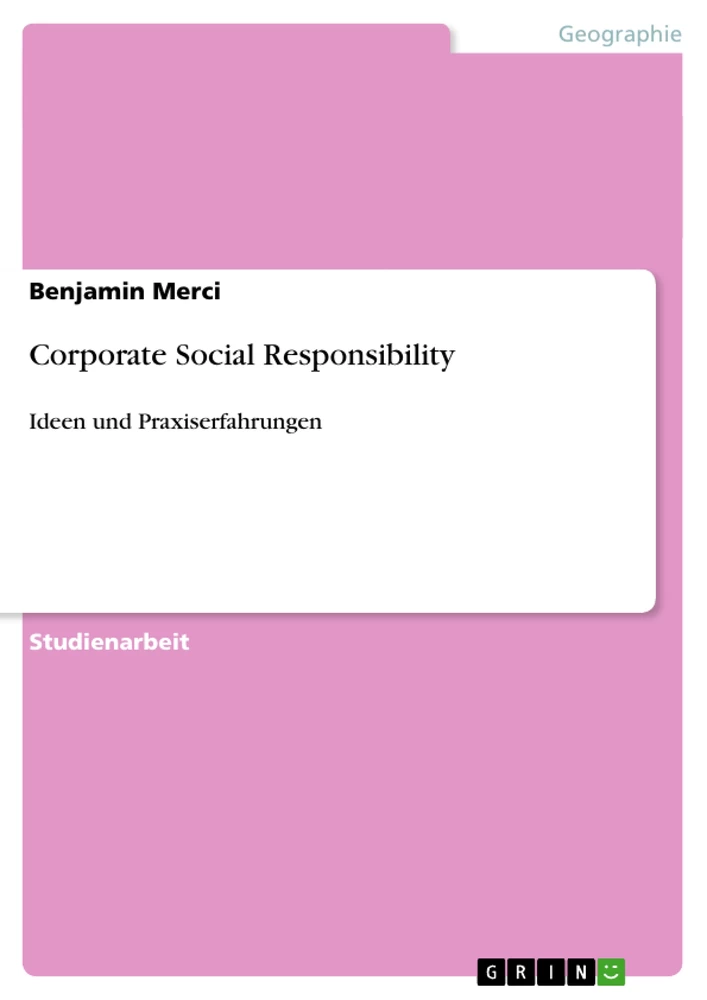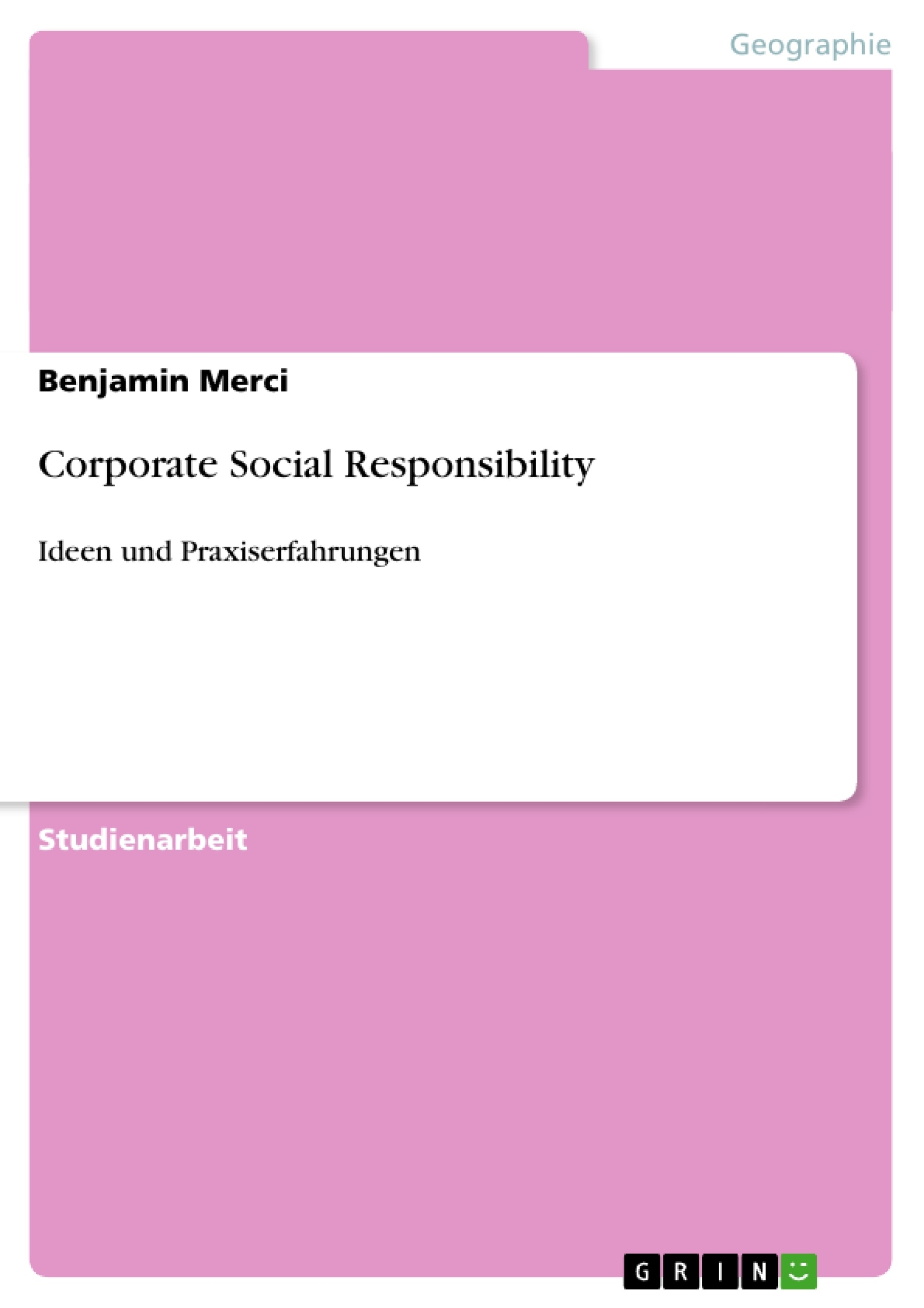Der Begriff Corporate Social Responsibility verbindet das Thema Wirtschaft und Ethik. Denn Wirtschaften ist ein Handeln und von Menschen wird schon immer erwartet moralisch zu handeln. Warum sollte das die Wirtschaft nicht auch tun, wo doch die Wirtschaft letztendlich auch eine Handlung von Menschen ist? Dementsprechend hat Corporate Social Responsibility durchaus einen sehr aktuellen Bezug. Denn auch in Deutschland hat das Handeln von Unternehmen in den letzen Jahren und Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Schmiergeldskandale bei Siemens, Bespitzelungsaffären bei der deutschen Bahn und LIDL oder die Auflösung des Bochumer Werks von Nokia 2008 sind nur einige bekannte Beispiele. International sieht es nicht anders aus. Oft sind es transnationale Konzerne, denen unmoralisches Handeln vorgeworfen wird. Gerechtfertigt wird dieses Verhalten mit dem globalen Wettbewerb, der einen großen Konkurrenzdruck auf die Unternehmen ausübt und das sie sich in ihrem Handeln an den jeweiligen institutionellen Rahmen halten. Bleibt also im Konkurrenzkampf noch Platz für Ethik? Haben Unternehmen eine größere Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft, als es rechtlich festgelegt ist? Stehen Unternehmen in der Verantwortung, Regulierungslücken zwischen Staat und Gesellschaft nicht eher sogar zu schließen als auszunutzen? CSR-Befürworter sehen das so. Denn immerhin haben heutzutage transnationale Unternehmen teilweise soviel Macht, dass sie Staaten politisch und wirtschaftlich beeinflussen können (DETOMASI 2008). Aber entstehen durch altruistisches Verhalten nur Mehrkosten für Unternehmen oder kann es auch zwecks Eigennutzes eingesetzt werden? Verliert also ein Unternehmen, das freiwillig Standards anhebt den Anschluss an den Wettbewerb oder muss es sich CSR in Zukunft sogar leisten um nicht den Anschluss zu verlieren? Ziel ist es herauszufinden ob es einen Zusammenhang zwischen Corporate Social Responsibility und Corporate Financial Performance gibt? Wie es in dem Titel von Antje Bulmann heisst: Ist mit einem Zuwachs an Werten auch ein Mehrwert für das Unternehmen verbunden? Können beide Seiten, Gesellschaft und Wirtschaft, von CSR profitieren, wie auch Habisch (2006) in seinem Aufsatz „Gesellschaftliches Engagement als Win-Win-Szenario“ andeutet?
Gliederung
1. Einleitung
2. Definition von Corporate Social Responsibility
3. Der Stakeholder-Ansatz
4. Global Compact
5. Einflussfaktoren auf Corporate Social Responsibility
5.1 Treiber
5.2 Motive
6. Zahlt sich Corporate Social Responsibility auch für Unternehmen aus?
7. Praxiserfahrungen
7.1 Das Beispiel Chiquita
7.2 Das Beispiel Henkel
8. Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang
1. Einleitung:
Der Begriff Corporate Social Responsibility verbindet das Thema Wirtschaft und Ethik. Denn Wirtschaften ist ein Handeln und von Menschen wird schon immer erwartet moralisch zu handeln. Warum sollte das die Wirtschaft nicht auch tun, wo doch die Wirtschaft letztendlich auch eine Handlung von Menschen ist? Dementsprechend hat Corporate Social Responsibility durchaus einen sehr aktuellen Bezug. Denn auch in Deutschland hat das Handeln von Unternehmen in den letzen Jahren und Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Schmiergeldskandale bei Siemens, Bespitzelungsaffären bei der deutschen Bahn und LIDL oder die Auflösung des Bochumer Werks von Nokia 2008 sind nur einige bekannte Beispiele. International sieht es nicht anders aus. Angefangen bei den Banken, die unnachhaltig gewirtschaftet haben, bis hin zu Umweltskandalen und Menschenrechtsverletzungen in Form von Kinderarbeit in der Bekleidungsindustrie. Oft sind es transnationale Konzerne, denen unmoralisches Handeln vorgeworfen wird. Dies äußert sich in der Suche nach Produktionsstandorten, die nur geringe Umweltschutz- und Rechtsauflagen vorweisen, dementsprechend mit geringen Produktionskosten verbunden sind. Möglich gemacht hat das die Globalisierung, die den Unternehmen gestattete sich nationalstaatlicher Kontrolle weitestgehend zu entziehen, indem sie Produktionsstandorte auf verschiedene Länder verteilen und somit Regulierungslücken ausnutzen. Gerechtfertigt wird dieses Verhalten mit dem globalen Wettbewerb, der einen großen Konkurrenzdruck auf die Unternehmen ausübt und das sie sich in ihrem Handeln an den jeweiligen institutionellen Rahmen halten. Bleibt also im Konkurrenzkampf noch Platz für Ethik? Haben Unternehmen eine größere Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft, als es rechtlich festgelegt ist? Stehen Unternehmen in der Verantwortung, Regulierungslücken zwischen Staat und Gesellschaft nicht eher sogar zu schließen als auszunutzen? CSR-Befürworter sehen das so. Denn immerhin haben heutzutage transnationale Unternehmen teilweise soviel Macht, dass sie Staaten politisch und wirtschaftlich beeinflussen können (DETOMASI 2008). Aber entstehen durch altruistisches Verhalten nur Mehrkosten für Unternehmen oder kann es auch zwecks Eigennutzes eingesetzt werden? Verliert also ein Unternehmen, das freiwillig Standards anhebt den Anschluss an den Wettbewerb oder muss es sich CSR in Zukunft sogar leisten um nicht den Anschluss zu verlieren? Denn die Globalisierung ermöglicht auch bessere Möglichkeiten Informationen schneller zu verbreiten, sei es durch Nachrichten oder globalisierungskritische Dokumentationsfilme, wie beispielsweise „Der große Ausverkauf“ oder „Der Kleiderhaken“. Die Globalisierung hat auch das Potenzial geschaffen Praktiken von Unternehmen aufzudecken und in das öffentliche Bewusstsein zu rücken.
Ziel ist es herauszufinden ob es einen Zusammenhang zwischen Corporate Social Responsibility und Corporate Financial Performance gibt? Wie es in dem Titel von Antje Bulmann heisst: Ist mit einem Zuwachs an Werten auch ein Mehrwert für das Unternehmen verbunden? Können beide Seiten, Gesellschaft und Wirtschaft, von CSR profitieren, wie auch Habisch (2006) in seinem Aufsatz „Gesellschaftliches Engagement als Win-Win-Szenario“ andeutet?
2. Definition von Corporate Social Responsibility
Eine Definition für Corporate Social Responsibility zu finden ist schwer. Wörtlich übersetzt bezeichnet CSR die unternehmerische gesellschaftliche Verantwortung. Sie ist allerdings nicht verpflichtend, sondern freiwillig. Dabei ist zu beachten, dass der Begriff „social“ nicht fälschlicherweise mit „sozial“ (wie bei der Definition der Europäischen Union geschehen) übersetzt wird (vgl. LOEW et al. 2004: 26). Eine Übersetzung mit „sozial“ würde eine Betonung auf soziale Verantwortung suggerieren. Soziale und ökologische Belange sind bei CSR allerdings gleichermaßen bedeutsam. Wie eingangs angedeutet variiert die Wahrnehmung von unternehmerischer Verantwortung. Da die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen sowohl die Bereiche Gesellschaft und Wirtschaft anspricht, beschäftigen sich nicht nur die Wirtschaftswissenschaften mit CSR. Aus der Anzahl von Standpunkten ergeben sich natürlich viele unterschiedliche Definitionen des Begriffs. Wo der Ökonom Milton Friedmann die unternehmerische Verantwortung einzig und allein darin sah, die Unternehmensprofite zu erhöhen, sie also als eine rein ökonomische Verantwortung gegenüber Unternehmen und Eigentümern wahrnahm, gibt es auch andere Auffassungen von unternehmerischer Verantwortung. Denn auch andere Akteure haben ein Interesse am Verhalten des Unternehmens. Carrol sieht die unternehmerische gesellschaftliche Verantwortung darin, im Rahmen der rechtlichen und ethischen Gegebenheiten zu wirtschaften und über diese hinaus, freiwilligen Leistungen nachzugehen, die über das gesetzlich verankerte und verlangte hinausgehen. Abbildung 1 verdeutlicht, wie diese vier Teilbereiche (Ökonomie, Recht, Ethik und Philanthropie) in Zusammenhang stehen. Obwohl aufeinander aufbauend sind die vier Bereiche nach Carrol nicht zu trennen, sondern stehen in einem „unabdingbaren Zusammenhang“ miteinander (BÖRGER 2007: 7). Beispielsweise können Wohltätigkeitsveranstaltungen veranstaltet werden um indirekt ökonomischen Nutzen aus ihnen zu ziehen. Holme und Watts sehen CSR unter anderem als „commitment by business to behave…ethically…while improving the quality…of the local community and society at large” (WÜHLE 2007: 6).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: The Pyramid of Corporate Social Responsibility (BÖRGER 2007: 7)
2001 hat die die Europäische Union im Grünbuch ebenfalls versucht CSR zu definieren. Demnach sei CSR als „ein Konzept, das den Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis soziale Belange und Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und in die Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern zu integrieren“ (Europäische Kommission in: LOEW et al. 2004: 26). Mit Stakeholdern sind Anspruchsgruppen gemeint. Auf den Begriff der Stakeholder wird in Kapitel 3 genauer eingegangen.
Der Anspruch an unternehmerische Verantwortung kann also ökonomisch, normativ oder aus Sicht der Stakeholder definiert werden. Der ökonomische Ansatz sieht die Verantwortung einzig und allein darin, mit der Produktion von Gütern und Dienstleitungen Gewinne für seine Eigenkapitalgeber (Shareholder) zu maximieren und ein Unternehmen wirtschaftlich nachhaltig zu gestalten. Diese Ansicht wird auch „Shareholder-Value“ genannt, in der sich das Unternehmen nur gegenüber seinen Eigenkapitalgebern in der Verantwortung sieht und sich nach deren Interessen richtet. Im normativen Ansatz besteht der Grundgedanke darin, Unternehmen als Teil einer Gesellschaft zu verstehen, die in der Lage sind, diese aktiv zu gestalten. Wie in der Einleitung hingewiesen, hat sich das Rollenverständnis von Unternehmen in der Gesellschaft geändert. Sie treten neben ihrer wirtschaftlichen Funktion auch als soziale Akteure mit gesellschaftlicher Verantwortung auf (WÜHLE 2007: 6). Vor dem Hintergrund, dass einige Unternehmen heutzutage ein höhere Wertschöpfung erwirtschaften als ganze Staaten, ist dies durchaus nachvollziehbar (DETOMASI 2008: 808). Die unternehmerische Machtposition wird daher von CSR-Befürwortern als ein Argument herangezogen soziale und ökologische Verpflichtungen wahrzunehmen. Zum Beispiel können durch staatliche Versäumnisse in Gesetzgebungen Lücken entstanden sein, die Unternehmen rechtlich ausnutzen könnten. CSR wird als unternehmerisches Engagement angesehen, das über die implizit und explizit festgelegten Regeln der Institutionen hinausgeht und mit den Konventionen der Gesellschaft vereinbar ist. Konkrete CSR-Maßnahmen können Spenden, die Einführung besserer Arbeits- oder Produktionsbedingungen oder auch das Sponsoring von Sport- oder Kulturvereinen sein (BÖRGER 2007: 11).
Letztendlich gibt es zwar Bemühungen um eine einheitliche Definition, dennoch gibt es im Moment noch keinen Konsens. Das liegt allerdings nicht nur an den dargestellten Positionen. CSR hat auch eine zeitliche und eine räumliche Dimension. Da in vielen Definitionen CSR mit ethischen Werten verbunden wird, ergibt sich logischerweise eine Varianz aus Werten und somit eine ambivalentes Konstrukt. In angloamerikanischen Ländern wird der Begriff der CSR anders aufgefasst als in Kontinentaleuropa (MÜNSTERMANN & MEFFERT 2005). Darüber hinaus unterliegen Werte auch einem stetigen Wandel, wenn man z.B. an die postmaterialistische Werteverschiebung denkt. Beispielsweise wurde der ökologische Nachhaltigkeitsgedanke von CSR auch erst vermehrt in den 80er Jahren in die Diskussion von CSR eingebunden (vgl. MÜNSTERMANN & MEFFERT 2005: ). In Kapitel 4 wird auf die Initiative der Vereinten Nationen eingegangen, mit dem „Global Compact“ eine standardisierte Form von CSR zu formulieren.
3. Der Stakeholder-Ansatz:
Häufig gestellte Fragen
Was ist Corporate Social Responsibility (CSR) laut dieser Analyse?
Diese Analyse zeigt, dass es schwierig ist, eine einzige Definition für Corporate Social Responsibility (CSR) zu finden. Im Wesentlichen handelt es sich um die freiwillige unternehmerische gesellschaftliche Verantwortung. "Social" sollte dabei nicht fälschlicherweise mit "sozial" übersetzt werden, da ökologische Belange ebenso bedeutsam sind. Die Wahrnehmung von CSR variiert, wobei einige, wie Milton Friedman, die Verantwortung einzig in der Gewinnmaximierung sehen, während andere (z.B. Carrol) eine breitere Verantwortung im Rahmen von Recht, Ethik und freiwilligen Leistungen betonen.
Was ist der Stakeholder-Ansatz im Kontext von CSR?
Der Stakeholder-Ansatz erweitert die unternehmerische Verantwortung über die Shareholder hinaus. Er bezieht externe Interessensgruppen wie Beschäftigte, Kunden, Lieferanten, den Staat und die Öffentlichkeit mit ein. Stakeholder sind alle Gruppen oder Einzelpersonen, die von den Zielen des Unternehmens betroffen sind oder diese beeinflussen können.
Welche Rolle spielt die Globalisierung bei CSR?
Die Globalisierung hat sowohl Herausforderungen als auch Chancen für CSR geschaffen. Einerseits ermöglicht sie Unternehmen, Produktionsstandorte mit geringen Umwelt- und Rechtsauflagen zu suchen und sich nationalstaatlicher Kontrolle zu entziehen. Andererseits ermöglicht sie auch eine schnellere Verbreitung von Informationen und die Aufdeckung unethischer Praktiken, was den Druck auf Unternehmen erhöht, sich verantwortungsbewusst zu verhalten.
Was ist das Ziel der Analyse bezüglich CSR und Unternehmensperformance?
Das Ziel ist es herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen Corporate Social Responsibility (CSR) und Corporate Financial Performance gibt. Mit anderen Worten, ob ein Zuwachs an Werten auch einen Mehrwert für das Unternehmen bedeutet und ob Gesellschaft und Wirtschaft von CSR profitieren können.
Welche Beispiele werden für CSR in der Praxis genannt?
Die Analyse verweist beispielhaft auf Schmiergeldskandale bei Siemens, Bespitzelungsaffären bei der Deutschen Bahn und LIDL, die Auflösung des Bochumer Werks von Nokia und Umwelt- und Menschenrechtsskandale, um die Bedeutung von CSR hervorzuheben. Konkrete Beispiele (wahrscheinlich in späteren Kapiteln, die hier nicht extrahiert wurden) sind Chiquita und Henkel.
Was ist der Global Compact?
Der Global Compact ist eine Initiative der Vereinten Nationen, die darauf abzielt, eine standardisierte Form von Corporate Social Responsibility (CSR) zu formulieren.
Warum gibt es keine einheitliche Definition von CSR?
Es gibt keine einheitliche Definition von CSR aufgrund verschiedener Perspektiven (ökonomisch, normativ, Stakeholder), zeitlicher und räumlicher Dimensionen (unterschiedliche Auffassungen in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten) sowie der Verbindung zu ethischen Werten, die sich im ständigen Wandel befinden.
- Quote paper
- Benjamin Merci (Author), 2009, Corporate Social Responsibility, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132920