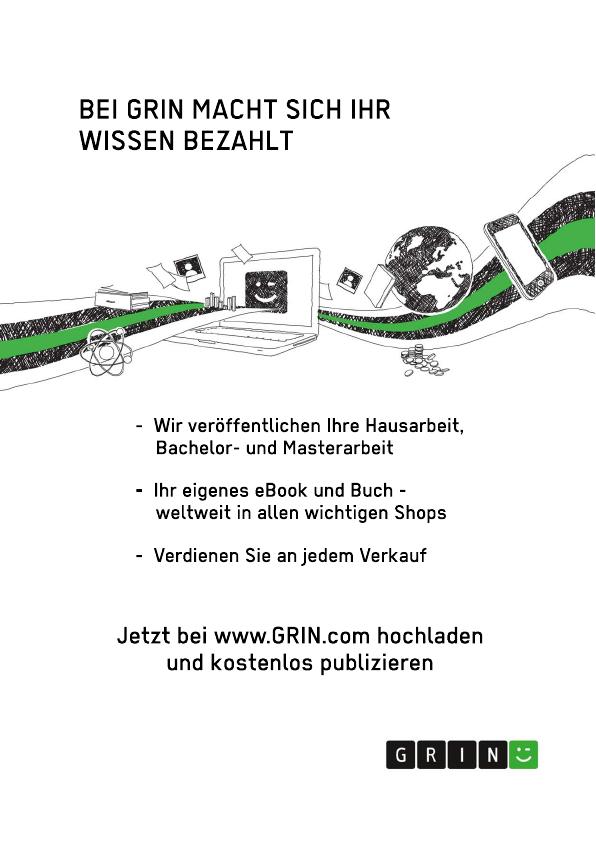Der Begriff Glück wird seit langem unterschiedlich bis kontrovers diskutiert, erklärt oder definiert, und zwar schon in der Antike. Während Platon und Aristoteles dazu auch Allgemeines und Objektives anführen, so zum Beispiel die Idee des Guten, den Lebenszweck und Gemeinschafts-Ziele, pocht Epikur auf das strikt individuelle Lust- und Glücks-Empfinden, das nur in Abwesenheit von Schmerz und Unlust möglich sei. Dieser Auffassung Epikurs schloss sich auch Nietzsche an, wohingegen er die erwähnten Konzepte von Platon und Aristoteles ablehnte.
Worauf beruht die Ambivalenz, die Zwiespältigkeit des Begriffs Glück? Idealerweise wäre dieser Frage an Hand einer umfassenden Analyse des tatsächlichen Wort-Gebrauchs nachzugehen, und zwar einschließlich der zahlreichen semantischen Assoziationen, wie sie z.B. in Wortkombinationen wie ‚Liebesglück‘, ‚Glückauf‘, ‚Hans im Glück‘, ‚Glückspilz‘, ‚Glück im Unglück‘ usw. auftauchen; ganz abgesehen von den Verwendungen in anderen Sprachen und Kulturen, die ebenfalls heranzuziehen wären. Eine solche Analyse würde jedoch den Rahmen meines Themas sprengen. Stattdessen versuche ich, einige sinnfällige Kontroversen, insbesondere philosophischer Art, darzustellen und zu würdigen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Sigmund Freud leugnet das Glück fast vollständig
Aristoteles: dauerhaftes Glück ist möglich
Kants Kritik der aristotelischen Glücksethik
Kants Lehre von der Glückseligkeit
Kritische Würdigung
Utilitaristen streben nach dem größtmöglichen Glück
Zwischenfazit
Jede/r nach ihren/seinen Bedürfnissen, jede/r nach ihren/ seinen Fähigkeiten!
Fazit
Literaturverzeichnis
Einleitung
Der Begriff Glück wird seit langem unterschiedlich bis kontrovers diskutiert, erklärt oder definiert, und zwar schon in der Antike. Während Platon und Aristoteles dazu auch Allgemeines und Objektives anführen, so z.B. die Idee des Guten, den Lebenszweck und Gemeinschafts-Ziele, pocht Epikur auf das strikt individuelle Lust- und Glücks-Empfinden, das nur in Abwesenheit von Schmerz und Unlust möglich sei. Dieser Auffassung Epikurs schloss sich auch Nietzsche an, wohingegen er die erwähnten Konzepte von Platon und Aristoteles ablehnte.
Eine mögliche Ursache der Kontroverse scheint der Dichter Hermann Hesse sogar in der Lautgestalt des Wortes ‚Glück‘ aufzuspüren, wenn er feststellt:
„Ich fand, dieses Wort habe trotz seiner Kürze etwas erstaunlich Schweres und Volles, etwas, was an Gold erinnerte, und richtig war ihm außer der Fülle und Vollwichtigkeit auch der Glanz eigen, wie der Blitz in der Wolke wohnte er in der kurzen Silbe, die so schmelzend und lächelnd mit dem GL begann, im Ü so lachend ruhte und so kurz, und im CK so entschlossen und knapp endete. Es war ein Wort zum Lachen und zum Weinen, ein Wort voll Urzauber und Sinnlichkeit …“.1
Hesse konstatiert also schon in den vier Lauten des Wortes ‚Glück‘ bestimmte Gegensätze, nämlich sowohl Leichtes als auch Schweres, sowohl Lachen als auch Weinen Bewirkendes, dabei stets „voll Urzauber und Sinnlichkeit“. – Was sich allerdings aus der Herkunft des Wortes nicht ableiten lässt. Denn für das mittelhochdeutsche glücke / gelücke wie auch für dessen spätere Verwendungen werden stets nur positive Bedeutungen verzeichnet, so „die günstige Fügung, der günstige Einfall“, danach auch das „Glücksgefühl“, das „persönliche Wohlergehen“ und die „gewünschten Daseinsverhältnisse“.2 Wobei auffällt, dass die ursprüngliche Bedeutung „günstige Fügung“ weitgehend mit der Herkunft des französischen ‚ bonheur‘ aus dem lateinischen ‚bonum augurium‘ (‚gutes Vorzeichen‘) übereinstimmt.
Worauf beruht dann aber die Ambivalenz, die Zwiespältigkeit des Begriffs Glück, die Hermann Hesse ja sogar in dessen Lautgestalt aufweisen will? Idealerweise wäre dieser Frage an Hand einer umfassenden Analyse des tatsächlichen Wort-Gebrauchs nachzugehen, und zwar einschließlich der zahlreichen semantischen Assoziationen, wie sie z.B. in Wortkombinationen wie ‚Liebesglück‘, ‚Glückauf‘, ‚Hans im Glück‘, ‚Glückspilz‘, ‚Glück im Unglück‘ usw. auftauchen; ganz abgesehen von den Verwendungen in anderen Sprachen und Kulturen, die ebenfalls heranzuziehen wären. Eine solche Analyse würde jedoch den Rahmen meines Themas sprengen. Stattdessen werde ich versuchen, einige sinnfällige Kontroversen, insbesondere philosophischer Art, darzustellen und zu würdigen.
Sigmund Freud leugnet das Glück fast vollständig
Und zwar u.a. dadurch, dass er die genannten Gegensätze hervorhebt, nachdem er die grundsätzliche, hohe Bedeutung des Glücks für die Beantwortung der Frage nach Sinn und Zweck des Lebens betont hat:3 Die Menschen „streben nach dem Glück“ – was ja schon in der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 jedem Staatsbürger als verbrieftes Recht eingeräumt wurde. Ähnlich wie Epikur schreibt Freud diesem Streben zwei Richtungen zu: a) die „Abwesenheit von Schmerz und Unlust“ und b) „das Erleben starker Glücksgefühle“, wobei Letzteres der eigentlich wahre Inhalt des Glücksstrebens sei.4
Genau dies stellt Freud jedoch sofort massiv in Frage, indem er einerseits das Lustprinzip zum Grundprinzip jeder auf das Glück gerichteten Zweckdienlichkeit, andererseits aber genau dieses Prinzip für „überhaupt nicht durchführbar“, d.h. ständig vom Realitätsprinzip durchkreuzt, erklärt (a.a.O. S. 74 f.). Um daraus zu folgern: „ … alle Einrichtungen des Alls widerstreben ihm; man möchte sagen: die Absicht, daß der Mensch >glücklich< sei, ist im Plan der >Schöpfung< nicht enthalten.“ (ebd. S. 75).
Hauptgrund: Freud hält dauerhaftes Glück für unerreichbar. Das Wort ‚Schöpfung‘ setzt er in Anführungszeichen, weil er, der überzeugte Atheist, nicht daran glaubt; während er „glücklich“ hier in Anführungszeichen verwendet, um die nachfolgende Differenzierung anzukündigen.
Nur „episodisches“, nicht dauerhaftes Glück hält Freud für Menschen möglich, weil das, was er „im strengsten Sinne Glück“ nennt, nur aus „der eher plötzlichen Befriedigung hoch aufgestauter Bedürfnisse“ entstehen könne. Unerfüllbar sei dagegen, was das Lustprinzip verlangt: die Fortdauer des Glücksgefühls, und zwar schon deshalb nicht, weil „wir nur den Kontrast genießen können, den Zustand nur sehr wenig“ (ebd.), was ja auch Goethe, leicht übertreibend, mit seinem Ausspruch gemeint habe, nichts sei „schwerer zu ertragen als eine Reihe von schönen Tagen“.
Gegenüber dieser angeblich unüberwindlichen, weil konstitutionsbedingten, Schwäche erweisen sich als umso machtvoller die vielfältigen Möglichkeiten, dass Menschen vom Unglück getroffen werden, und zwar
1. vom eigenen, gebrechlichen, dem Tod geweihten Körper her,
2. durch übermächtig wütende Außenwelt-Faktoren und
3. „aus den Beziehungen zu anderen Menschen“ (ebd.).
All diese Leidensquellen hält Freud für „unabwendbar“, auch wenn Menschen immer wieder versuchen, ihnen zu entgehen.
Verständlich wird diese pessimistische Auffassung Freuds erst vor dem Hintergrund seines Menschenbildes, das wesentlich durch seine Trieblehre geprägt ist, darunter vor allem die Gegenüberstellung von Eros und Thanatos – Liebe und Todestrieb. Wobei Freud den zweiten Begriff häufig synonym mit der „Destrudo“, dem von ihm so benannten Aggressions- und Zerstörungstrieb verwendet. Genauer: Er steigert den Zerstörungstrieb phasenartig von der Selbst- und Fremden-Verachtung über den Hass und den Vernichtungswillen bis hin zur „Auflösung des Lebens“, die sodann dem Thanatos, dem Todestrieb, entspricht. Kurios erscheint dabei die Tatsache, dass die genannten Vorstufen des Todestriebs real nachweisbar sind, der Todestrieb selbst jedoch nicht. Auch wenn dieser sich u.a. als „Wiederherstellung des anorganischen Zustands durch die Aufhebung aller Einheiten“ definieren lässt.5 Dieser Trieb wirke nur im Innern, während er sich erst als „Destruktionstrieb“ nach außen wende. Werde dieser Aggresionstrieb nicht nach außen hin ausgelebt, bewirke er die Selbstzerstörung bzw.:
„Zurückhaltung von Aggression ist überhaupt ungesund, wirkt krankmachend (Kränkung).“6
Und Freud vermutet sogar: „ …, das Individuum stirbt an seinen inneren Konflikten, die Art hingegen an ihrem erfolglosen Kampf gegen die Außenwelt, wenn diese sich in einer Weise geändert hat, für die die von der Art erworbenen Anpassungen nicht zureichen.“ (ebd.)
Dieses hybride Gebilde aus Fiktion (Todestrieb) und Wirklichkeit (Destrudo etc.) sieht der Autor in einem labilen Gleichgewicht mit dem Eros bzw. „Lebenstrieb“:
„In den biologischen Funktionen wirken die beiden Grundtriebe gegeneinander oder kombinieren sich miteinander. So ist der Akt des Essens eine Zerstörung des Objekts mit dem Endziel der Einverleibung, der Sexualakt eine Aggression mit der Absicht der innigsten Vereinigung. Dieses Mit- und Gegeneinanderwirken der beiden Grundtriebe ergibt die ganze Buntheit der Lebenserscheinungen. Über den Bereich des Lebenden hinaus führt die Analogie unserer beiden Grundtriebe zu dem im Anorganischen herrschenden Gegensatzpaar von Anziehung und Abstoßung.“ (a.a.O. S. 12)
Wobei zu beachten ist, dass Freud in der anorganischen Materie nicht die Grundlage und Vorstufe des Organischen würdigt, sondern Verfall, Auflösung und Tod als wesentliche Bestimmung des Anorganischen hervorhebt. Nichtsdestoweniger will er den – materiell bedingten – Eros „durch das Studium der Sexualfunktion“ als Lebenstrieb näher bestimmen. Eros wurzele zudem im Unbewussten (Ubw), dem Freud „die allein herrschende Qualität im Es“ zuschreibt (a.a.O. S. 23). Das Es sei die Grundlage des Psychischen, aus dem Ich und Über-Ich erst relativ spät und vor allem durch das Wirken der Außenwelt entstanden seien. Das Es müsse naturwissenschaftlich erklärt werden, z.B. auf Grund seiner Energie-Formen. Doch dies nachzuweisen, war Freud bekanntlich nicht vergönnt. Woraus sich vielleicht seine Forderung erklärt, das Es müsse durch das Ich besetzt und ersetzt werden. („Wo Es war, soll Ich werden.“) – Dass dann aber die Naturwissenschaft erst recht versagt, versteht sich fast von selbst.
Fazit
Freud gelingt es nicht, die „Grundtriebe“ Eros und Thanatos zufriedenstellend zu erklären, denn Letzterer ist nicht nachweisbar, während Eros zunächst im Es und dann im Ich verortet und verankert werden soll, was ebenfalls nicht plausibel ist. Ein weiterer Widerspruch: Eros ist nachweisbar an die angeblich dem Untergang geweihte Materie gebunden, soll aber zugleich als „Lebenstrieb“ fungieren.
Es sind schwerwiegende Mängel, die sich verheerend auch auf Freuds Glücks-Konzepte ausgewirkt haben. Seiner Ablehnung des Schöpfungsgedankens entspricht anscheinend die Tatsache, dass er das Schöpferische im Menschen nicht als Gegengewicht gegen Zerstörungs- und Todestrieb annimmt.7 Was umso schwerer wiegt, als der von Freud aufgewiesene Eros sich als unfähig erweist, ein solches Gegengewicht dauerhaft herzustellen, zumal er in einen Zwiespalt zwischen Es und Ich gerät (s.o.).
Schlimmer noch: Freud berücksichtigt nicht die positiven Faktoren, die zumindest unterschwellig schon bei Aristoteles eine Rolle spielen: die dem Menschen angeborenen Fähigkeiten zur Selbsterhaltung, zum Altruismus und zur kooperativen Gegenseitigkeit, z.B. in der Team-Arbeit, Fähigkeiten, durch die überhaupt erst die wirklich fortschrittlichen historischen Errungenschaften der Menschheit ermöglicht wurden. (Vgl. hierzu die Konzepte z.B. von Ernst Habermann und Joachim Bauer, in: Robra 2022, S. 21 ff.)
Nun mag eingewandt werden, dass doch der Aggressionstrieb ebenso angeboren sei wie die genannten positiven Fähigkeiten. Unübersehbar ist jedoch, dass Letztere in Erziehung und Sozialisation es ermöglichen, den Aggressionstrieb zu kontrollieren, d.h. zu beherrschen und zu sublimieren, mithin auf positive Aktivitäten und Ziele umzuleiten. Allerdings: Dass dies – zumal unter den weltweiten kapitalistischen Bedingungen von Ausbeutung, Ungleichheit, Konkurrenz- und Klassenkampf – immer wieder auf Grenzen stößt, dürfte nicht zu bestreiten sein und bedarf weiterer Überlegungen (s.u.). Leider schlägt das Unglück – auch im Sinne Freuds – (noch) immer wieder zu. Und nicht zu vergessen ist auch, dass Sigmund Freud im 1. Weltkrieg zwei Söhne verloren hat, was einen Teil seines bitteren Pessimismus erklärt.
Aristoteles: dauerhaftes Glück ist möglich
Freud setzt sich deutlich von der Tradition der aristotelischen Glücksethik ab. Für Aristoteles (ca. 384-322 v.Chr.) ist dauerhaftes Glück durchaus möglich, wenn auch nicht mit Garantie. Maßgeblich ist auch für ihn das Menschenbild, das er auf seine Seelen-, Wert- und Tugendlehre gründet, die er eng mit seiner Teleologie, der Lehre von den Zielen und Zwecken, verbindet. Wobei er Teleologie sowohl auf das Sein als auch auf das Erkennen der gesamten Wirklichkeit bezieht. Aus der Teleologie allein kann jedoch nicht auf Wert und Sinn der objektiven und subjektiven Gegenstandswelt geschlossen werden. Handeln kann verweigert werden. Handeln nur um des Handelns willen (wie in einigen Formen von Aktionismus und Voluntarismus) macht wenig oder gar keinen Sinn. Das wusste schon Aristoteles, der sich veranlasst sah, eine Theorie des Wertvollen und des Guten zu entwickeln. Wobei sogleich anzumerken ist, dass Aristoteles die Begriffe ‚Wert‘ und ‚Gut‘ als nahezu gleichbedeutend verwendet (was auch an unterschiedlichen Übersetzungen ins Deutsche, z.B. der Nikomachischen Ethik, zu erkennen ist).
Unmittelbar verständlich wird dabei die Tatsache, dass Aristoteles seine Wertlehre vollständig in seine Ethik integriert hat. Umso mehr interessieren seine Differenzierungen des Wert-Begriffs. Herausfinden will er die „Mittel und Wege zum guten und glücklichen Leben“8, und zwar a) auf Grund von Analysen tatsächlicher Lebensweisen seiner Zeitgenossen und b) auf Grund seiner Seelen-Lehre. Daraus erschließt sich seine dreifache Fundierung der Wertlehre, nämlich in der Lebenspraxis, in der Psychologie und in der Ethik bzw. der Philosophie im Ganzen.
Im ersten und im sechsten Buch der ‚Nikomachischen Ethik‘ begründet Aristo-teles seine Wertlehre anthropologisch. Was den Menschen zum Menschen macht, ist sein „rationaler Seelenteil“ und darin vor allem sein reflektierendes und spekulatives Denkvermögen – die praktische und theoretische Vernunft –, die ihn mit dem Göttlichen verbindet. Getragen und gesteuert wird der rationale Seelenteil von dem entelechetischen „Strebevermögen“, das Aristoteles auch als „Begehrungsvermögen“ kennzeichnet, durchweg als das, was man in der Moderne als den Willen begreift. Das Strebevermögen vermag auch den „unteren“, den irrationalen Seelenteil, zu beeinflussen, zumal hier die Seele als „Form des Körpers“, d.h. als unlösbar mit dem Körper verbunden gilt. Aristoteles unterscheidet mithin drei konstitutive Bestandteile der Seele: das Strebe-vermögen sowie den rationalen und den irrationalen Teil der Seele, Bestandteile, die unlösbar miteinander verbunden und allesamt entelechetisch geprägt sind.9
Im Einzelnen: Der irrationale Seelenteil enthält die animalischen Grund-funktionen wie Sinneswahrnehmung, Ernährung, körperliches Wachstum und Fortpflanzung, d.h. Funktionen, die wir mit allen Lebewesen gemeinsam haben, so dass wir hierin keine uns „eigentümliche Tugend“ entwickeln (ebd.). – Das Strebevermögen bezieht sich auf sämtliche Charaktertugenden (wie Besonnen-heit, Gerechtigkeit, Freundschaft und Sanftmut), die allerdings auch ausarten, d.h. in ihr Gegenteil umschlagen können, sobald die animalischen Triebe des Irrationalen die Oberhand gewinnen, wie z.B. bei Unbesonnenheit, mangelnder Beherrschung usw. Dagegen: „Beim Besonnenen harmoniert das Strebe-vermögen mit dem rationalen Seelenteil …“ (ebd.), so dass die Entelechie des Geistig-Seelischen dazu verhelfen kann, als wertvoll bzw. „gut“ erkannte Ziele zu erreichen. Allerdings nicht naturwüchsig, obwohl die Tendenz zum Guten im Menschen naturhaft angelegt zu sein scheint; notwendig ist vielmehr die Einübung des Strebens zum Wertvollen, nicht zuletzt durch Erziehung.
Dazu bedarf es vor allem der Hilfe des rationalen Seelenteils, der im Wesentlichen aus der theoretischen und der praktischen Vernunft besteht. Die praktische Vernunft, das reflektierende Denken, wertet Erfahrungen aus und ermöglicht dadurch eigenständige Wertungen und damit Handlungskontrolle, auch bei jeglicher Arbeit. Voraussetzung hierfür ist nicht nur fachliches Wissen, sondern auch „sittliche Einsicht“, d.h. die praktische Lebensklugheit, die im Ein-zelfall dazu beiträgt, die richtigen Entscheidungen, diejenigen zu Gunsten des Guten und Wertvollen, zu treffen. Diese Klugheit gilt als „die für die Moralität des normalen Bürgers zentrale Fähigkeit“ (ebd.).
Im Unterschied zur praktischen Vernunft des reflektierenden Denkvermögens bezieht sich die höchste Stufe des rationalen Seelenteils, das spekulative Denkvermögen, nicht auf Veränderliches, sondern auf Unveränderliches wie Konstanten der Gegenstandswelt, Gesetze, bleibende Strukturen bis hin zum Göttlichen. Diese oberste Stufe ist das eigentliche Feld der theoretischen Vernunft und der Verstandestugenden, d.h. der Weisheit (‚sophia‘), der verstandesmäßigen Intuition und der wissenschaftlichen Erkenntnis. Wenn die Umstände es erlauben, können die Geistesstugenden – in Verbindung mit den Charaktertugenden des Strebevermögens – den Menschen zur vollen Entfaltung seiner Fähigkeiten und damit zur Glückseligkeit führen.
Die Fundierung der Wertlehre in der Seelenlehre bedeutet Folgendes: Grund-sätzlich kann der Mensch sich aller drei Seelenteile bedienen, um seine Ziele zu erreichen. Grundsätzlich besteht auch Einigkeit darüber, was dieses Ziel sei: das Glück, ein glückseliges Leben. Nicht einig sind die Menschen sich jedoch darüber, wie dieses – anscheinend oberste – Ziel zu erreichen sei. Aristoteles unterscheidet in dieser Hinsicht klar zwischen drei Personenkreisen: a) der breiten Masse, b) dem „normalen“ Staatsbürger, der aktiv am Leben des Staates, d.h. der Polis teilnimmt und c) den Philosophierenden, die allerdings auch im Personenkreis b) zu finden sind. Überschneidungen gibt es zwischen den Gruppen a) und b), denn Aristoteles stellt fest: „Die vielen … bekunden ganz und gar ihren knechtischen Sinn, da sie sich ein animalisches Dasein aussuchen. Und doch bekommen sie einen Schein von Recht, weil es unter den Hochgestellten so manchen gibt, der ähnliche Passionen hat wie Sardanapal.“ (G. Gerhardt a.a.O. S. 37. Sardanapal war ein superreicher assyrischer König des 7. vorchristlichen Jahrhunderts, dem ein wüst ausschweifendes Leben nachgesagt wurde.) Ein reines Genussleben, d.h.ein Leben zur bloßen Befriedigung des irrationalen Seelenteils, streben also nicht nur die „grobschlächtigen Naturen“ der breiten Masse, sondern gelegentlich auch einige „Hochgestellte“ an.
Wahres Glück ist auf dem Weg des Genusslebens aber nicht zu erlangen. Vielmehr bedarf es einer bestimmten inneren, sittlichen Haltung und eines ent-sprechenden Verhaltens im Umgang mit den Werten, unter denen Aristoteles im Wesentlichen zweierlei versteht: 1. die äußeren Glücksgüter (d.h. vor allem Dinge der Außenwelt) und 2. die „höheren“, geistig-seelischen Werte, die um ihrer selbst erstrebt werden, wobei der oberste Wert etwas zu sein scheint , was „uns zuinnerst zugeordnet und nicht leicht ablösbar ist“ (ebd.). Im Einzelnen meint Aristoteles Folgendes: Alle Menschen bedürfen äußerer Glücksgüter. Auch der sittlich Hochstehende ist auf sie angewiesen. Es sind allerdings Güter von relativem Wert, d.h. die Möglichkeiten ihrer Nutzung hängen „von glücklichen und unglücklichen äußeren Umständen“10 ab. Dies bedeutet: „So viel an diesen Dingen selbst liegt (an Dingen nämlich wie Gold und Eisen und Vieh usw.), sind sie fähig, unter gewissen Umständen nützliche Wirkungen hervorzubringen.“ (ebd.). Es sind praktische Werte, zu denen allerdings nicht nur materielle Güter gehören, sondern auch z.B. Gesetze und Rechtsordnungen.
Problematisch werden die praktischen Werte, sobald sie im Überfluss bzw. Übermaß vorhanden sind, wie z.B. bei unzuträglicher Vielfalt gesetzlicher Regelungen. Es sind Güter bzw. „Wertgegenstände“ von relativer Bedeutung, d.h. „ nicht für jedermann Güter oder Werte“ (ebd.). Solche Überfülle kann nutzlos oder sogar schädlich werden, nämlich „dann, wenn ihrer so viele sind, daß nicht nur ihre Verwertung im Dienste des Guten durch ihren Besitzer unmöglich wird, sondern die Sorge für ihre Erhaltung und Erwerbung ihn von der Verwirklichung der primären Werte abzieht.“ (ebd. S. 29). Eine Überfülle praktischer Werte kann diese selbst zerstören und die Existenz ihrer Besitzer gefährden. Oskar Kraus behauptet in diesem Zusammenhang sogar, es handele sich um Aspekte der „schon oft behandelten antikapitalistischen Lehre des Aristoteles“ (ebd.).
Wie steht es nun mit den „höheren“ Werten, die der edle Mensch aus eigenem Antrieb, also aus einem Selbstzweck heraus und um ihrer selbst willen, anstreben soll? Von solchem Streben sagt Aristoteles, es sei „wertvoll und genußreich zugleich“11. Er warnt also nicht etwa vor jeglichem Genießen, sondern nur vor dem Genuss aus unedlen Motiven, vor dem Genuss um des Genusses willen. Wahres Glück sei nur in einem tugendhaften Leben zu finden, woraus zu schließen sei: „Daher nennen wir billigerweise weder einen Ochsen noch ein Pferd noch sonst ein Tier glückselig. Denn kein Tier ist des Anteils an einer solchen Tätigkeit fähig. Und aus demselben Grunde ist auch kein Kind glückselig, weil es wegen seines Alters noch nicht in der gedachten Weise tätig sein kann, und wenn Kinder hin und wieder doch so genannt werden, so geschieht es in der Hoffnung, daß sie es erst werden. Denn zur Glückseligkeit gehört wie gesagt vollendete Tugend und ein volles Leben. “ (ebd. S. 17, Hervorhebung durch mich). Eine Garantie für dauerhaftes Glück könne es dennoch nicht geben, da Menschen immer wieder, d.h. auch im Alter, schlimmes Leid widerfahren könne.
Was aber meint Aristoteles mit dem „vollen Leben“? (Das ja kein karges, kümmerliches Leben sein kann.) Wir erfahren es erst fast am Ende der ‚Niko-machischen Ethik‘. Tugendhaftes, glückseliges Leben kann nicht in unernstem, leichtfertigem Larifari bestehen, im Gegenteil, es ist „ein Leben ernster Arbeit, nicht lustigen Spiels …“, denn: „Das Ernste nennen wir ja besser als das Scherz-hafte und Lustige, und die Tätigkeit des besseren Teiles und Menschen nennen wir immer auch ernster.“ (ebd. S. 248). Tugend und Glück vertragen sich also nicht mit prinzipiellem Unernst, im Gegenteil: ohne gewissenhafte Arbeit, Ernsthaftigkeit, Verbindlichkeit und edle Gesinnung sind sie nicht zu erreichen.
Erst unter solchen Voraussetzungen macht es Sinn, über oberste Glückswerte nachzudenken. Diese findet Aristoteles im Denken selbst, das den Menschen zu stärkster Verinnerlichung, d.h. Konzentration auf seinen Wesenskern und Selbstzweck, befähigt und letztlich in metaphysische und religiöse, wenn nicht mystische Dimensionen führt: „ Wenn das Glück ein Tätigsein im Sinne der Trefflichkeit ist, so darf darunter mit gutem Grunde höchste Trefflichkeit verstanden werden: Das aber kann nur die der obersten Kraft in uns sein. Mag nun der Geist oder etwas anderes diese Kraft sein, die man sich gewiss als wesenhaft herrschend, führend, auf edle und göttliche Gegenstände gerichtet vorstellt – mag diese Kraft selbst auch göttlich oder von dem, was in uns ist, das göttliche Element sein – das Wirken dieser Kraft gemäß der ihr eigentümlichen Trefflichkeit ist das vollendete Glück. Dass dieses Wirken aber ein geistiges Schauen ist, haben wir bereits festgestellt.“ (in: G. Gerhardt a.a.O. S. 41, Hervorhebung durch mich.)
Aus dieser Kraft heraus vermag der Mensch auch die Tugenden zu übernehmen und zu pflegen, die ihm die Gemeinschaft (die Polis) anbietet. Aristoteles unterscheidet zwischen dianoetischen (Verstandes-) und ethischen (Charakter-) Tugenden. Zu den ersteren gehören vor allem Klugheit (Einsicht), Weisheit und „Verständigkeit“12, zu letzteren Tapferkeit, Besonnenheit (Mäßigung),, Großzügigkeit, Freigebigkeit, Ehr- und Schamgefühl. Ethische Kardinaltugenden – wie Tapferkeit, Mäßigung und Großzügigkeit – liegen in der „Goldenen Mitte“ zwischen zwei unbedingt zu meidenden Extremen: die Tapferkeit zwischen Tollkühnheit und Feigheit; die Mäßigung zwischen Wollust und Stumpfheit; die Großzügigkeit zwischen Verschwendung und Geiz.
Aristoteles vereint teleologisches und theologisches Denken. Zum tugendhaften, glücklichen Leben gehört die Gotteserkenntnis, zu der den Menschen seine geistig-seelischen, zielgerichteten Kräfte befähigen. Gott erkennen zu wollen, bedeutet aber keineswegs, der Welt zu entsagen. Was uns mit dem Göttlichen verbindet, sei nichts Außerweltliches, sondern die Vernunft selbst. Daher hält Aristoteles das „Leben nach der Vernunft“ für „göttlich“ und „dieses Göttliche in uns“ für „unser wahres Selbst, wenn anders es unser vornehmster und bester Teil ist“. Das Kapitel der ‚Nikomachischen Ethik‘, das solchen Überlegungen ge-widmet ist, beschließt ihr Autor jedoch nicht mit einer theologischen, sondern mit einer philosophischen Feststellung, wenn er sagt: „Was einem Wesen von Natur eigentümlich ist im Unterschied von anderen, ist auch für dasselbe das Beste und Genußreichste. Also ist dies für den Menschen das Leben nach der Vernunft, wenn anders die Vernunft am meisten der Mensch ist. Mithin ist dieses Leben auch das glückseligste.“ (10. Buch, Schluss des 7. Kapitels.)
Festzuhalten bleibt, dass Aristoteles den höchsten Wert des menschlichen Daseins im Denken und im vernunftgemäßen „vollen Leben“ erkennt. Er versteht dieses Leben teleologisch als „Streben nach Glück“, wobei es die Vernunft ist, die zum Göttlichen und von dort zum wahren, glücklichen Leben führen kann – wenn auch ohne Garantie für dauerhaftes Glück. Wobei Folgendes bedacht werden sollte: In Gott kommt das Streben nach Glück zur Ruhe, denn Gott ist für Aristoteles ja der „unbewegte Beweger“, der folglich Endlichkeit und Unendlichkeit, Rationales und Irrationales in sich vereint und schließlich die Sterblichkeit in Unsterblichkeit aufhebt. Gott beendet insofern die Unrast irdischen Lebens und lässt stattdessen unendliches Glück aufscheinen. Der Gedanke an dieses Glück vermag die Angst des Menschen vor Unglück, Leid und Tod zu beenden und ihm den Sinn seines Daseins zu erschließen.13
Kants Kritik der aristotelischen Glücksethik
Dass die Menschen nach dem Glück streben, hält auch Kant für normal und unabdingbar, so wenn er in der Kritik der praktischen Vernunft (von 1788) feststellt:
„Glücklich zu sein, ist notwendig das Verlangen jedes vernünftigen, aber endlichen Wesens und also ein unvermeidlicher Bestimmungsgrund seines Begehrungsvermögens.“14
Und die darauf folgende Begründung dieser These enthält bereits die entscheidende Voraussetzung für Kants Kritik am aristotelischen Glückskonzept. Dort heißt es nämlich:
„Denn die Zufriedenheit mit seinem ganzen Dasein ist nicht etwa ein ursprünglicher Besitz und eine Seligkeit, welche ein Bewußtsein seiner unabhängigen Selbstgenügsamkeit voraussetzen würde, sondern ein durch seine edle Natur selbst ihm aufgedrungenes Problem, weil es bedürftig ist; und dieses Bedürfnis betrifft die Materie seines Begehrungsvermögens, d.i. etwas, was sich auf ein subjektiv zum Grunde liegendes Gefühl der Lust oder Unlust bezieht, dadurch das, was es zur Zufriedenheit mit seinem Zustande bedarf, bestimmt wird. Aber ebendarum, weil dieser materiale Bestimmungsgrund von dem Subjekte bloß empirisch erkannt werden kann, ist es unmöglich, diese Aufgabe als ein Gesetz zu betrachten, weil dieses als objektiv in allen Fällen und für alle Wesen ebendenselben Bestimmungsgrund des Willens enthalten müßte.“ (ebd. S. 28 f.)
Damit ist der Konflikt mit Aristoteles vorprogrammiert. Kant unterscheidet – ganz anders als Aristoteles – zwischen dem Empfinden von Lust und Unlust und der Reflexion über dieses Empfinden. Demnach besteht das Glück nicht einfach in dessen Empfindung, sondern in dem, was jede/r Einzelne unter Glück versteht. Eine subjektive Bedingtheit, die zugleich verhindert, dass sie jemals zum Gesetz (des Glücks bzw. des Handelns) werden kann. Auch wenn das Streben nach Glück sogar als Pflicht angesehen werden kann, wozu Kant ausführt:
„Seine eigene Glückseligkeit sichern, ist Pflicht (wenigstens indirekt); denn der Mangel der Zufriedenheit mit seinem Zustande in einem Gedränge von vielen Sorgen und mitten unter unbefriedigten Bedürfnissen könnte leicht eine große Versuchung zu Übertretung der Pflichten werden.“15
Glück wird bei Kant zum Inbegriff von Neigung und damit erst recht völlig ungeeignet, wie bei Aristoteles als Ziel und triftige Begründung des Handelns oder sogar als Lebenszweck zu dienen. Denn Letzteres bedeute, dass Aristoteles etwas rein Subjektives – die eigene „Glückseligkeit“ – zum „Bestimmungsgrund des Willens“ und des Handelns mache. Dies sei sogar „das gerade Widerspiel des Prinzips der Sittlichkeit“.16
Dem hält Kant entgegen:
„Das Prinzip der Glückseligkeit kann zwar Maximen, aber niemals solche abgeben, die zu Gesetzen des Willens tauglich wären, selbst wenn man sich die allgemeine Glückseligkeit zum Objekte machte.“ (ebd. S. 42)
Kants Begründung: Glückseligkeit beruht stets auf subjektiver Erfahrung, die ihrerseits zudem Gegenstand persönlicher und daher veränderlicher Meinungen ist. „ Universelle Regeln“ lassen sich daraus nicht ableiten und folglich auch „keine praktischen Gesetze“. Nicht das mögliche Maß von „Glückseligkeit“, sondern die mit dem Sittengesetz und der Allgemeinen Gesetzgebung übereinstimmende Maxime des Wollens ist für Kant Richtschnur und letzte Begründung des Handelns aus Pflicht, nicht aus den schwankenden, nicht verlässlichen Neigungen, die für den Glücksbegriff bedeutungs- und ausschlaggebend sind.
Solche Überlegungen waren Aristoteles vollkommen fremd. Für Kant aber waren sie von zentraler, essentieller Bedeutung, zumal sie den Inhalt des Kategorischen Imperativs (Kat. Imp.) hervorgebracht haben.
Kants Lehre von der Glückseligkeit
Deruht im Wesentlichen auf der soeben dargestellten Gegenposition zu der „Glücksethik“ des Aristoteles. Eine solche Ethik kann es für Kant streng genommen gar nicht geben, weil er es aus guten Gründen für ausgeschlossen hält, Ethik auf Glück – und damit auf Neigungen – zu gründen.
Dabei fällt auf, dass Kant den Glücksbegriff einerseits für „unbestimmbar“ hält (weil für eine gültige Bestimmung „Allwissenheit erforderlich wäre“17 ), andererseits aber sogar in das Höchste Gut, das Summum Bonum, integrieren will. Wer glücklich sein will, folgt seinen Neigungen, kann dies aber nicht bedingungs- und ausnahmslos tun, weil Neigungen, z.B. zu übertriebener Selbstliebe, das eigene Glück verhindern können. Ohnehin kann laut Kant „ … der Mensch sich von der Summe der Befriedigung aller unter dem Namen der Glückseligkeit keinen sicheren und bestimmten Begriff machen …“. (ebd. S. 17)
Außerdem kann der Mensch sich gelegentlich sogar gezwungen sehen, Neigungen zu unterdrücken, und zwar auf Grund der Gebote pflichtgemäßen Handelns. Und dies ist anscheinend einer der Gründe dafür, dass Kant es für erforderlich hält, die Glückseligkeit sogar mit dem Höchsten Gut (= Gott) in Verbindung zu bringen. Für möglich hält er dies aus „Erkenntnisgründen a priori“, zumal „die Möglichkeit des höchsten Guts … auf keinen empirischen Prinzipien beruht“.18 Wobei trotzdem „physische und moralische“ Faktoren zusammenwirken sollen, um den Genuss einer „ gesitteten Glückseligkeit “ zu ermöglichen.19 Dies bedeutet, dass es für Kant Glück ohne eine Ethik in seinem Sinne nicht geben kann. Um dauerhaftes Glück zu erreichen, muss der Mensch sich an die Gebote des Sittengesetzes halten, was ja die „Allgemeine Gesetzgebung“ einschließt, so dass Konflikte mit dem Gesetz vermieden werden können. Und damit erhebt Kant den Kat. Imp. auch zum Maßstab für seine Synthese aus Sittlichkeit und Höchstem Gut. Wobei eine nicht geringe Schwierigkeit darin besteht, dass der Vorrang der Moral jederzeit zu beachten ist, wozu Kant bemerkt: „ … obgleich in dem Begriffe des höchsten Guts als dem eines Ganzen, worin die größte Glückseligkeit mit dem größten Maße sittlicher (in Geschöpfen möglicher) Vollkommenheit als in der genauesten Proportion verbunden vorgestellt wird, meineeigene Glückseligkeit mitenthalten ist: so ist doch nicht sie, sondern das moralische Gesetz (welches vielmehr mein unbegrenztes Verlangen danach auf Bedingungen strenge einschränkt) der Bestimmungsgrund des Willens, der zur Beförderung des höchsten Guts angewiesen wird.“20
Dabei kommt der Moral keineswegs die Aufgabe zu, Glückszustände herzustellen bzw. den Menschen glücklich zu machen. Denn Kant folgert aus der Vorrang-stellung der Moral im Hinblick auf das Höchste Gut:
„Daher ist auch die Moral nicht eigentlich die Lehre, wie wir uns glücklichmachen, sondern wie wir der Glückseligkeit würdig werden sollen. Nur dann, wenn Religion dazu kommt, tritt auch die Hoffnung ein, der Glückseligkeit dereinst in dem Maße teilhaftig zu werden, als wir darauf bedacht gewesen, ihrer nicht unwürdig zu werden.“ (ebd.)
Dies mag zunächst befremden, stimmt aber mit Kants Auffassung überein, dass Glückseligkeit zunächst auf Neigungen beruht. Damit diese sich nicht schädlich auswirken können, bedarf es der Hilfe durch den Kat. Imp. Ohne diesen müssten auch kriminelle Neigungen als Glücksquellen anerkannt werden. Zu Unrecht fühlen Lustmörder und andere Übeltäter sich wohl und „glücklich“ bei ihren Missetaten.– Bemerkenswert ist dennoch, dass Kant die Glückswürdigkeit mit dem Höchsten Gut vereint, nämlich mit Hilfe der Kontrollinstanz des Kat. Imp.
Kritische Würdigung
Kant betrachtet also das Glück als subjektive, auf Neigungen beruhende Angelegenheit, die durch Allgemein-Verbindliches, d.h. durch Ethik und Moral, gesichert werden muss. Ein höchst bemerkenswertes Konzept! Trotzdem stellt sich die Frage, wer nun recht hat: Kant oder Aristoteles? Übereinstimmung besteht zwischen beiden darin, dass es Glück ohne Moral und Ethik nicht geben kann. Dennoch sind auch die Unterschiede zwischen den beiden Glücks-Konzepten offensichtlich. Wie Otfried Höffe darlegt, erscheint in Kants Sicht bei Aristoteles „das Moment des Willens auf ein Minimum reduziert“, nämlich auf die Entscheidung über die Frage, ob die sichtbaren Ziele des Handelns angenommen werden sollen oder nicht. Umgekehrt erscheint – von Aristoteles aus gesehen – Kants Argumentation ebenfalls unzulänglich, weil Kant sich fast nur für die Moralität, d.h. für die Begründung des Handelns interessiere, nicht aber für die konkreten Mittel und Wege, über die die Ziele des Handelns erreicht werden können. Darüber hinaus folgert Höffe:
„Strebens- und Willensethik sind zwei Modelle, die je einen Aspekt menschlichen Handelns reflektieren; diese das Setzen, jene das Verfolgen von Zielen. Ein vollständiges Modell menschlichen Handelns ergibt sich erst aus beiden Modellen. Kantische und aristotelische Ethik sind in dieser Hinsicht nicht konkurrierende, sondern korrespondierende Ethiken. Aristoteles und Kant gegeneinander auszuspielen, dem einen oder dem anderen einen Mangel an Reflexion vorzuwerfen, führt kaum weiter. Sinnvoll dagegen ist es, beide Ethiken aneinander zu messen, die ihnen zugrunde liegenden unterschiedlichen Interessen zu erkennen und ein Modell menschlichen Handelns zu suchen, das in der Vermittlung von Strebens- und Willensethik beide Interessen vereint.“21
Ob dies ohne weiteres möglich ist, bezweifle ich jedoch. Denn Kant versucht – anders als Aristoteles – immerhin, individuelle und allgemein-gesellschaftliche Glücks-Interessen miteinander in Einklang zu bringen. Für problematisch bis obsolet halte ich diesen Versuch, weil darin der Kat. Imp. eine entscheidende Rolle spielt. Ohne ihn wäre der gesuchte Einklang illusorisch. Mit ihm ist er nur dann erreichbar, wenn der Kat. Imp. wirklich kategorisch (= unbedingt, absolut) gültig ist. Genau dies aber hat sich, wie ich nachweisen konnte, als unhaltbar erwiesen, und zwar vor allem aus folgenden Gründen:
„Mit der Allgemeinen Gesetzgebung will Kant das Sittengesetz nicht nur moralisch, sondern auch rechtlich absichern, gerät dadurch aber in einen Widerspruch zwischen Apriori und Empirie u.a. deswegen, weil die Praxis der Rechtsprechung zwar nicht ohne Apriorisches, erst recht aber nicht ohne Empirie auskommt. Schon deshalb kann die Allgemeine Gesetzgebung nicht zur Fundierung eines kategorisch „reinen Sollens“ dienen. Zu beachten ist auch, dass Gesetzgebung durchweg aus materiellen und gesellschaftlichen Notwendigkeiten entsteht und stets auf diese bezogen bleibt, so dass die Skepsis gegenüber dem Recht, der Rechtsprechung und der Gesetzgebung durchaus gerechtfertigt zu sein scheint. Schon die alten Römer kannten diese Skepsis, kurz und bündig ausgedrückt in der Devise ‚ Summum ius summa iniuria “, höchstes Recht kann höchste Ungerechtigkeit bedeuten, wozu es in einem Artikel der Zeitschrift ‚Cicero Online‘ heißt: „Je stärker, je weiter reichend, je umfassender der rechtliche Regelegungskosmos, desto mehr gerät die produktive Gerechtigkeitsidee unter die Räder, desto mehr verliert das Recht seine ursprüngliche Funktion der Wahrung von rechtlich geschützten Handlungsräumen.“22
Hinfällig werden die Verabsolutierungen der Kantschen Sollensethik aus einem weiteren triftigen Grund: Der darin vorausgesetzte Dualismus von „Ding an sich“ und Erscheinung erweist sich als nicht haltbar. Denn Kant nimmt das Ding an sich zwar als unerkennbar und daher unbestimmbar an, deutet aber trotzdem mehrfach an, was darunter zu verstehen sein könnte, so wenn er für die Beziehung zwischen dem Ding an sich und dem wahrnehmenden bzw. um Verstehen bemühten Subjekt das Verb „affizieren“ benutzt. Der (mögliche) Gegenstand der Erkenntnis „berühre“ das Subjekt dadurch, dass er „das Gemüt auf gewisse Weise affiziere“.23 Empfindung sei die „Wirkung eines Gegenstandes auf die Vorstellungskraft, sofern wir von demselben affiziert werden“ (ebd.). – Wo und weshalb aber findet solches „Affizieren“, die Affektion, tatsächlich statt? Einerseits erzeugt das Subjekt in der Empfindung den vom „Ding an sich“ ausgehenden Gegenstand nicht selbst, sondern wird von ihm, „berührt“; andererseits affiziert das Ich dabei einen Teil des eigenen Selbst, nämlich seinen „inneren Sinn“ (ebd.). Und Kant räumt sogar ein: „Die Objekte der Sinne, metaphysisch betrachtet, sind Erscheinungen; für die Physik aber sind es die Sachen an sich selbst, die den Sinn affizieren.“24 Mit anderen Worten: Kant weiß sehr wohl, dass es bestimmte Kräfte der Materie und des Geistes sind, die das „Ding an sich“ ausmachen und als solche die Sinne und den Verstand des Subjekts affizieren. Dennoch hält er an der Annahme fest, dass die Materie der Welt der Erscheinungen angehört, so dass er mit diesem Begriff das Ding an sich nicht bestimmen kann. Darin sehe ich einen Widerspruch, der sich erst auflöst, wenn klar ist, dass die Materie in der Evolutionsgeschichte lange vor dem menschlichen Geist existiert hat, so dass „die unvollendete Entelechie der Materie“ (Bloch) mit ihrem In-Möglichkeiten-Sein sowohl dem „Ding an sich“ als auch der Erscheinungswelt zu Grunde liegt.25
Entfällt aber das „Ding an sich“, entfällt auch Kants Begründung der Unbedingtheit des „kategorischen“ Imperativs. Als angeblich schlechthin Unbedingtes verknüpft Kant das „Ding an sich“ mit Gott, Freiheit und der Unsterblichkeit der Seele als Postulaten der „reinen praktischen Vernunft“, die gleichwohl zu Bestimmungsgründen des Sittengesetzes und damit zu Garanten des Kat. Imp. avancieren. Diese Garantie verschwindet aber mit schon mit der Unhaltbarkeit des „Dings an sich“, wozu Kant selbst bemerkt: „ … sind Erscheinungen Dinge an sich selbst, so ist Freiheit nicht zu retten.“26
Außerdem sind Gott und die „Unsterblichkeit der Seele“ zweifellos Glaubens -Inhalte, während das Freiheitsproblem sich bisher anscheinend weder transzendental noch empirisch (z.B. anhand der Willensfreiheit) zufriedenstellend lösen lässt. Verständlich wird durch meine Widerlegungen auch Kants eigene Skepsis gegenüber seinem Konstrukt des Kat. Imp., das er am Ende seiner Grund-legung zur Metaphysik der Sitten massiv in Frage stellt, wobei er zu dem Ergebnis kommt:
„„Und so begreifen wir zwar nicht die praktische unbedingte Notwendigkeit des moralischen Imperativs, wir begreifen aber doch seine Unbegreiflichkeit; welches alles ist, was billigermaßen von einer Philosophie, die bis zur Grenze der menschlichen Vernunft in Prinzipien strebt, gefordert werden kann.“27
Das Tragische daran ist, dass der Kat. Imp. (der „moralische Imperativ“) nicht nur „unbegreiflich“, sondern auch hinfällig ist. Die Folgen für Kants Glücks-Konzept liegen auf der Hand. Da es keinen kategorischen Imperativ gibt, entfällt dieser auch als Garant für den von Kant behaupteten Einklang von individuellen und gemeinschaftlichen Glücks-Interessen. Folglich muss hierfür nach anderen Wegen und Methoden Ausschau gehalten werden, erst recht, wenn man mit O. Höffe zwischen „Strebens- und Willensethik“ vermitteln will.
Utilitaristen streben nach dem größtmöglichen Glück
Genauer: Sie wollen „das größte Glück der größten Zahl“ für Menschen erreichbar machen. Im Einzelnen: Für die Herausbildung des Utilitarismus, der Lehre vom Nützlichen, sind zwei Werke von grundsätzlicher Bedeutung, und zwar 1. die von Jeremy Bentham (1748-1832) verfasste Einführung in die Prinzipien der Moral und der Gesetzgebung (1789), in dem es – wie schon bei Aristoteles und Epikur – vor allem um die Frage geht, wie das „größte Glück der größten Zahl“ von Menschen erreicht werden kann. Nach diesem einzigen ethischen Kriterium soll sich jegliche Politik und Gesetzgebung und jede Art von Rechtssystem richten.
Das zweite Grundwerk ist Utilitarianism (‚Utilitarismus‘, 1861) von John Stuart Mill (1806-73), der die Überlegungen Benthams im Wesentlichen dadurch erweitert, dass er die „innere Motivation“, d.h. die persönliche Instanz des Gewissens, u.a. in Bezug auf Gemeinwohl und allgemeinen Nutzen, in das Gebot der Glücksmaximierung mit einbezieht.28
Dazu schreibt Cornelia Mooslechner-Brüll (2019):
„Benthams Ziel war es, ein System zu entwerfen, auf dessen Basis die moralisch richtige Entscheidung getroffen werden könne – auch „hedonistisches Kalkül“ genannt. Aber warum Hedonismus? Der Begriff darf an dieser Stelle nicht falsch verstanden werden, denn Bentham verband damit nicht ein ausschweifendes Genussstreben. Vielmehr solle in einem geregelten Maß Lust und Freude gefördert, Unlust und Leid vermieden werden.
Bentham stellte die folgende Regel auf: Führe diejenige Handlung aus, durch die die größtmögliche Summe an Nutzen für alle Betroffnen erreicht werden kann. Hier geht es also in keinster Weise um Egoismus oder den eigenen Profit, obwohl dies Utilitaristen gerne unterstellt wird. Viel mehr steht das Glück möglichst aller oder zumindest möglichst vieler im Mittelpunkt.
Das größte Glück als Grundlage für die Moral
Bentham ging davon aus, das Glück präzise berechnen zu können. Dazu erstellte er ein Punktesystem mit sieben Kriterien, anhand dessen der größtmögliche Nutzen ermittelt werden könnte: Intensität des Glücks, Dauer, Gewissheit, zeitliche Nähe, Folgenträchtigkeit, Reinheit (sprich, bringt es wirklich nur Glück) und Ausdehnung. Bentham war dabei durchaus bewusst, dass es sich hier immer nur um Annäherungen an das Glück handeln könne und dieses schwerlich absolut zu setzen sei.
Dieses System hatte aber einige Schwächen: Kann zum Beispiel Freude und Leid überhaupt gemessen werden? Können die Folgen einer Handlung wirklich präzise abgeschätzt werden? Selbst wenn es den anderen nutzt, wie fühlt sich der Handelnde dabei selbst? Zudem: Minderheiten können so überhaupt nicht geschützt werden.
John Stuart Mill war Benthams Schüler und versuchte, Benthams Modell kritisch zu hinterfragen und seinen Ansatz zu verfeinern. Zunächst folgte Mill Bentham in der Annahme, dass die Nützlichkeit oder das Prinzip des größten Glücks die Grundlage der Moral darstellen muss. Er ging davon aus, „dass Handlungen insoweit und in dem Maße moralisch richtig sind, als sie die Tendenz haben, Glück zu befördern, und insoweit moralisch falsch, als sie die Tendenz haben, das Gegenteil von Glück zu bewirken.“ (John Stuart Mill 2016: Der Utilitarismus, S. 23)
Mills Lösung aber für die heikle Frage nach der Messbarkeit von Glück ist eine äußerst spannende: Er reagierte nämlich nicht darauf, indem er versuchte, das Modell mathematisch wasserdicht zu machen. Vielmehr versuchte er, die qualitativen Aspekte in den Vordergrund zu rücken. Mill ging davon aus, dass Freude für jeden etwas anderes bedeutet und zudem Freuden in unterschiedliche Qualitäten unterteilt werden müssten. Das Decken von Grundbedürfnissen kann zum Beispiel nicht verglichen werden mit dem Genuss von Musik oder Kunst. Das Gute, das Glückbringende ist also nicht eindimensional, sondern komplex und divers. Für die Gemeinschaft müsse dementsprechend gemeinsam entschieden werden, was das Gute sei:
„Von zwei Freuden ist diejenige wünschenswerter, die von allen oder nahezu allen, die beide erfahren haben – ungeachtet des Gefühls, eine von beiden aus moralischen Gründen vorziehen zu müssen -, entschieden bevorzugt wird.“ ((John Stuart Mill 2016: Der Utilitarismus, S. 29) Mill ging es darum, möglichst viele Erfahrungen zu sammeln und anhand dieser die Mehrheit entscheiden zu lassen, was gut und was schlecht sei.
Solidarisches Weltbild als Grundlage
Doch wie können nun Menschen dazu in die Lage versetzt werden, überhaupt über Freuden und das Glück anderer zu urteilen? Mills Antwort: Das gelinge nur über Bildung. Das Bildungssystem und die öffentliche Meinung müssen zusammenwirken. Es solle eine „unauflösliche Verbindung“ zwischen dem “individuellen Glück und dem Wohl der Gesellschaft” hergestellt werden. Durchaus ein interessanter Gedanke angesichts der Verfasstheit heutiger Bildungssysteme. Das „kleine Glück“ und das Gemeinwohl müssten in Übereinstimmung gebracht werden.
Das Abwägen des Nutzens kann nach Mill nur ein „gutes“ Ende nehmen, wenn es auf einem Menschen- und Weltbild fußt, das schon von Grund auf solidarisch und gemeinschaftlich orientiert ist. Zudem muss der Mensch lernen, überhaupt erkennen zu können, was gut für ihn selbst ist. Oft, so Mill, wird dieser Zugang zum Selbst, die Selbsterkenntnis, verschüttet, weil es an Zeit und Gelegenheit mangelt, sich den wichtigen Dingen zu widmen.
„Die höheren Bedürfnisse und geistigen Interessen der Menschen sterben ab, weil es diesen an Zeit und Gelegenheit fehlt, sie zu pflegen; und nicht deshalb geben sie sich niedrigeren Vergnügungen hin, weil sie sie bewusst vorziehen, sondern weil diese die einzigen sind, die ihnen erreichbar und zu deren Genuss sie noch fähig sind.“ (John Stuart Mill 2016: Der Utilitarismus, S. 35) 29
Offensichtlich stößt Mills Konzept hier an Grenzen. Nur mit Bildung lassen sich nicht alle Menschen glücklich machen. Es kommt wohl darauf an, genügend Bildungsmöglichkeiten anzubieten, die den unterschiedlichen Bedürfnissen nach und Vorstellungen von Glück gerecht werden können.
Außerdem hat sich der Utilitarismus seit Bentham und Mill erheblich weiter entwickelt; gegenwärtig existiert er in mindestens einem Dutzend unterschiedlicher Spielarten, von denen für das Glücksproblem von besonderer Relevanz der „empfindungsfähige“, der Gerechtigkeits- und der Motiv-Utilitarismus zu sein scheinen. Der empfindungsfähige Utilitarismus will alle Lebewesen gleichermaßen berücksichtigen und der Tatsache gerecht werden, dass der Mensch sein Glück nicht auf dem Unglück der Tierwelt aufbauen kann. – Ähnlich argumentiert man mit dem Gerechtigkeitsutilitarismus. Der Mensch kann nicht glücklich sein, wenn er ungerecht behandelt wird. Zu berücksichtigen sind individuelle Glücks-Motive, was erst recht im Motiv-Utilitarismus der Fall ist: Menschen können durchweg selbst über Gut und Böse, Nützlich und Schädlich befinden. Hier wirkt sich eine der individuellen Grundlagen des Glücks- Utilitarismus aus: Einbezogen wird der psychische Zustand des Menschen, in dem er sich befindet, wenn er handeln will oder dazu gezwungen ist. Wobei die Motivation zu moralischem Handeln Wissen voraussetzt:
„Der Motiv-Utilitarismus legt auch nahe, dass wir Motive, die von praktischem Wert sind, in uns einfließen lassen, damit wir das Richtige tun, wenn es darum geht.“30
Trotzdem stößt der Glücks-Utilitarismus nicht überall auf die Gegenliebe, die z.B. Cornelia Mosslechner-Brüll an den Tag legt (s.o.). Exemplarisch kann die Kritik herangezogen werden, die Maximilian Tarrach (2020) in seinem Internet-Aufsatz über Das Problem des Utilitarismus geübt hat, wobei für die Glücksfrage Folgendes relevant sein dürfte:
1. „Das Problem besteht schon darin, wie man das größte Glück definiert.“31 Ist damit das „Allgemeinwohl“ gemeint, muss die Marktwirtschaft auf jeden Fall abgelehnt werden, weil sie die Armut nicht restlos beseitigen kann.
2. Freiheit und Glück können in Konflikt miteinander geraten, weil der „Einzelne auch falsche Entscheidungen treffen“ kann (ebd. S. 2). Freiheit kann Scheitern bewirken.
3. Schränkt der Staat Freiheiten ein, besteht die Gefahr des Totalitarismus (ansatzweise schon bei Bentham!).
4. „Wenn man glaubt, das Glück des Menschen von außen bestimmen und festsetzen zu können, und wenn man glaubt, dass man die Fehler des Individuums durch eine weise Führung verhindern könne, muss man die Freiheit des Einzelnen nach und nach zerstören.“ (a.a.O. S. 2 f.)
5. „Natürlich ist es möglich und durchführbar, Menschen zu ihrem „Glück“ zu zwingen. Manche Menschen ziehen den Zustand dauernder Abhängigkeit der Selbstständigkeit und der Pflege der Freiheit sogar vor. Sie drücken sich vor dem Leben.“ (a.a.O. S. 4)
6. Im Westen ist der Utilitarismus „pseudo-wissenschaftlich“, d.h. noch mit „Antikapitalismus“ und „Ökologismus“ durchsetzt. In China gibt es die „Wiederkehr eines wissenschaftlich-aufgeklärten kollektivistischen Utilitarismus“ (a.a.O. S. 5)
7. Ludwig Mises verbindet Utilitarismus und subjektive Wertlehre. Dadurch schwindet aber das Gemeinwohl zu Gunsten der Privat-Interessen.
8. „Der Utilitarismus muss zurückgedrängt werden durch den Liberalismus. Es ist nicht die Aufgabe des Staates, der akademischen Schichten, der Medien oder sonst einer Elite, für das Glück aller zu sorgen. Der Staat muss dem Streben des Einzelnen gegenüber neutral sein. Fehler und Missgeschicke gehören zum Leben dazu.“ (a.a.O. S. 7)
9. In New York kann „jeder Mensch … sein Glück … in die Hand nehmen und sich etwas erarbeiten.“ (ebd.)
Stärken und Schwächen dieser Kritik: Tarrach wirft erneut das Problem auf, das Kant durch den Kat. Imp. für lösbar hielt. Kümmert sich der Staat um sämtliche Glücksmöglichkeiten sowohl des Einzelmenschen als auch der Gemeinschaft, entsteht die Gefahr des Totalitarismus. Aber: Wie gesamtgesellschaftliches Glück erreichbar sein könnte, erklärt Tarrach nicht, zumal sein Denken in neoliberal-kapitalistischen und individualistischen Vorstellungen befangen zu sein scheint. Unter diesen Voraussetzungen dürfte es eher illusorisch bis abwegig sein, den Utilitarismus durch den Liberalismus zu ersetzen, wie Tarrach es fordert.
Zwischenfazit
Auch den Utilitaristen gelingt es nicht, das Problem zufriedenstellend zu lösen, an dem Kant hinsichtlich der „Glückseligkeit“ mit seinem Kat. Imp. gescheitert ist. Angesichts dessen sehe ich nur noch die Alterative, einen geeigneten größeren Theorie-Rahmen mit Konzepten anzugeben, die sowohl den individuellen als auch den kollektiven Glücks-Bedürfnissen und -Interessen gerecht werden könnten.
Jede/r nach ihren/seinen Bedürfnissen, jede/r nach ihren/seinen Fähigkeiten!
Diese sozialistische Forderung entspricht weitgehend denjenigen Faktoren, die schon Aristoteles als Voraussetzung für das Glücklich-Sein nannte: Der Mensch soll sich seine Bedürfnisse erfüllen und gemäß seinen Fähigkeiten leben und arbeiten können. Wobei sich unweigerlich die Frage stellt, warum Sozialisten seit dem 18. Jahrhundert und danach immer wieder – also mehr als 2000 Jahre nach Aristoteles – mit den genannten Glücksfaktoren an die Öffentlichkeit getreten sind, und zwar in Form sozialpolitischer Forderungen.
Für unsere Gegenwart lässt sich diese Frage relativ leicht mit einer Feststellung beantworten, die 2019 im Rahmen einer „Geistwerkstatt des Netzwerks Achtsame Wirtschaft“ getroffen wurde, worin es zum Problemkreis Gemeinwohl und Individualwohl heißt:
„Das Streben nach individuellem Glück scheint in unserer aktuellen Wirtschaftsordnung zur Zerstörung des Gemeinwohls und unseres Planeten zu führen. Individuelles Glück und kollektives Wohlergehen stehen in dieser Logik unversöhnlich gegeneinander.“32
Damit bringen die Autoren auf den Punkt, wie die Soziale Frage – auch und gerade im Rahmen der Glücks-Problematik – sich heutzutage stellt: Ähnlich wie im Fall von Gut und Böse 33 führt die Überstrapazierung des Strebens nach Glück möglicherweise zu totaler Umweltzerstörung und damit zu kollektiver Selbst-zerstörung (schlimmer noch und anders als Freud sie diagnostiziert hat! s.o.). In großer Klarheit und Offenheit wird auch der tiefere Grund hierfür genannt: die „aktuelle Wirtschaftsordnung“. Die identisch zu sein scheint mit dem, was Marx als „die Dauerkrise des Kapitalismus“ bezeichnet hat.
Leider gelangen die Autoren des „Netzwerks Achtsame Wirtschaft“ nicht zu dieser Folgerung. Denn ihre auf das obige Zitat folgende Frage lautet:
„Ist das Streben nach individuellem Glück egoistisch und zerstörerisch?“
Und die Antwort:
„Nur, wenn wir falschen Ideen vom Glück hinterherlaufen.“ (ebd.)
Was ich für eine nicht „radikale“, d.h. nicht an die Wurzel gehende Antwort halte. Sie steht im Gegensatz zu der zuvor genannten wahren Ursache „aktuelle Wirtschaftsordnung“. Diese erscheint nun plötzlich weniger relevant als die Gefahr des subjektiven Abirrens in „falsche Ideen vom Glück“.
Dagegen bin ich selbst – auf Grund der beschriebenen furchterregenden „Gemengelage“ – zu ganz anderen Überlegungen gekommen, und zwar:
Trotz des historischen Scheiterns des Leninismus und des Zusammenbruchs von 1989 ff.: Relevant bleibt die Grundidee des Sozialismus, die einer befreiten, klassenlosen Gesellschaft mit einer „freien Assoziation freier Individuen“, zumal Marx dieser Idee auch eine ethisches Fundament verliehen hat, indem er forderte den „kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächt-liches Wesen ist“.
Erst dann werde es möglich sein, dass jeder Mensch seinen Bedürfnissen und seinen Fähigkeiten gemäß leben kann. Zweifellos eine „ erkennbare Ethik des angemessenen Lebens, Arbeitens und Zusammenlebens “!34 Und:
Öko-Ethik. In einer Zeit, die einerseits durch Umweltkrisen und -katastrophen, andererseits durch eine „digitale Revolution“ gekennzeichnet ist, bedarf es neuer ethischer Reflexion. Wissenschaftlich bestätigen lässt sich, warum Kant es für ausgeschlossen hielt, Ethik auf Neigungen gründen zu können. Es gibt keinerlei Garantie dafür, dass die tief im Unterbewussten und Körperlichen verankerten Neigungen automatisch das Gute bewirken, für das wir normalerweise schon aus Gründen der Selbsterhaltung – spontan oder nach mehr oder weniger reiflicher Überlegung – uns zu entscheiden bereit sind. Wobei es natürlich nicht nur um uns selbst, um unser eigenes Person-Sein geht, sondern ebenso um dasjenige unserer Mitmenschen So dass hier nicht nur das „radikal Böse“, sondern auch die Frage nach dem Person-Sein eine Rolle spielt. Es sind existenziell bedeutsame ethische Probleme, die Kant vor allem im Zusammenhang mit seinen Erörterungen des Kategorischen Imperativs behandelt hat, den ich allerdings zu einer legitimen Forderung umformuliere – so dass der Kat. Imp. zwar teilweise seine Gültigkeit behält, jedoch nicht als Pflicht- und Sollensethik mit Absolutheitsanspruch, sondern als personale Wertethik.
Meine legitime Forderung lautet:
Achte bei allem, was Du tust, darauf, Dich selbst und Deine Mit-Menschen als Rechtspersonen und Persönlichkeiten zu respektieren und möglichst stets das Sittengesetz zu befolgen.
„Möglichst“ deshalb, weil es Ausnahmesituationen gibt, wie z.B. die der Notwehr, in denen die Rechte der eigenen Person gegen existenzielle Bedrohungen und Rechtsbrüche jeder Art zu verteidigen sind.
Unter diesen Voraussetzungen halte ich es für möglich, die Ethik der Person durch eine Ethik der Natur zu ergänzen, wofür ich eine Naturformel des Kategorischen Imperativs vorgeschlagen habe, in der die Tatsache berücksichtigt wird, dass im Umgang mit der Natur legitime Interessenabwägungen erforderlich sein können. Es ist eine Formel, die nicht die noch im Gange befindlichen Diskussionen über (mögliche) Rechte der Natur, der Umwelt, der Tier- und Pflanzenwelt (Natur-, Öko-, Tierrechte) präjudizieren kann oder soll. Sie lautet:
Verhalte Dich so, dass Du die Natur in jeder Person und in jeder anderen Erscheinungsform stets als Zweck – und als Mittel nur zu ethisch begründbaren und moralisch vertretbaren Zwecken – behandelst.
Wenn nun zu klären ist, welche konkreten Rechte und Pflichten sich mit dieser neuen Formel begründen lassen, stellt sich die Frage nach der Legitimierung entsprechender gesetzgeberischer Maßnahmen. Was ist legitim? Rechtspositivi-stisch zweifellos das aktuelle geschriebene und gesprochene Recht. Und in Fällen staatlicher Willkür? Oder gar in Unrechtsstaaten? Da hilft zunächst wohl nur die naturrechtliche Anerkennung des Eigenwerts der Natur und des Selbstzwecks der Person, die auch in Kants Zweckformel des Kategorischen Imperativs enthalten ist, wozu meine Naturformel lediglich als Ergänzung dient.
Demokratischer Ökosozialismus. Auf die aktuell akuten Bedrohungen – Öko-Krise, Digitalisierung, Trans- und Posthumanismus, ergänzbar durch den Nuklearen Holocaust, – sind mit meiner Erweiterten Öko-Ethik Antworten möglich, erst recht, wenn sie durch historische und aktuelle Werte-Synthesen gestützt werden können. Nicht jedoch auf die Bedrohung durch den aktuellen globalisierten Turbo-Kapitalismus – und auch nicht auf die Frage, wie die „Antworten“, z.B. in Form meiner legitimen Forderung (s.o.), denn in die Tat umgesetzt werden können, so dass sie gesellschaftsverbessernd wirken. Was leider auch dann nicht möglich ist, wenn sich veranschaulichen lässt, wie aus Werten Normen, d.h. verinnerlichte, verbindliche Verhaltensregeln bzw. „Maximen“ werden. Dies gilt wahrscheinlich für jede Art der Umwandlung von Werten in Normen, so a) bei angeborenen Werten, die der ursprünglichen Selbsterhaltung und Erstorientierung dienen; b) bei der Normierung von Werten durch Erziehung und Sozialisation, die auf Grund unterschiedlicher gesellschaftlicher und kultureller Rahmenbedingungen stattfinden; c) durch politische und sonstige Gesetzgebung. Die unter a) genannten Faktoren sind anscheinend kaum beeinflussbar, während bei b) und c) das „Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“ zum Tragen kommt. Darunter im turbo-kapitalistischen Westen die Macht der manipulativen Fakten: Arbeitgeber-Interessen, „Spaß“-Ideologie, analytisch-positivistisches Denken u.a.m. Wogegen ethische Grundsätze einen sehr schweren Stand bzw. häufig gar keine Chancen auf Verwirklichung haben. Wo Erkenntnisse auf Interessen prallen, blamieren sich meistens die Erkenntnisse, wie Marx feststellte. Legitime ethische Forderungen, z.B. nach Gerechtigkeit, Gleichheit und Solidarität, durchzusetzen, stößt in einer Klassen-Gesellschaft („mit Herr und Knecht“) nicht selten auf unüberwindliche Hindernisse, verursacht z.B. durch digitale Überwachung, kapitalistische Herrschafts-Ideologie, Lobbyismus, Stigmatisierung und Verfolgung Andersdenkender, Gewaltmaßnahmen (z.B. Entlassungen in Krisen-Zeiten) u.a.m.
Sich hiergegen aufzulehnen, ist mit Ethik und Moral allein nicht möglich. Dazu bedarf es vielmehr politischer Gegenwehr mit langem Atem, zumal dann, wenn weder ein „revolutionäres Subjekt“ noch ein entsprechendes Klassen-Bewusstsein vorhanden ist. Dennoch brauchen die ethischen Forderungen davor nicht zu kapitulieren. Vielmehr sind sie in die antikapitalistische Veränderungsethik aufzunehmen, wie sie Ernst Bloch konzipiert hat. Eine solche Ethik kann und muss auch den reformerischen bis revolutionären Kampf stützen, getreu der Marxschen Devise, dass die Philosophie sich nicht verwirklichen kann, ohne sich „aufzuheben“ – dies wohl auch im Hegelschen Sinne des Begriffs „Aufhebung“: Die Philosophie soll nicht mehr nur in den Köpfen stattfinden, sondern die gesamte Realität beeinflussen und durchwirken. Philosophie ist dann nicht mehr, was sie traditionell-idealistisch war, sondern gewinnt neue Qualitäten als effektiver Teil der Wirklichkeit selbst.
Dem entspricht jedenfalls mein Modell eines Demokratischen Ökosozialismus, das ich schon mehrfach (2015, 2017, 2020) vorgetragen habe. Es geht darin vor allem um allgemeine kulturelle und politische Emanzipation, neue, sozialistische Formen einer digital gestützten Wirtschaftsplanung, direkte Demokratie, Marktsozialismus und Wirtschaftsdemokratie. (Vgl. Robra a.a.O. S. 34-36)
Fazit
Was hat nun dies alles mit der Frage nach dem Glück zu tun, von dem es ja in unserer Nationalhymne, dem Deutschlandlied, heißt, Einigkeit, Recht und Freiheit seien seine Grundlagen? Nun, relevant, wenn nicht unabdingbar, sind die drei Faktoren nicht zuletzt deshalb, weil sie sich sowohl auf die individuellen als auch die kollektiven Glücksbedürfnisse und -interessen beziehen. Die Menschen wollen mit sich selbst „einig“ sein, d.h. glücklich werden, möglichst ihren Glücks-Bedürfnissen entsprechend leben können. Uneingeschränkt ist dies schon deshalb nicht erreichbar, weil völlige Einigkeit bisher anscheinend in keiner Gesellschaft geherrscht hat. Erst recht nicht in einer Klassengesellschaft unter kapitalistischen Vorzeichen. – Was wohl auch für den Faktor Recht zutrifft. Das Recht ist zweifellos Teil der Allgemeinen Gesetzgebung und damit des Sittengesetzes, das sowohl in Kants Kat. Imp. als auch in meiner Legitimen Forderung (s.o.) eine maßgebliche Rolle spielt. Ohne Recht kann es dauerhaftes Glück nicht geben. Mit Recht nur so lange, wie es nicht überstrapaziert oder gar missbraucht wird und dadurch in Unrecht umschlägt..
Noch komplizierter erscheinen die Bedingungen, unter denen Freiheit zum Garanten von Glück werden kann. Unglücklich sind Menschen, denen es verwehrt wird, ihrem freien Willen, ihrer freien Einsicht, z.B. auch in Gut und Böse, zu folgen.35 – Größtmögliche Freiheit und höchstes Glück verspricht Marxens Reich der Freiheit, in dem die Menschen sowohl innerlich als auch äußerlich frei sind, d.h. als freie Individuen in freien Assoziationen ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten gemäß leben können. Im deutschen Grundgesetz wird zwar Ähnliches garantiert, so z.B. die Würde des Menschen und die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Beides wird jedoch in einer kapitalistischen Klassen- und Ausbeutungsgesellschaft immer wieder verletzt. Hier scheint es vorerst wenig Fortschritte zu geben, zumal der kapitalistische Neoliberalismus – neben autokratischen und diktatorischen Herrschaftsformen – sich anscheinend weltweit immer mehr durchsetzt.
Dagegen die konkrete Utopie eines Demokratischen Ökosozialismus zu setzen, mag gewagt erscheinen, ist aber unumgänglich, zumal weltweit zunehmendes Unrecht, Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Zwietracht und Verelendung dauerhaft nicht erträglich sind und der hymnische Vers „Blüh‘ im Glanze dieses Glückes!“ angesichts dieser Situation irgendwie zynisch klingt.
Literaturverzeichnis
Admin 2021: Eros und Thanatos: Freuds zwei fundamentale Triebe, https://isnca.org/eros-und-thanatos-freuds-zwei-fundamentale-triebe/
Aristoteles 1995: Nikomachische Ethik
Aristoteles: Nikomachische Ethik, in: Gerd Gerhardt: Grundkurs Philosophie, Bd. 2, München 2000
Freud, Sigmund 1972: Abriß der Psychoanalyse, Das Unbehagen in der Kultur, Frankfurt a.M.
Gerhardt, Gerd 2000: Grundkurs Philosophie, Bd. 2, München
Hesse, Hermann: ‚Glück‘, in: https://de.wikipedia.org/wiki/GI%C3%BCck
Kant, Immanuel 1956: Kritik der reinen Vernunft (1781/87). Hamburg
Kant, Immanuel 1965: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785), Hamburg
Kant, Immanuel 1967: Kritik der praktischen Vernunft (1788), Hamburg
Kant, Immanuel 2008: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Stuttgart
Kraus, Oskar 1937: Die Werttheorien, Brünn u.a.
Mooslechner-Brüll, Cornelia 2019: Über die Messbarkeit des Glücks, in: https://ethik-heute.org/ueber-die-messbarkeit-des-glücks/
Robra, Klaus 2015: Wege zum Sinn, Hamburg
Robra, Klaus o.J. (2020): Ethik der Verhaltenssteuerung. Eine Neubegründung, München, https://www.grin.com/document/923015
Robra, Klaus 2021: Sind die Diktatur des Proletariats und die Bürokratie das Ende des Sozialismus? Die Frage nach Auswegen aus den Sackgassen, München, https://www.grin.com/document/1032082
Robra, Klaus 2022: Gut und Böse. Das Gute als Ursprung und Überwindung des Bösen – oder umgekehrt? Eine neue Hypothese, München, https://www.grin.com/document/1297008
Tarrach, Maximilian 2020: Das Problem des Utilitarismus, in: https://maximiliantarrach.de/das-problem-des-utilitarismus/
Verschiedene Arten des modernen Utilitarismus , in: https://fusedlearning.com/different-types-modern-utilitarianism#m...
Wörterbuch der philosophischen Begriffe , Darmstadt 1998
[...]
1 H. Hesse, in: Glück – Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/GI%C3%BCck, S. 19
2 s. Glück-Wikipedia a.a.O. S. 2
3 Dies vor allem in den Schriften Jenseits des Lustprinzips (1920), Das Unbehagen in der Kultur (1930) und Abriß der Psychoanalyse (1938): hierzu: Freud 1972.
4 Vgl. Freud 1972, S. 74
5 So bei Admin 2021, S. 6 (s. Literaturverzeichnis)
6 Freud 1972, S. 13
7 Vgl. Admin 2021, S. 6
8 Aristoteles: Nikomachische Ethik, in: Gerd Gerhardt: Grundkurs Philosophie, Bd. 2, München 2000 S. 40
9 Hierzu auch die Übersicht bei G. Gerhardt a.a.O. S. 39
10 Oskar Kraus: Die Werttheorien, Brünn u.a. 1937, S. 27
11 Aristoteles: Nikomachische Ethik, Hamburg 1995, S. 247
12 Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Darmstadt 1998, S. 149
13 Vgl. Robra 2015, S. 27 ff.
14 Kant 1967, S. 28
15 Kant 1965, S. 16 f.
16 Kant 1967, S. 41
17 Kant 1965, S. 39
18 Kant 1967, S. 130
19 Kant 2008, S. 224
20 Kant 1967, S. 149
21 Höffe, in: Gerhardt a.a.O. S. 45
22 Cicero online: Summum ius…, https://www.cicero.de/comment/136729 In: Robra o.J. (2020), S. 13
23 Vgl. Eisler 1964, S. 4
24 zitiert von Eisler a.a.O. S. 5
25 Vgl. Robra o.J. (2020), S. 11
26 Kant 1956, S. 526
27 Kant 1965, S. 91. Näheres zu meiner Kritik an Kants Ethik in. Robra o.J. (2020), S. 7 ff.
28 Vgl. Robra 2015, S. 279 f.
29 Mooslechner-Brüll 2019, S. 2-4
30 Verschiedene Arten des modernen Utilitarismus, in: https://fusedlearning.com/different-types-modern-utilitarianism#m..., S. 4
31 Tarrach 2020, S. 1 f.
32 In: www.achtsame-wirtschaft.de>fl_files>netzwerk_achtsame
33 Vgl. Robra 2022
34 Vgl. Matthias Möhring-Hesse, in: www.ethik-und-gesellschaft.de>article>domnload>1-2018 ast4; s. auch Robra 2020, S. 121-125, sowie Robra 2021
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text untersucht den Begriff des Glücks aus verschiedenen philosophischen Perspektiven, von der Antike bis zur Moderne. Er analysiert unterschiedliche Ansätze, wie Glück definiert und erreicht werden kann, und würdigt die Kontroversen und Herausforderungen, die mit diesem Konzept verbunden sind.
Welche Philosophen und Denker werden im Text behandelt?
Der Text behandelt unter anderem Platon, Aristoteles, Epikur, Nietzsche, Sigmund Freud, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Ernst Bloch und Karl Marx.
Wie definiert Freud das Glück?
Freud betont die Bedeutung des Glücks für die Frage nach Sinn und Zweck des Lebens, leugnet aber fast vollständig die Möglichkeit dauerhaften Glücks. Er sieht das Streben nach Glück in der Abwesenheit von Schmerz und Unlust sowie im Erleben starker Glücksgefühle, hält aber dauerhaftes Glück aufgrund der Konstitution des Menschen und der vielfältigen Möglichkeiten des Unglücks für unerreichbar.
Inwiefern unterscheidet sich Aristoteles' Sichtweise von der Freuds?
Aristoteles glaubt, dass dauerhaftes Glück möglich ist, wenn auch nicht mit Garantie. Für ihn basiert Glück auf einem bestimmten Menschenbild, das er auf seine Seelen-, Wert- und Tugendlehre gründet. Er betont die Bedeutung der Vernunft, der Charaktertugenden und eines „vollen Lebens“ für das Erreichen von Glückseligkeit.
Was kritisiert Kant an Aristoteles' Glücksethik?
Kant kritisiert Aristoteles dafür, etwas rein Subjektives – die eigene „Glückseligkeit“ – zum Bestimmungsgrund des Willens und des Handelns zu machen. Er unterscheidet zwischen dem Empfinden von Lust und Unlust und der Reflexion über dieses Empfinden und hält das Glück für subjektiv bedingt, was verhindert, dass es jemals zum Gesetz werden kann.
Was ist der Utilitarismus und welche Rolle spielt das Glück darin?
Der Utilitarismus ist die Lehre vom Nützlichen, die nach dem „größten Glück der größten Zahl“ strebt. Jeremy Bentham und John Stuart Mill sind wichtige Vertreter des Utilitarismus. Sie versuchen, ein System zu entwerfen, auf dessen Basis die moralisch richtige Entscheidung getroffen werden kann, wobei Lust und Freude gefördert und Unlust und Leid vermieden werden sollen.
Welche Kritik wird am Utilitarismus geübt?
Kritiker bemängeln, dass das Konzept des „größten Glücks“ schwer zu definieren ist und dass Freiheit und Glück in Konflikt miteinander geraten können. Es besteht auch die Gefahr, dass der Staat Freiheiten einschränkt, um das Glück der Bürger zu maximieren, was zu Totalitarismus führen kann.
Welche Alternativen werden im Text vorgeschlagen, um individuellen und kollektiven Glücksbedürfnissen gerecht zu werden?
Der Text schlägt eine sozialistische Forderung vor: "Jede/r nach ihren/seinen Bedürfnissen, jede/r nach ihren/seinen Fähigkeiten!" Dies entspricht weitgehend denjenigen Faktoren, die schon Aristoteles als Voraussetzung für das Glücklich-Sein nannte. Der Text betont die Notwendigkeit einer „erkennbaren Ethik des angemessenen Lebens, Arbeitens und Zusammenlebens“ sowie einer Öko-Ethik, die Mensch und Natur gleichermaßen berücksichtigt.
Was ist die "legitime Forderung" des Autors und welche Rolle spielt sie im Kontext der Glücksdiskussion?
Die "legitime Forderung" des Autors lautet: *Achte bei allem, was Du tust, darauf, Dich selbst und Deine Mit-Menschen als Rechtspersonen und Persönlichkeiten zu respektieren und möglichst stets das Sittengesetz zu befolgen.* Diese Forderung dient als Grundlage für eine personale Wertethik, die sowohl individuelle als auch gemeinschaftliche Interessen in Einklang bringen soll.
Was ist das Fazit des Textes?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass eine umfassende Theorie und Praxis erforderlich sind, um sowohl den individuellen als auch den kollektiven Glücksbedürfnissen und -interessen gerecht zu werden. Er betont die Bedeutung von Einigkeit, Recht und Freiheit als Grundlagen für das Glück und plädiert für einen demokratischen Ökosozialismus als konkrete Utopie, um der zunehmenden Ungerechtigkeit, Ausbeutung und Verelendung entgegenzuwirken.
- Quote paper
- Dr. Klaus Robra (Author), Glück - was ist das?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1329205