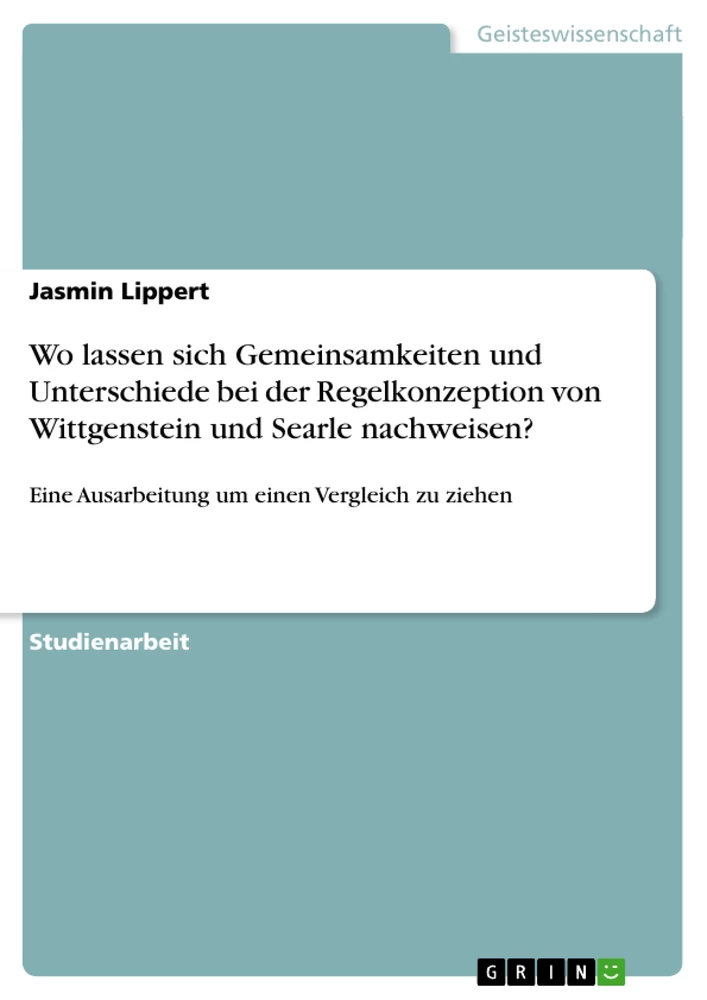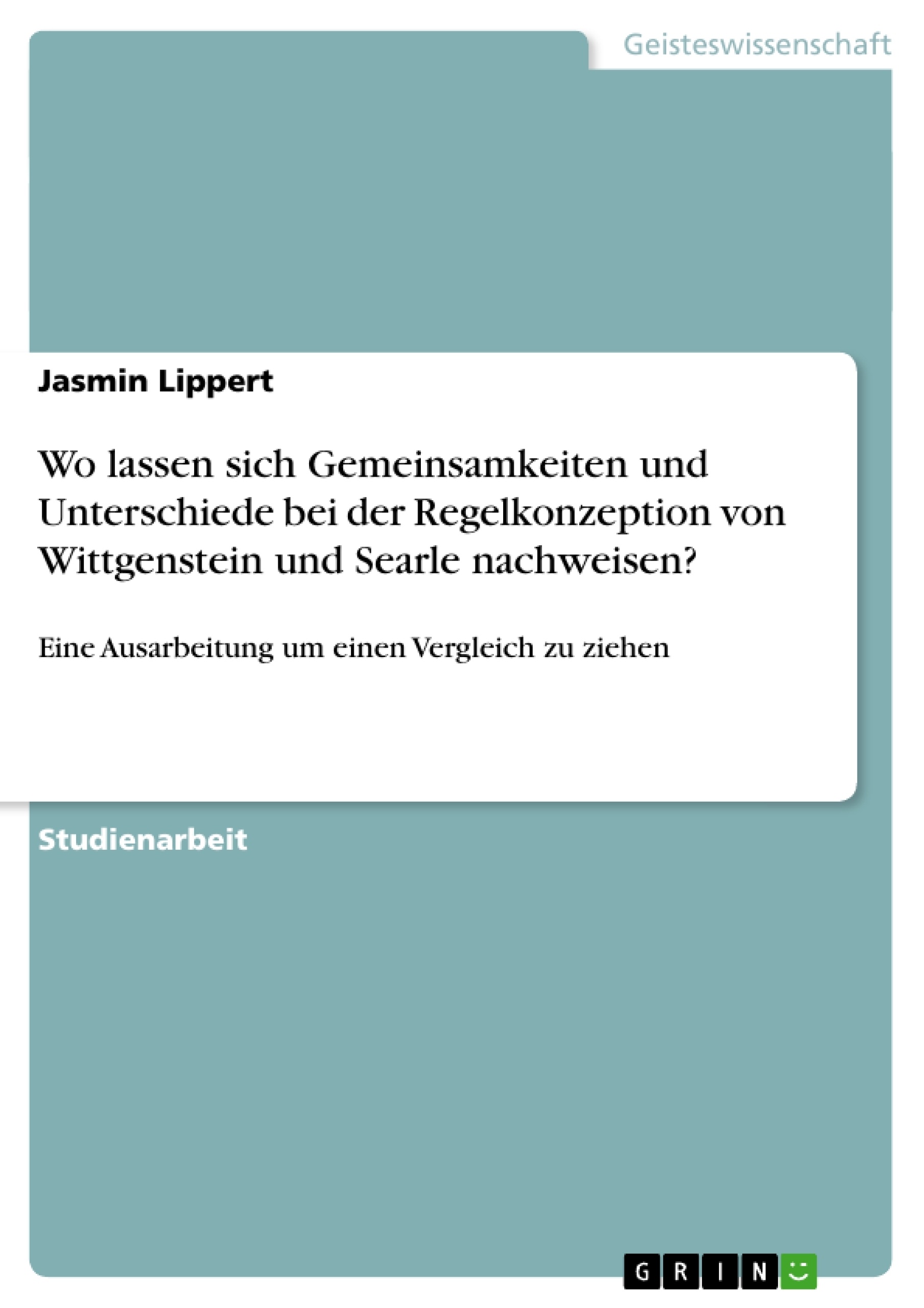Einen sehr gewichtigen Schwerpunkt und einen interessanten Aspekt in der Politikwissenschaft und den internationalen Beziehungen der Länder setzt die Sprachphilosophie. Um Gesetzestexte und institutionelle Regeln in unserer Gesellschaft zu hinterfragen und um wissenschaftliche Texte zu analysieren und zu interpretieren ist es relevant über Grundkenntnisse der Sprachphilosophie zu verfügen.
Zwei herausragende Theoretiker in der Sprachphilosophie sind Ludwig Wittgenstein und John R. Searle. Ich habe es mir in meiner Seminararbeit zur Aufgabe gemacht, zu untersuchen inwieweit die Regelkonzeptionen in den Theorien der Sprachphilosophie ineinander übergreifen, sich ergänzen, oder konträr zueinander stehen. Ich möchte Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausarbeiten und letztendlich einen Vergleich ziehen. Ich bemühe mich in meiner Ausarbeitung eigene Beispiele einzubringen, um damit dargestellte Aspekte transparenter zu machen. Obwohl die beiden Schwerpunkte sicherlich sehr viel Stoff für wissenschaftliche Ausarbeitungen und Abhandlungen liefern, werde ich mich nur auf zentrale Aspekte der Regelkonzeption beziehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Regelkonzeption nach Wittgenstein
- 2.1 Regelkonzeption nach Searle
- 3. Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Regelkonzeption nach Wittgenstein und Searle
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Regelkonzeptionen von Wittgenstein und Searle im Hinblick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ziel ist es, einen Vergleich dieser Konzeptionen im Kontext der Sprachphilosophie und ihrer Relevanz für die Politikwissenschaft zu ziehen. Die Arbeit beleuchtet die Anwendung und Interpretation von Regeln, insbesondere im Bereich der Sprachspiele.
- Vergleich der Regelkonzeptionen von Wittgenstein und Searle
- Analyse der Anwendung und Interpretation von Regeln
- Untersuchung der Relevanz der Sprachphilosophie für die Politikwissenschaft
- Beispiele zur Veranschaulichung der Konzepte
- Abgrenzung der Fragestellung auf zentrale Aspekte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung der Sprachphilosophie für die Politikwissenschaft und die Analyse von Gesetzestexten und institutionellen Regeln. Sie umreißt die Zielsetzung der Arbeit, nämlich den Vergleich der Regelkonzeptionen von Wittgenstein und Searle hinsichtlich ihrer Überschneidungen und Unterschiede, unter Einbezug eigener Beispiele zur Veranschaulichung. Die Arbeit konzentriert sich auf zentrale Aspekte der Regelkonzeptionen, ohne deren volle Komplexität erschöpfend zu behandeln. Die Gliederung der Arbeit wird erläutert.
2. Regelkonzeption nach Wittgenstein: Dieses Kapitel präsentiert Wittgensteins Regelkonzeption, die besagt, dass das Wissen um eine Regel nicht zwingend für deren Befolgung notwendig ist. Regeln erhalten ihre Bedeutung durch Anwendung, wie am Beispiel des Tanzlernens ohne explizite Erklärung illustriert wird. Der Gebrauch von Regeln wird mit der Interpretation eines Wegweisers verglichen, um die Uneindeutigkeit von Regelanwendungen zu betonen. Das Kapitel diskutiert die Schwierigkeit, Wittgensteins Verständnis von „Sprachregeln“ explizit zu definieren, und präsentiert einige zentrale Aspekte aus Andreas Kemmerlings Analyse, die Wittgensteins implizite Regelauffassung herausstellen, darunter die Unterscheidung zwischen Regel und deren Ausdruck, die meist implizite Geltung von Sprachregeln und deren willkürlichen (konventionellen) Charakter. Des Weiteren wird die Unterscheidung zwischen „Kalkülregeln“ und anderen Regeltypen erläutert, wobei die eindeutige und leicht verständliche Natur von Kalkülregeln hervorgehoben wird, am Beispiel des Spiels „Mensch ärgere Dich nicht“.
2.1 Regelkonzeption nach Searle: [Da der Text keine Informationen zu Searle's Regelkonzeption enthält, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.]
3. Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Regelkonzeption nach Wittgenstein und Searle: [Da der Text keine Informationen zu einem Vergleich beider Konzeptionen enthält, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.]
Schlüsselwörter
Sprachphilosophie, Regelkonzeption, Wittgenstein, Searle, Sprachspiele, Regelinterpretation, Politikwissenschaft, Gesetzestexte, institutionelle Regeln, Kalkülregeln, implizite Regeln.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Regelkonzeptionen nach Wittgenstein und Searle
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit vergleicht die Regelkonzeptionen von Ludwig Wittgenstein und John Searle. Der Fokus liegt auf Gemeinsamkeiten und Unterschieden dieser Konzeptionen im Kontext der Sprachphilosophie und ihrer Relevanz für die Politikwissenschaft. Die Arbeit analysiert die Anwendung und Interpretation von Regeln, insbesondere im Bereich der Sprachspiele.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: einen Vergleich der Regelkonzeptionen von Wittgenstein und Searle, die Analyse der Anwendung und Interpretation von Regeln, die Untersuchung der Relevanz der Sprachphilosophie für die Politikwissenschaft, Beispiele zur Veranschaulichung der Konzepte und eine Abgrenzung der Fragestellung auf zentrale Aspekte.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Wittgensteins Regelkonzeption, ein Unterkapitel zu Searles Regelkonzeption (leider ohne konkreten Inhalt im vorliegenden Auszug), ein Kapitel zum Vergleich beider Konzeptionen (ebenfalls ohne konkreten Inhalt im vorliegenden Auszug) und ein Fazit. Die Einleitung betont die Bedeutung der Sprachphilosophie für die Politikwissenschaft und die Analyse von Gesetzestexten und institutionellen Regeln.
Wie wird Wittgensteins Regelkonzeption dargestellt?
Die Darstellung von Wittgensteins Regelkonzeption betont, dass das Wissen um eine Regel nicht zwingend für deren Befolgung notwendig ist. Regeln erhalten ihre Bedeutung durch Anwendung. Der Gebrauch von Regeln wird mit der Interpretation eines Wegweisers verglichen, um die Uneindeutigkeit von Regelanwendungen zu betonen. Die Arbeit diskutiert die Schwierigkeit, Wittgensteins Verständnis von „Sprachregeln“ explizit zu definieren und bezieht sich auf die Analyse von Andreas Kemmerling, die Wittgensteins implizite Regelauffassung hervorhebt (Unterscheidung zwischen Regel und deren Ausdruck, meist implizite Geltung von Sprachregeln und deren willkürlichen Charakter). Es wird auch die Unterscheidung zwischen „Kalkülregeln“ und anderen Regeltypen erläutert.
Was wird über Searles Regelkonzeption gesagt?
Der vorliegende Textauszug enthält keine Informationen zu Searles Regelkonzeption. Daher kann keine Zusammenfassung zu diesem Aspekt gegeben werden.
Wie werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Wittgenstein und Searle verglichen?
Der vorliegende Textauszug enthält keine Informationen zum Vergleich der Regelkonzeptionen von Wittgenstein und Searle. Daher kann keine Zusammenfassung zu diesem Aspekt gegeben werden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Sprachphilosophie, Regelkonzeption, Wittgenstein, Searle, Sprachspiele, Regelinterpretation, Politikwissenschaft, Gesetzestexte, institutionelle Regeln, Kalkülregeln, implizite Regeln.
- Citar trabajo
- Jasmin Lippert (Autor), 2005, Wo lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Regelkonzeption von Wittgenstein und Searle nachweisen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132852