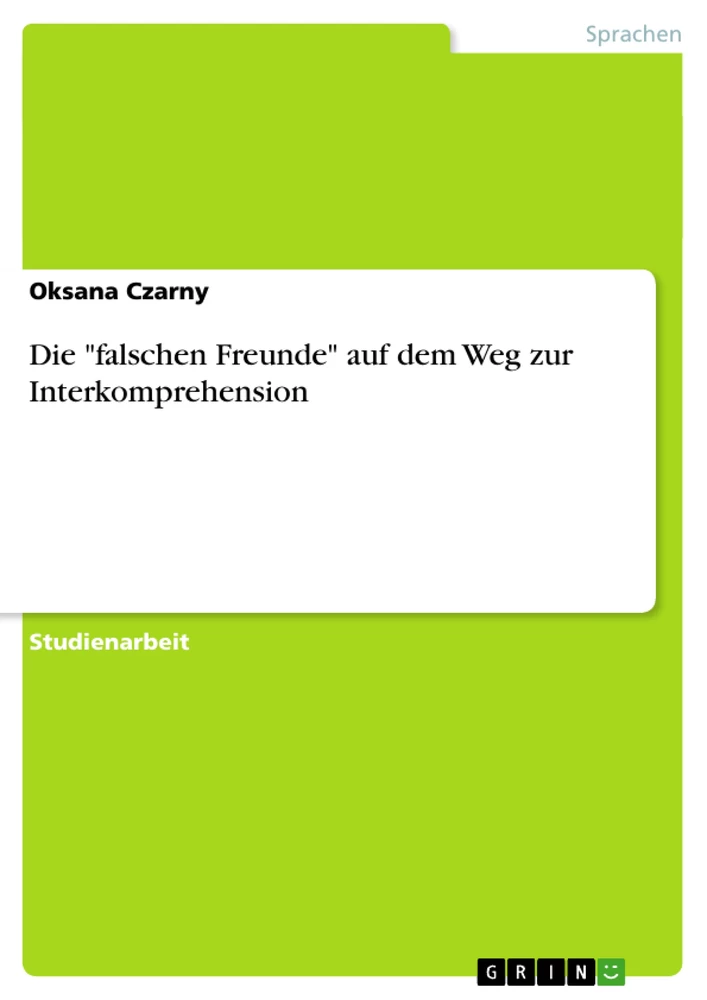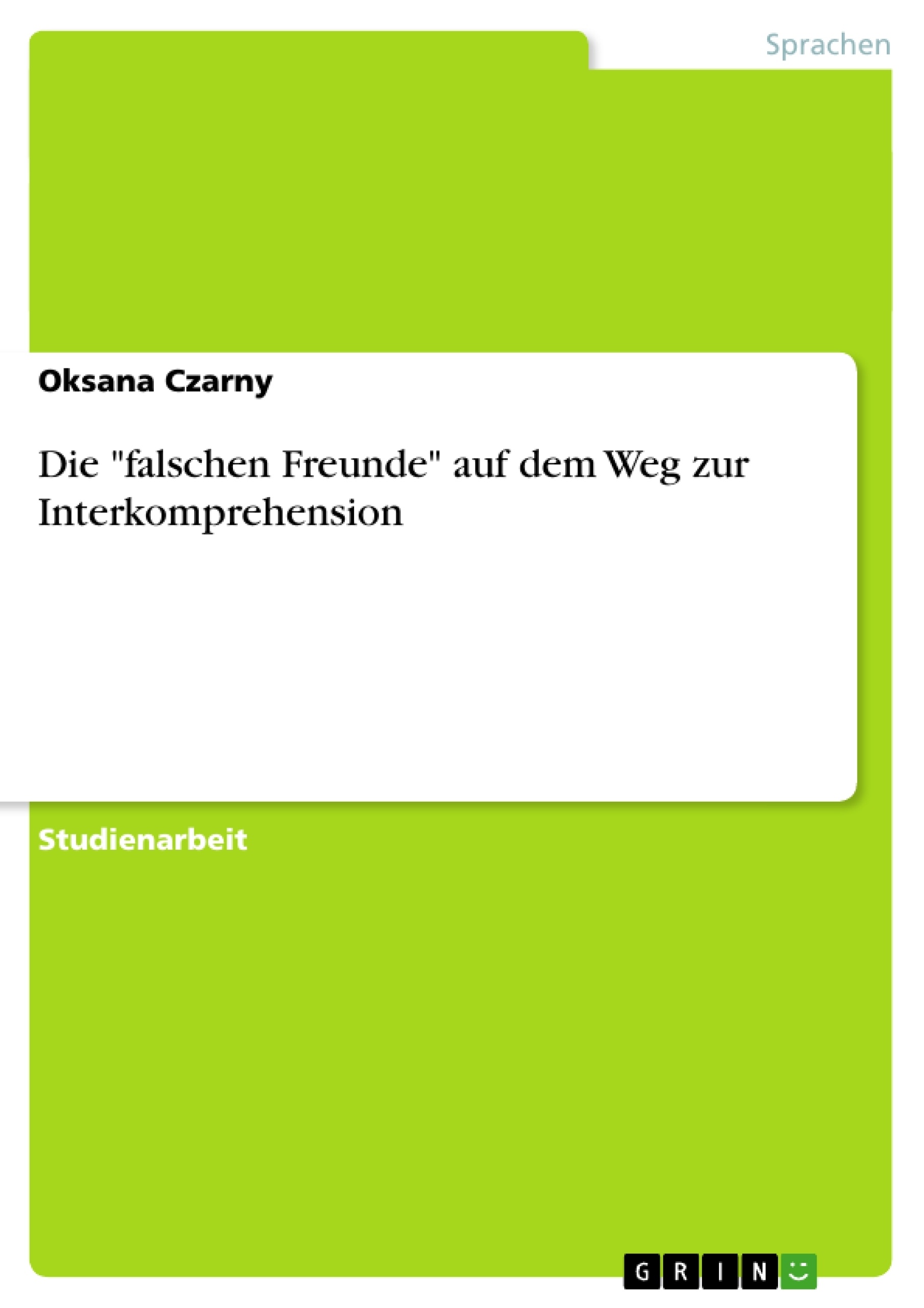Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit widmet sich dem Problem der „falschen Freunde (des Übersetzers)“ unter besonderer Berücksichtigung des theoretischen Blickwinkels auf diese sprachliche Erscheinung. Die theoretische Auseinandersetzung mit diesem komplexen Thema wird durch Beispiele aus unterschiedlichen Sprachenpaaren ergänzt, damit deutlich wird, dass „faux amis“ sowohl in genetisch verwandten, als auch nicht miteinander nah verwandten Sprachen vorkommen können. Das ist auch wichtig unter dem Aspekt der Interkomprehension, deren Methode Sprachbenutzer mit diversen Brückensprachen verwenden, um zusätzliche Kompetenzen in einer (weiteren) Fremdsprache zu erwerben.
Die Gliederung der Arbeit umfasst acht Punkte. Da dieses sprachwissenschaftliche Problem sehr breit gefächert ist, war eine Einschränkung auf einige Themenbereiche nötig. Zunächst wird auf die begriffliche Vielfalt und terminologische Definition der „falschen Freunde“ eingegangen. Dann geben die auf Fehlertypen beruhenden Sprachmodelle erste Einblicke in die anschließende Klassifikation, die auf vier Divergenzen, nämlich den semantischen, formalen, grammatischen sowie syntaktischen, beruht. Folgend werden Arten interlingualer Bedeutungsrelation und die Beziehung zwischen Internationalismen und „falschen Freunden“ analysiert. Eigene Überlegungen zum Umgang mit dieser sprachwissenschaftlichen Erscheinung innerhalb der Interkomprehension schließen den Hauptteil der Hausarbeit ab.
Alle Zitate und Beispielwörter wurden nicht transliteriert, sondern in der Beschreibungssprache bzw. Sprache des Originals belassen.
Die vorliegende Hausarbeit verfolgte das Ziel, zu verdeutlichen, dass es sich sowohl aus theoretischer Perspektive als auch praktischen Gründen lohnt, diesem Problem große Aufmerksamkeit zu schenken. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema zeigt auch, dass die „falschen Freunde“ nicht nur als eine unerschöpfliche Fehlerquelle und somit auch als Hindernis beim Erwerb von Sprachkenntnissen betrachtet werden dürfen, sondern in vieler Hinsicht als eine Bereicherung.
Die Aktualität des zu untersuchenden Themas besteht darin, dass man im zusammenwachsenden und zunehmend mehrsprachigen Europa nicht auf Kosten des Sprachverständnisses an seiner Einsprachigkeit festhalten, sondern u. a. die Interkomprehensionsmethode dazu nutzen sollte, sich sprachlich fortzubilden und damit auch kulturell weiterzuentwickeln.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Terminologischer Ursprung und begriffliche Vielfalt
- 2. Das Problem der terminologischen Definition
- 3. Die auf Fehlertypen beruhenden Sprachmodelle
- 4. Klassifikationen von „falschen Freunden“
- 4.1. Semantische Gruppe
- 4.2. Formale Kategorie
- 4.3. Grammatische Divergenzen
- 4.4. Syntaktische Unterschiede
- 5. Arten interlingualer Bedeutungsrelationen zwischen „falschen Freunden“
- 6. „Falsche Freunde“ und Internationalismen
- 7. Die trügerische Nähe
- 8. Der Umgang mit „falschen Freunden“ innerhalb der Interkomprehensionsmethode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der „falschen Freunde“ (des Übersetzers) aus sprachwissenschaftlicher Perspektive. Sie beleuchtet die begriffliche Vielfalt, die terminologische Definition und die Klassifizierung dieser sprachlichen Erscheinung anhand verschiedener Divergenzen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Interferenzgefahr und dem Umgang mit „falschen Freunden“ im Kontext der Interkomprehensionsmethode.
- Begriffliche Klärung und terminologische Definition von „falschen Freunden“
- Klassifizierung von „falschen Freunden“ nach semantischen, formalen, grammatischen und syntaktischen Kriterien
- Analyse der Interferenzgefahr durch „falsche Freunde“
- Beziehung zwischen „falschen Freunden“ und Internationalismen
- Der Einsatz von Interkomprehensionsmethoden im Umgang mit „falschen Freunden“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Terminologischer Ursprung und begriffliche Vielfalt: Dieses Kapitel beleuchtet den Ursprung des Begriffs "falsche Freunde" im Französischen ("faux amis") und seine Übersetzung in verschiedene Sprachen. Es unterstreicht die begriffliche Vielfalt und die unterschiedlichen Bezeichnungen für dieses Phänomen in der Linguistik, von "zwischensprachlichen Homonymen" bis hin zu "Pseudo-Analogonymen". Die Diskussion verdeutlicht die Notwendigkeit einer präzisen Definition, da die verschiedenen Termini unterschiedliche Aspekte des Problems hervorheben.
2. Das Problem der terminologischen Definition: Das Kapitel behandelt die Uneinigkeit in der Sprachwissenschaft bezüglich der Definition von "falschen Freunden". Es betont den metaphorischen Charakter des Begriffs und die damit verbundenen Schwierigkeiten. Der Fokus liegt auf der semantischen Gruppe als dem wichtigsten Kerntyp, der große Schwierigkeiten in der Kommunikation verursachen kann. Die Diskussion umfasst verschiedene Ansätze zur Definition, einschließlich der Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung der etymologischen Verwandtschaft der Wörter.
3. Die auf Fehlertypen beruhenden Sprachmodelle: Dieses Kapitel (obwohl kurz im Auszug) legt den Grundstein für die nachfolgende Klassifizierung der "falschen Freunde". Es stellt die verschiedenen Fehlertypen vor, die durch die formale Ähnlichkeit, aber semantische Unterschiede entstehen können, und bereitet den Leser auf die detailliertere Klassifizierung in den folgenden Abschnitten vor.
4. Klassifikationen von „falschen Freunden“: Dieses Kapitel präsentiert eine Klassifizierung von "falschen Freunden" nach vier Divergenzen: semantischen, formalen, grammatischen und syntaktischen Unterschieden. Es bietet eine strukturierte Übersicht über die verschiedenen Kategorien und ihre Bedeutung für die Erkennung und Vermeidung von Fehlern im Sprachgebrauch. Die Unterkapitel 4.1 bis 4.4 gehen detaillierter auf die jeweilige Kategorie ein und bieten ein breiteres Verständnis der Klassifizierung.
5. Arten interlingualer Bedeutungsrelationen zwischen „falschen Freunden“: Das Kapitel analysiert die verschiedenen Arten von Bedeutungsrelationen zwischen "falschen Freunden". Es untersucht, wie die formale Ähnlichkeit zu Missverständnissen führen kann und erklärt die Mechanismen, die hinter solchen Fehlern stecken. Die Analyse hilft, die komplexen Beziehungen zwischen scheinbar ähnlichen Wörtern in verschiedenen Sprachen besser zu verstehen.
6. „Falsche Freunde“ und Internationalismen: Dieses Kapitel untersucht die Beziehung zwischen "falschen Freunden" und Internationalismen. Es analysiert, wie die internationale Verbreitung bestimmter Wörter zu Verwechslungen und Fehlern führen kann und wie der Kontext entscheidend für die richtige Interpretation ist. Die Untersuchung verdeutlicht, dass die Ähnlichkeit von Wörtern nicht immer ein Garant für gleiche Bedeutung ist.
7. Die trügerische Nähe: Dieses Kapitel (kurz im Auszug) befasst sich mit der Problematik der scheinbaren Nähe von Wörtern, die trotz ähnlicher Form unterschiedliche Bedeutungen haben, und hebt die Notwendigkeit einer sorgfältigen Analyse hervor.
8. Der Umgang mit „falschen Freunden“ innerhalb der Interkomprehensionsmethode: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung von "falschen Freunden" im Kontext der Interkomprehensionsmethode. Es analysiert, wie dieses Phänomen die Sprachlernprozesse beeinflusst und wie man im Unterricht oder beim Selbststudium damit umgehen kann. Es unterstreicht die Relevanz des Themas für mehrsprachiges Lernen und Verständnis.
Schlüsselwörter
Falsche Freunde, Faux amis, Interkomprehension, Interferenzfehler, Sprachvergleich, Lexikologie, Terminologie, Semantik, Grammatik, Syntax, Internationalismen, Übersetzung, Sprachlernprozesse, Mehrsprachigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: "Falsche Freunde" (des Übersetzers)
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Phänomen der „falschen Freunde“ (des Übersetzers) aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Sie beleuchtet die begriffliche Vielfalt, die terminologische Definition und die Klassifizierung dieser sprachlichen Erscheinung anhand verschiedener Divergenzen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Interferenzgefahr und dem Umgang mit „falschen Freunden“ im Kontext der Interkomprehensionsmethode.
Welche Aspekte der „falschen Freunde“ werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den terminologischen Ursprung und die begriffliche Vielfalt von „falschen Freunden“, das Problem ihrer terminologischen Definition, verschiedene auf Fehlertypen beruhende Sprachmodelle, Klassifikationen nach semantischen, formalen, grammatischen und syntaktischen Kriterien, Arten interlingualer Bedeutungsrelationen, den Zusammenhang mit Internationalismen, die „trügerische Nähe“ und schließlich den Umgang mit „falschen Freunden“ in der Interkomprehensionsmethode.
Wie werden „falsche Freunde“ definiert und klassifiziert?
Die Arbeit diskutiert die Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition aufgrund des metaphorischen Charakters des Begriffs. Es werden verschiedene Klassifikationen vorgestellt, insbesondere eine detaillierte Einteilung nach semantischen, formalen, grammatischen und syntaktischen Unterschieden. Die semantische Gruppe wird als der wichtigste Kerntyp hervorgehoben, der zu großen Kommunikationsschwierigkeiten führen kann.
Welche Rolle spielen Internationalismen?
Die Arbeit analysiert die Beziehung zwischen „falschen Freunden“ und Internationalismen. Sie untersucht, wie die internationale Verbreitung bestimmter Wörter zu Verwechslungen führen kann und wie wichtig der Kontext für die richtige Interpretation ist. Die Ähnlichkeit von Wörtern garantiert nicht die gleiche Bedeutung.
Wie werden „falsche Freunde“ im Kontext der Interkomprehensionsmethode behandelt?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von „falschen Freunden“ für die Interkomprehensionsmethode, analysiert deren Einfluss auf Sprachlernprozesse und bietet Hinweise zum Umgang mit diesem Phänomen im Unterricht oder beim Selbststudium. Die Relevanz für mehrsprachiges Lernen und Verständnis wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Falsche Freunde, Faux amis, Interkomprehension, Interferenzfehler, Sprachvergleich, Lexikologie, Terminologie, Semantik, Grammatik, Syntax, Internationalismen, Übersetzung, Sprachlernprozesse, Mehrsprachigkeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: 1. Terminologischer Ursprung und begriffliche Vielfalt; 2. Das Problem der terminologischen Definition; 3. Die auf Fehlertypen beruhenden Sprachmodelle; 4. Klassifikationen von „falschen Freunden“ (mit Unterkapiteln zu semantischen, formalen, grammatischen und syntaktischen Unterschieden); 5. Arten interlingualer Bedeutungsrelationen zwischen „falschen Freunden“; 6. „Falsche Freunde“ und Internationalismen; 7. Die trügerische Nähe; 8. Der Umgang mit „falschen Freunden“ innerhalb der Interkomprehensionsmethode.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Phänomen der „falschen Freunde“ aus sprachwissenschaftlicher Perspektive zu untersuchen, begriffliche Klarheit zu schaffen, verschiedene Klassifizierungssysteme zu präsentieren und die Bedeutung dieser sprachlichen Erscheinung für die Interkomprehensionsmethode zu beleuchten.
- Quote paper
- M.A., Mag. Oksana Czarny (Author), 2008, Die "falschen Freunde" auf dem Weg zur Interkomprehension, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132823