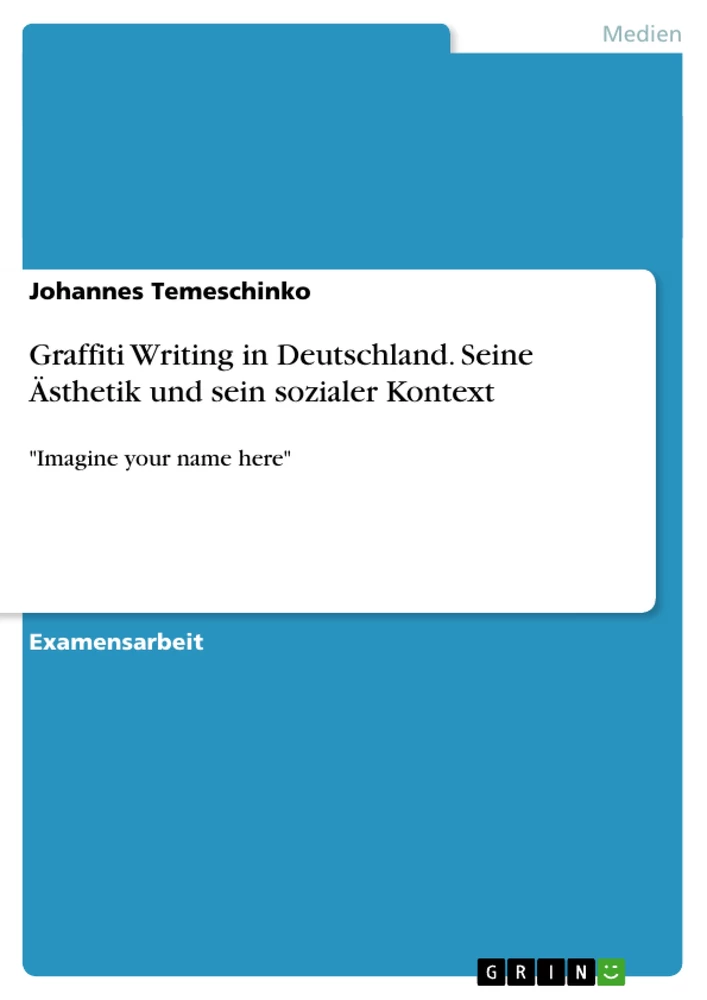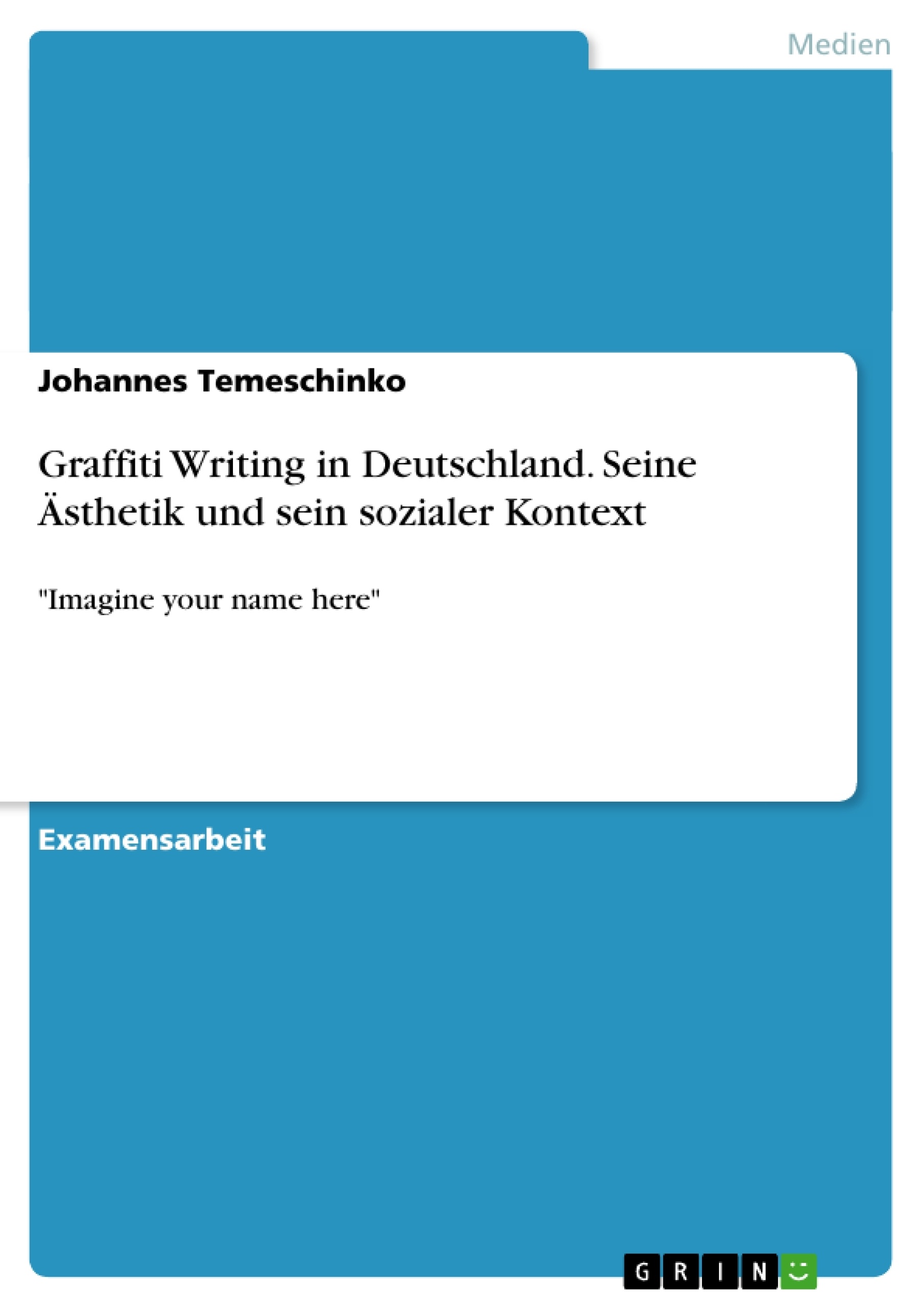Die Fahrt von der S-Bahnstation Berlin Schönhauser Allee über den ehemaligen Grenzstreifen, der bis 1989 die Stadt teilte, bis zur Station Gesundbrunnen im Wedding dauert heute nur noch knapp anderthalb Minuten. Aber in diesen anderthalb Minuten rauscht der arglose Passagier an einer Menge visuellen Inputs vorbei, der seinesgleichen sucht.
BAD, DISTER, AKIM, EHSONE ... Namen von unmissverständlicher Intensität.
Meterhoch und dichtgedrängt kleben sie an den Wänden der Tunnel, an den Brückenpfeilern und Häuserfassaden, an den Schallschutzmauern und den Betonabdichtungen. Groß, bunt und ins Auge stechend – man kann sich ihrer optischen Präsenz gar nicht entziehen, selbst wenn man es wollte.
Das Schauen aus dem Fenster rückt ohne Ausweichmöglichkeit Bilder ins Blickfeld des Betrachters, die heutzutage in mindestens ähnlicher Größe wie die alten Meister des Louvre um die Aufmerksamkeit des Schauenden kämpfen. Urbanes Graffiti zu Beginn des 21. Jahrhunderts.
Oder besser gesagt: in erster Instanz kryptisch anmutende Zeichen, die sich neben- und übereinander lagernd die Wände entlang schlängeln, so dass aus dem vorbei rauschenden Zug eine Art zweiter Haut, ein Überzug aus Farben, an den Mauern suggeriert wird.
[...]
Daher gilt es in dieser Arbeit zunächst, das Zeichensystem der urbanen Graffiti-Kultur in seinen einzelnen Ausprägungen vorzustellen und anhand exemplarischer Abbildungen ein Fazit zu treffen, inwiefern durch die ästhetische Komponente von Graffiti-Zeichen diese als verbindliche visuelle Ausdrucksform aufgefasst werden. Und zwar aufgefasst als ein neues Zeichensystem, das sich in den vergangenen fünfundzwanzig Jahren in Deutschland etabliert hat und möglicherweise als ein weltweit verständlicher Code anzusehen ist.
Zu diesem Zweck werde ich mich nach einem historischen Abriss über die Entwicklung der Graffiti-Kultur auf die Hauptstadt Berlin konzentrieren, da hier nicht nur das politische Zentrum zu finden ist, sondern Berlin daneben als eine der Graffiti-Metropolen Europas angesehen wird.
Einleitend wird ein Überblick über den Forschungsstand gegeben, denn die Graffiti-Szene zeichnet sich – dabei beziehe ich mich nur auf Deutschland – nicht durch eine differenzierte Darstellung im zeitgenössischen Diskurs aus, und nicht zuletzt dies zu ändern ist mein Anliegen mit der vorliegenden Arbeit.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Wie alles begann
- 1.1. Vorwort zur überarbeiteten Fassung
- 1.2. Einleitung
- 2. Was bedeutet Graffiti-Writing?
- 2.1. Zur Etymologie und heutigen Verwendung des Begriffs
- 2.1.1. Zum Forschungsstand
- 2.2. Abgrenzung von Writing und Straßenkunst
- 2.3. Die historische Entwicklung der Writing-Kultur
- 2.3.1. Writing in New York
- 2.3.2. Writing in Europa
- 2.3.3. Writing in Deutschland
- 2.3.4. Writing in Berlin
- 2.4. Exkurs „Style Wars“
- 2.1. Zur Etymologie und heutigen Verwendung des Begriffs
- 3. Die Ästhetik der Writing-Kultur
- 3.1. Das Tag
- 3.2. Das Throw-Up
- 3.3. Das Piece
- 3.4. Sonderformen
- 4. Zwei Essays zur Graffiti-Theorie
- 4.1. Der Essay „the faith of graffiti“
- 4.2. Der Essay „KOOL KILLER oder Der Aufstand der Zeichen“
- 4.3. Die Broken-Window-Theorie
- 4.4. Der urbane Code im Bild der Öffentlichkeit
- 4.4.1. Rezeption von Writing
- 4.4.2. Wem gehören die Zeichen?
- 4.4.3. Wem gehört die Stadt?
- 4.5. Motivation zum Zeichen
- 4.5.1. Anonymität und Identität
- 5. Von der Subkultur zum Mainstream
- 5.1. Legalität
- 5.1.1. Illegalität
- 5.2. Writing als ephemeres Zeichen
- 5.3. Der Begriff der Subkultur
- 5.4. Writing und die Kulturindustrie
- 5.4.1. Tags sells
- 5.4.2. Im Namen der Dose
- 5.5. Exkurs: Writerinnen
- 5.1. Legalität
- 6. Ist Graffiti-Writing Gegenwartskunst?
- 6.1. Das Selbstverständnis der Writing-Kultur
- 6.2. Das Projekt Jazzstylecorner
- 6.2.1. AKIM alone again
- 6.3. Graffiti-Writing als Kunstform
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte, Ästhetik und den sozialen Kontext von Graffiti-Writing in Deutschland. Sie beleuchtet die Entwicklung der Writing-Kultur von ihren Anfängen in New York bis hin zu ihrer Verbreitung und Rezeption in Deutschland. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Frage nach der künstlerischen Anerkennung von Graffiti-Writing und seiner Positionierung zwischen Subkultur und Mainstream.
- Die historische Entwicklung des Graffiti-Writing
- Die ästhetischen Merkmale verschiedener Graffiti-Stile
- Die soziale und kulturelle Bedeutung von Graffiti-Writing
- Die Debatte um Legalität und Illegalität
- Die Frage nach der Anerkennung von Graffiti-Writing als Kunstform
Zusammenfassung der Kapitel
1. Wie alles begann: Dieses einleitende Kapitel bietet einen Überblick über die Entstehung und die überarbeitete Fassung des Buches. Es wird der kritische Blick auf die Jugendkultur thematisiert und die Entwicklung der Writing-Kultur innerhalb der Gesellschaft beschrieben. Der Autor betont die scheinbar paradoxe Entwicklung, dass Graffiti-Writing, trotz seines anfänglichen Widerstands gegen gesellschaftliche Normen, letztlich die Regeln des Systems bestätigt, in dem es existiert. Der Reiz des Graffiti-Writing und dessen Bewertung im Spannungsfeld von Vandalismus und Gegenwartskunst werden ebenfalls angesprochen. Der Autor erklärt seine wohlwollende Haltung gegenüber der Thematik und sein Bestreben, einen Beitrag zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dieser Kunstform zu leisten. Das Kapitel schließt mit einem Hinweis auf die Verwendung nicht-lizenzierten Bildmaterials und der Bereitstellung der Forschungsergebnisse als Open Content.
2. Was bedeutet Graffiti-Writing?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung von Graffiti-Writing. Es wird die Etymologie des Begriffs untersucht und der aktuelle Forschungsstand beleuchtet. Der Autor unterscheidet zwischen Writing und Straßenkunst und beschreibt die historische Entwicklung der Writing-Kultur in New York, Europa, Deutschland und insbesondere Berlin. Der Einfluss des Films "Style Wars" wird ebenfalls diskutiert. Dieses Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis des Phänomens und seiner verschiedenen Facetten.
3. Die Ästhetik der Writing-Kultur: Dieser Abschnitt widmet sich der visuellen Gestaltung von Graffiti. Er analysiert die verschiedenen Stile, von einfachen Tags über Throw-Ups bis hin zu komplexen Pieces. Es werden die jeweiligen ästhetischen Merkmale und die technischen Aspekte der Ausführung detailliert erläutert. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Ausdrucksformen und ihrer Bedeutung innerhalb der Writing-Kultur. Die Sonderformen des Graffiti-Writings werden ebenfalls behandelt und in den Kontext der gesamten Ästhetik eingeordnet.
4. Zwei Essays zur Graffiti-Theorie: In diesem Kapitel werden zwei wichtige Essays zur Graffiti-Theorie vorgestellt und analysiert. Die Broken-Window-Theorie und die Betrachtung des urbanen Codes im Bild der Öffentlichkeit werden eingeordnet. Die Rezeption von Writing, die Frage nach dem Besitz der Zeichen und der Stadt werden ausführlich diskutiert. Die Motivation der Writer und die Aspekte von Anonymität und Identität spielen hier eine zentrale Rolle. Die Kapitel analysieren die theoretischen Grundlagen des Graffiti-Writings und stellen sie in einen gesellschaftlichen Kontext.
5. Von der Subkultur zum Mainstream: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Entwicklung des Graffiti-Writings von einer Subkultur hin zum Mainstream. Die Legalität und Illegalität von Graffiti werden diskutiert und die ephemeren Natur der Zeichen beleuchtet. Die Bedeutung des Begriffs "Subkultur" wird erläutert und der Einfluss der Kulturindustrie auf das Graffiti-Writing analysiert. Die Kommerzialisierung und die Rolle von Writerinnen werden in diesem Kapitel behandelt und in den Gesamtkontext der Entwicklung eingeordnet.
Schlüsselwörter
Graffiti-Writing, Street Art, Ästhetik, Subkultur, Mainstream, Kommerzialisierung, Legalität, Illegalität, Identität, Anonymität, Deutschland, New York, Kunstform, soziale Rezeption, urbane Kultur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Graffiti-Writing in Deutschland: Eine umfassende Analyse"
Was ist der Inhalt des Buches "Graffiti-Writing in Deutschland: Eine umfassende Analyse"?
Das Buch bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit Graffiti-Writing in Deutschland. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Die Analyse umfasst die Geschichte, Ästhetik und den sozialen Kontext von Graffiti-Writing, von seinen Anfängen in New York bis zu seiner heutigen Rezeption in Deutschland. Besonderes Augenmerk liegt auf der Frage nach der künstlerischen Anerkennung und der Positionierung zwischen Subkultur und Mainstream.
Welche Themen werden im Buch behandelt?
Das Buch behandelt diverse Themen, darunter die historische Entwicklung des Graffiti-Writings, die ästhetischen Merkmale verschiedener Stile (Tags, Throw-Ups, Pieces), die soziale und kulturelle Bedeutung, die Debatte um Legalität und Illegalität, sowie die Anerkennung als Kunstform. Es werden auch theoretische Ansätze wie die Broken-Window-Theorie und die Kommerzialisierung der Szene beleuchtet. Die Rolle von Anonymität und Identität der Writer wird ebenso diskutiert wie der Einfluss der Kulturindustrie und die Entwicklung von einer Subkultur zum Mainstream. Schließlich wird die Frage gestellt, ob Graffiti-Writing Gegenwartskunst ist.
Welche Kapitel umfasst das Buch?
Das Buch gliedert sich in sechs Kapitel: 1. Wie alles begann (Einleitung und Vorwort), 2. Was bedeutet Graffiti-Writing? (Definition, Abgrenzung, historische Entwicklung), 3. Die Ästhetik der Writing-Kultur (Tags, Throw-Ups, Pieces, Sonderformen), 4. Zwei Essays zur Graffiti-Theorie (Analyse relevanter Essays und Theorien), 5. Von der Subkultur zum Mainstream (Legalität, Kommerzialisierung, Subkulturbegriff), und 6. Ist Graffiti-Writing Gegenwartskunst? (Selbstverständnis, Projekte, Kunstformdiskussion).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Buches?
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Buches prägnant zusammenfassen, sind: Graffiti-Writing, Street Art, Ästhetik, Subkultur, Mainstream, Kommerzialisierung, Legalität, Illegalität, Identität, Anonymität, Deutschland, New York, Kunstform, soziale Rezeption, urbane Kultur.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, das Buch bietet für jedes Kapitel eine ausführliche Zusammenfassung. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über die zentralen Inhalte und Argumentationslinien jedes Kapitels.
Wer sollte dieses Buch lesen?
Das Buch richtet sich an alle, die sich für Graffiti-Writing, urbane Kultur, Kunstsoziologie und die Entwicklung von Subkulturen interessieren. Es eignet sich für Studenten, Wissenschaftler und alle, die sich tiefergehend mit dem Thema auseinandersetzen möchten.
Wo finde ich mehr Informationen zu diesem Buch?
Leider werden in diesem HTML-Snippet keine weiteren Informationen zum Buch, wie z.B. Autor, Verlag oder ISBN, bereitgestellt. Weitere Informationen müssten über andere Quellen recherchiert werden.
- Quote paper
- Johannes Temeschinko (Author), 2007, Graffiti Writing in Deutschland. Seine Ästhetik und sein sozialer Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132791