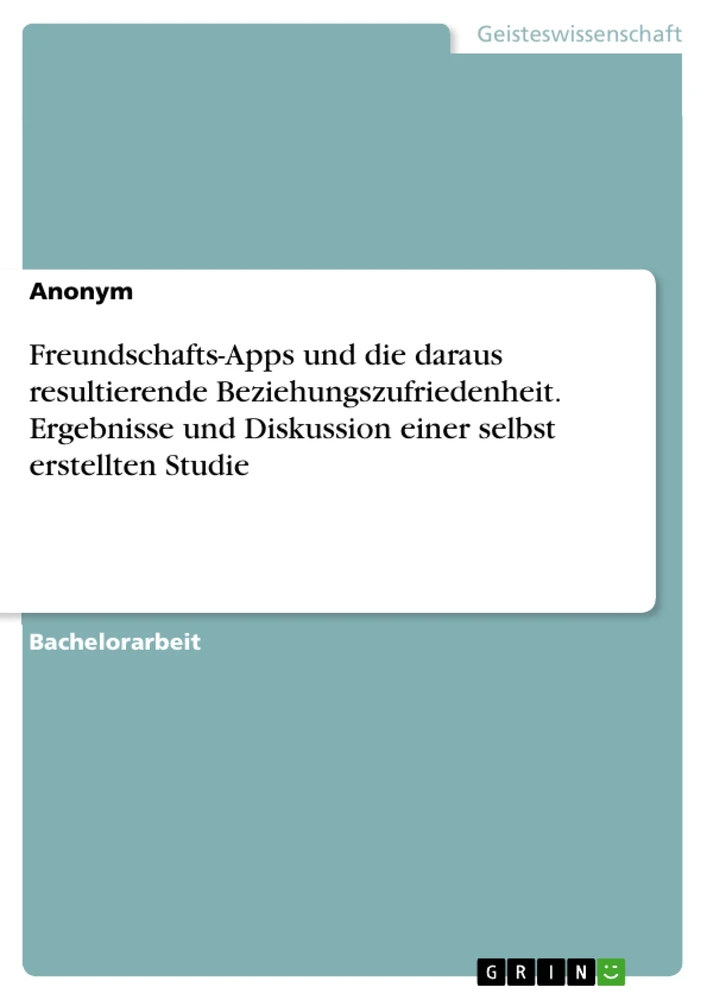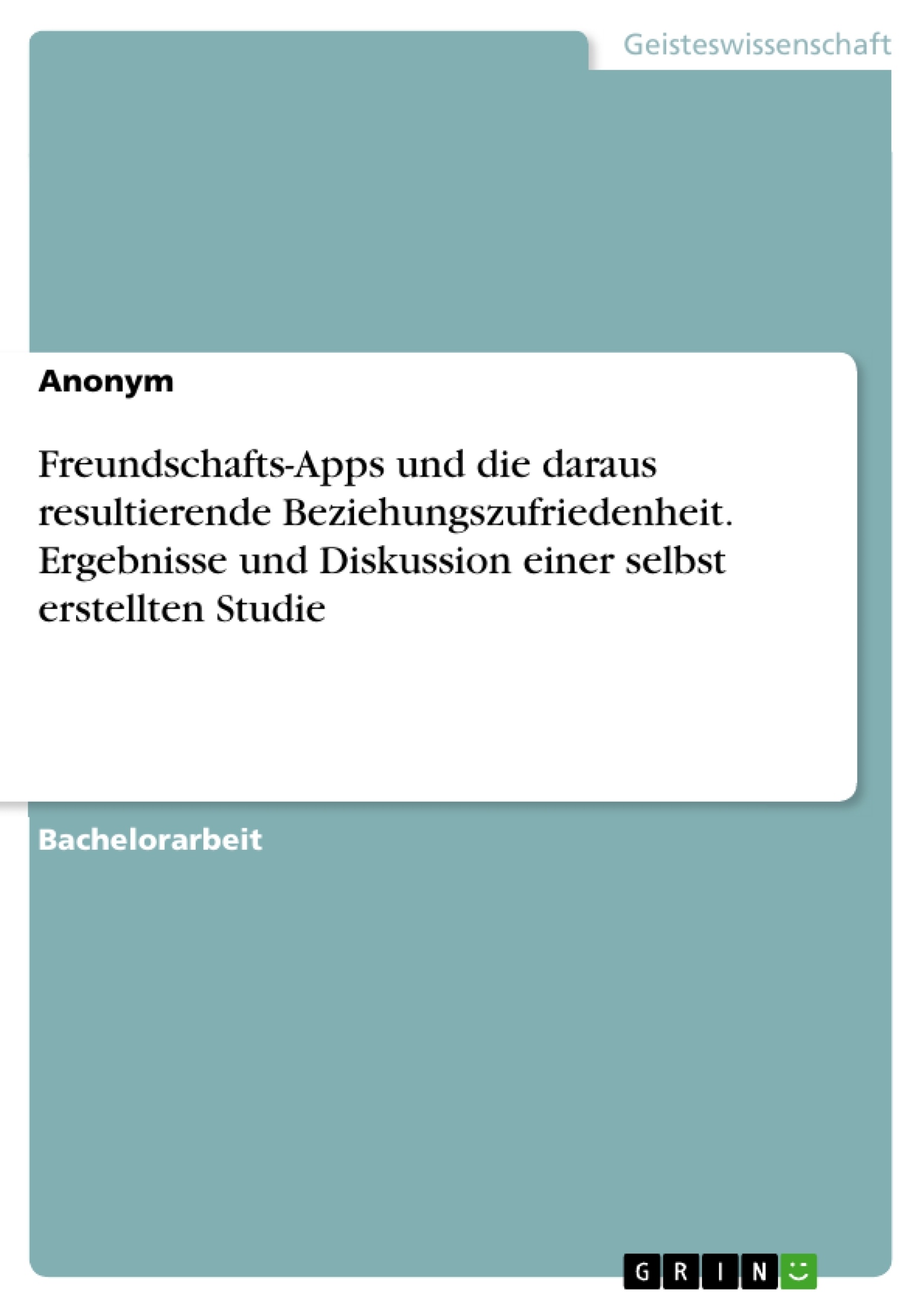Das Ziel dieser Arbeit, den Zusammenhang zwischen Freundschafts-Apps und der Beziehungszufriedenheit zu untersuchen. Zur Annäherung an die Thematik wird zunächst ein Blick auf den aktuellen Forschungsstand geworfen. Faktoren, die Beziehungszufriedenheit in („Offline“-)Freundschaften generieren, werden beleuchtet sowie erste empirische Ergebnisse zu Online-Freundschaften vorgestellt. Daraufhin werden Theorien herangezogen, die sich als Freundschafts- und Netzwerktheorien verstehen und dazu geeignet sind, den Nutzen von Freundschafts-Apps zu stützen. Aus den vorangegangenen Überlegungen werden die konkreten Hypothesen abgeleitet. Anschließend wird das methodische Vorgehen geschildert, die erhobenen Netzwerkdaten beschrieben und die statistische Auswertungsstrategie dargestellt. Im Ergebnisteil erfolgt schließlich die Darstellung der Befunde und die Überprüfung der Hypothesen. Die Arbeit schließt mit der Interpretation der Ergebnisse sowie einer Darstellung der Stärken und Schwächen der Studie ab. Die Diskussion soll zudem aufzeigen, inwiefern aus den gewonnenen Erkenntnissen Implikationen für die Forschung und Praxis abgeleitet werden können und schließt mit einer zusammenfassenden Schlussfolgerung ab.
Freundschaften zählen zu den wichtigsten zwischenmenschlichen Beziehungen. FreundInnen geben uns ein starkes Gefühl der Gemeinschaft, mildern Gefühle der Einsamkeit und tragen zu unserem Selbstwertgefühl und unserer Lebenszufriedenheit bei. Es ist aber nicht immer leicht, diese Bindungen zu pflegen. Oft unterliegen Freundschaften dem stetigen Lebenswandel. Wer für das Studium, den Job oder die Liebe in eine andere Stadt zieht, Kinder bekommt oder nicht, heiratet oder sich scheiden lässt, kann selten all seine Beziehungen aufrechterhalten. Dies wollen sogenannte Freundschafts-Apps (wie z. B. Bumble BFF, Meetup oder Patook) ändern, indem sie Menschen zusammenbringen. Sie funktionieren ähnlich wie Dating-Apps und wollen damit eine Plattform für das Online-Kennenlernen und den Aufbau einer Beziehung in der realen Welt bieten.
Mit dem Beginn sozialer Netzwerke hat auch der Trend begonnen, dass Menschen FreundInnen online finden und seit 2016 greifen immer Menschen auf Freundschafts-Apps zurück. Nach der Erstellung eines Profils mit Angaben zur eigenen Person können NutzerInnen personalisierte Sucheinstellungen (z. B. Alter, Geschlecht, Umkreis und Interessen) vornehmen. Anhand dieser zeigt die App durch einen Algorithmus passende Profile anderer NutzerInnen an und ermöglicht einen Austausch per Chat. Zudem können NutzerInnen in der App in verschiedenen spezifischen Kategorien (z. B. „Neu in der Stadt“, „Sport“, „Ausgehen“ usw.) nach Gleichgesinnten suchen. Freundschafts-Apps sollen damit die Möglichkeit bieten, außerhalb des normalen Alltags Menschen kennenzulernen und Beziehungen aufzubauen. Demnach besteht die Chance, über Freundschafts-Apps, FreundInnen zu finden. Interessant zu hinterfragen ist jedoch, inwieweit dieser spielerische Charakter von Freundschafts- Apps zum Aufbau einer Freundschaft führen kann und wie hoch die Zufriedenheit mit diesen Beziehungen ist. Diesen Fragen soll sich die vorliegende Arbeit widmen. Freundschafts-Apps sind ein noch sehr junges Phänomen, weshalb die Forschung zu diesem Thema noch in den Anfängen ist. Die NutzerInnenzahlen steigen jedoch stetig, sodass Freundschaft-Apps zunehmend an Relevanz gewinnen.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1. Einleitung
- 2. Stand der Forschung
- 3. Theoretischer Hintergrund
- 3.1 Homophilie
- 3.2 Theorien der Lebensspanne
- 4. Fragestellung und Hypothesen
- 5. Methoden
- 5.1 Stichprobe
- 5.2 Ablauf der Studie
- 5.3 Erhebungsinstrument
- 5.4 Datenanalyse
- 6. Ergebnisse
- 6.1 Deskriptive Statistik
- 6.2 Hypothesentestung
- 7. Diskussion
- 7.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
- 7.2 Einordnung in den aktuellen Forschungsstand
- 7.3 Limitationen
- 7.4 Implikationen für die Forschung
- 7.5 Praktische Implikationen
- 7.6 Zusammenfassende Schlussfolgerung
- 8. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Freundschafts-Apps und der Beziehungszufriedenheit in online geschlossenen Freundschaften. Es wird analysiert, wie die Variablen Positivität, Unterstützung, Selbstoffenbarung und Interaktion mit der Beziehungszufriedenheit korrelieren. Darüber hinaus wird geprüft, welcher Faktor den größten Einfluss auf die Beziehungszufriedenheit hat.
- Zusammenhang zwischen Freundschafts-Apps und Beziehungszufriedenheit
- Einfluss von Positivität, Unterstützung, Selbstoffenbarung und Interaktion auf die Beziehungszufriedenheit
- Identifizierung des Schlüsselfaktors für die Beziehungszufriedenheit
- Analyse korrelativer Zusammenhänge
- Bedeutung von Online-Freundschaften im Kontext der digitalen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Freundschafts-Apps und ihrer Bedeutung im Kontext der modernen Beziehungen ein. Kapitel 2 beleuchtet den aktuellen Forschungsstand zu Faktoren, die die Zufriedenheit in Offline-Freundschaften beeinflussen, sowie erste Ergebnisse zu Online-Freundschaften. Kapitel 3 stellt Theorien vor, die den Nutzen von Freundschafts-Apps im Hinblick auf den Aufbau von Beziehungen stützen. Kapitel 4 leitet aus den vorangegangenen Überlegungen die konkreten Hypothesen ab. Kapitel 5 beschreibt das methodische Vorgehen der Untersuchung, die Stichprobe, den Ablauf der Studie, die Erhebungsinstrumente und die statistische Auswertungsstrategie. Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung und die Überprüfung der Hypothesen. Die Diskussion in Kapitel 7 interpretiert die Ergebnisse, bewertet die Stärken und Schwächen der Studie, leitet Implikationen für Forschung und Praxis ab und fasst die Schlussfolgerungen zusammen.
Schlüsselwörter
Freundschafts-Apps, Beziehungszufriedenheit, Online-Freundschaften, Positivität, Unterstützung, Selbstoffenbarung, Interaktion, Korrelation, digitale Gesellschaft, soziale Netzwerke, empirische Forschung.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2022, Freundschafts-Apps und die daraus resultierende Beziehungszufriedenheit. Ergebnisse und Diskussion einer selbst erstellten Studie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1326419