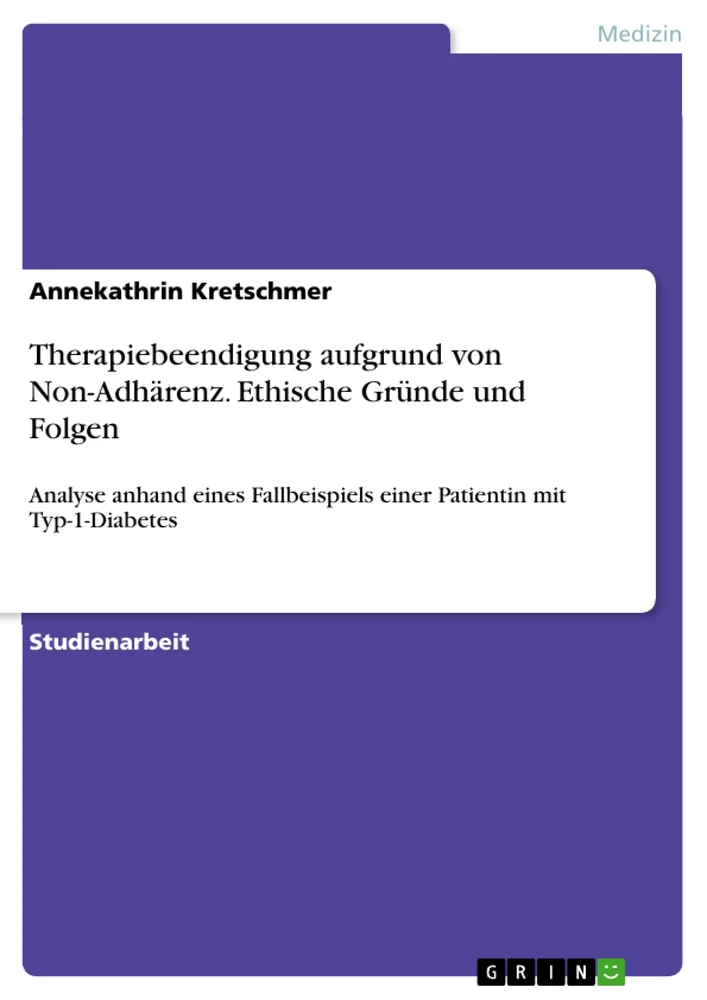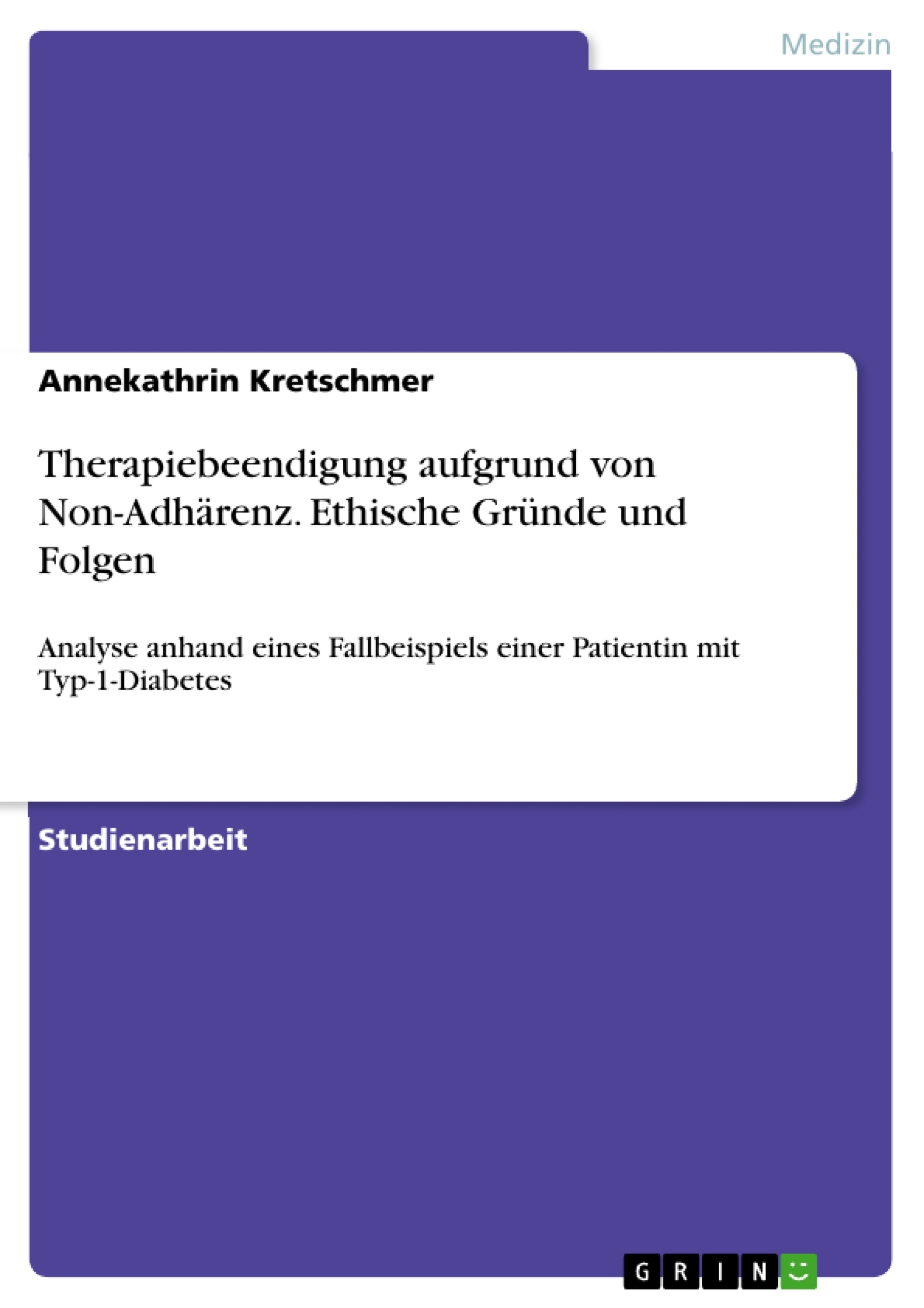Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche ethischen Aspekte für oder gegen die Therapiebeendigung auf Grund von Non-Adhärenz des Patienten sprechen und ob es aus ethischer Sicht vertretbar ist, die Therapie bei fehlender Adhärenz zu beenden. Hinführend zur Diskussion dieser Fragestellung erfolgen zunächst die Begriffsdefinitionen, zusätzlich soll die Thematik anhand eines Fallbeispiels erläutert werden.
Seit den 1960er-Jahren hat die Anzahl der an Diabetes mellitus Typ 2 erkrankten Patienten um das Zehnfache zugenommen. Zusätzlich zu den Risikofaktoren wie Nikotinabusus, falsche Ernährung, fehlende körperliche Bewegung und damit einhergehend Adipositas oder vaskuläre Erkrankungen, kommt es häufig zur Nichteinhaltung der ausgearbeiteten Therapieansätze seitens des Patienten.
In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass es Patienten gibt, die sich nicht an medizinische Vorgaben ihres behandelnden Arztes halten. Medikamente werden nur unregelmäßig eingenommen oder gänzlich weggelassen. Weitere therapeutische Überlegungen seitens des Arztes werden nicht angenommen oder durchgeführt, obwohl dies lebensverlängernd und krankheitsmildernd sein kann. Das Behandlungsverhältnis wird im Alltag in aller Regel trotz fehlender Therapieadhärenz fortgeführt und nur in seltenen Fällen seitens der Behandler beenden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Abkürzungsverzeichnis
- 2 Einleitung
- 3 Theoretischer Hintergrund
- 3.1 Adhärenz vs. Non-Adhärenz
- 3.2 Folgen von Non-Adhärenz
- 4 Fallbeispiel
- 4.1 Krankengeschichte
- 4.2 Gescheiterte Therapieansätze
- 4.3 Mögliche Ursachen für Non-Adhärenz
- 4.4 Prognose bei Non-Adhärenz
- 5 Beendigung des Behandlungsverhältnisses - ethische Aspekte
- 5.1 Pro Argumente
- 5.2 Contra Argumente
- 5.3 Abwägung der Argumente
- 6 Fazit
- 7 Anlagen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die ethischen Aspekte einer Therapiebeendigung aufgrund von Non-Adhärenz bei Patienten mit Typ-2-Diabetes. Ziel ist es, die Argumente für und gegen eine solche Beendigung abzuwägen und eine ethisch vertretbare Position zu finden.
- Definition und Differenzierung von Adhärenz und Non-Adhärenz
- Folgen von Non-Adhärenz für den Patienten und das Behandlungsverhältnis
- Ethische Prinzipien im Kontext der Therapieentscheidung
- Analyse eines Fallbeispiels zur Veranschaulichung der Problematik
- Abwägung der ethischen Argumente für und gegen eine Therapiebeendigung
Zusammenfassung der Kapitel
2 Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den Anstieg von Typ-2-Diabetes-Erkrankungen und die damit verbundene Problematik der Non-Adhärenz. Sie führt in die Forschungsfrage ein: Welche ethischen Aspekte sprechen für oder gegen eine Therapiebeendigung aufgrund von Non-Adhärenz? Die Arbeit kündigt die Begriffsdefinitionen und die Erläuterung anhand eines Fallbeispiels an.
3 Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel definiert Adhärenz und Non-Adhärenz und differenziert zwischen primärer und sekundärer Non-Adhärenz sowie drei Grundformen der Non-Adhärenz. Es betont die gemeinsame Verantwortung von Patient und Arzt für den Therapieerfolg und erläutert die Bedeutung der Adhärenzrate von über 20% für den Erfolg der Behandlung. Der Abschnitt hebt die Komplexität der Situation hervor, da Non-Adhärenz aus verschiedenen Gründen resultieren kann, von bewussten Entscheidungen bis hin zu unbewussten Fehlern. Die Ausführungen legen die Grundlage für die ethische Betrachtung im weiteren Verlauf der Arbeit.
4 Fallbeispiel: Dieses Kapitel präsentiert ein detailliertes Fallbeispiel eines Patienten mit Typ-2-Diabetes und Non-Adhärenz, illustrierend die Herausforderungen in der Praxis. Die Krankengeschichte, gescheiterte Therapieansätze, mögliche Ursachen der Non-Adhärenz und die Prognose werden dargestellt. Das Beispiel soll die ethische Problematik greifbarer machen und als Grundlage für die spätere Argumentation dienen. Die einzelnen Punkte des Fallbeispiels unterstreichen die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise, da hinter der Non-Adhärenz komplexe Ursachen stecken können.
5 Beendigung des Behandlungsverhältnisses - ethische Aspekte: Dieses Kapitel widmet sich der Kernfrage der Arbeit. Es präsentiert systematisch Pro- und Contra-Argumente für eine Therapiebeendigung aufgrund von Non-Adhärenz. Die Argumentation stützt sich wahrscheinlich auf ethische Prinzipien wie Autonomie, Fürsorge und Gerechtigkeit. Eine Abwägung der Argumente soll zu einer fundierten ethischen Positionierung führen. Die Kapitelteile stellen eine umfassende Auseinandersetzung mit den verschiedenen ethischen Perspektiven dar und bereiten den Weg für ein abschließendes Fazit.
Schlüsselwörter
Non-Adhärenz, Adhärenz, Diabetes mellitus Typ 2, Therapiebeendigung, Ethik, medizinische Verantwortung, Patientenautonomie, Fallbeispiel, ethische Prinzipien, Behandlungsverhältnis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Ethische Aspekte einer Therapiebeendigung bei Non-Adhärenz von Typ-2-Diabetes-Patienten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die ethischen Aspekte der Beendigung einer Therapie aufgrund von Non-Adhärenz (Nicht-Einhaltung der Therapie) bei Patienten mit Typ-2-Diabetes. Das Hauptziel ist die Abwägung von Argumenten für und gegen eine solche Beendigung und die Entwicklung einer ethisch vertretbaren Position.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Unterscheidung von Adhärenz und Non-Adhärenz, die Folgen von Non-Adhärenz für den Patienten und das Arzt-Patienten-Verhältnis, ethische Prinzipien im Kontext der Therapieentscheidung, die Analyse eines Fallbeispiels zur Veranschaulichung der Problematik und die Abwägung der ethischen Argumente für und gegen eine Therapiebeendigung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theoretischer Hintergrund (Adhärenz vs. Non-Adhärenz, Folgen von Non-Adhärenz), Fallbeispiel (Krankengeschichte, gescheiterte Therapieansätze, mögliche Ursachen für Non-Adhärenz, Prognose), Beendigung des Behandlungsverhältnisses – ethische Aspekte (Pro- und Contra-Argumente, Abwägung), Fazit und Anlagen. Ein Abkürzungsverzeichnis ist ebenfalls enthalten.
Was wird im Kapitel „Theoretischer Hintergrund“ erläutert?
Dieses Kapitel definiert Adhärenz und Non-Adhärenz, differenziert zwischen verschiedenen Formen der Non-Adhärenz und betont die gemeinsame Verantwortung von Patient und Arzt für den Therapieerfolg. Es erklärt die Bedeutung der Adhärenzrate und hebt die Komplexität der Ursachen für Non-Adhärenz hervor.
Welche Rolle spielt das Fallbeispiel?
Das Fallbeispiel eines Typ-2-Diabetes-Patienten mit Non-Adhärenz veranschaulicht die Herausforderungen in der Praxis. Es beschreibt die Krankengeschichte, gescheiterte Therapieansätze, mögliche Ursachen und die Prognose. Das Beispiel dient als Grundlage für die ethische Argumentation.
Wie werden die ethischen Aspekte behandelt?
Das Kapitel „Beendigung des Behandlungsverhältnisses – ethische Aspekte“ präsentiert systematisch Argumente für und gegen eine Therapiebeendigung aufgrund von Non-Adhärenz. Die Argumentation stützt sich auf ethische Prinzipien wie Autonomie, Fürsorge und Gerechtigkeit, um zu einer fundierten ethischen Position zu gelangen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Non-Adhärenz, Adhärenz, Diabetes mellitus Typ 2, Therapiebeendigung, Ethik, medizinische Verantwortung, Patientenautonomie, Fallbeispiel, ethische Prinzipien, Behandlungsverhältnis.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche ethischen Aspekte sprechen für oder gegen eine Therapiebeendigung aufgrund von Non-Adhärenz?
- Quote paper
- Annekathrin Kretschmer (Author), 2022, Therapiebeendigung aufgrund von Non-Adhärenz. Ethische Gründe und Folgen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1326385