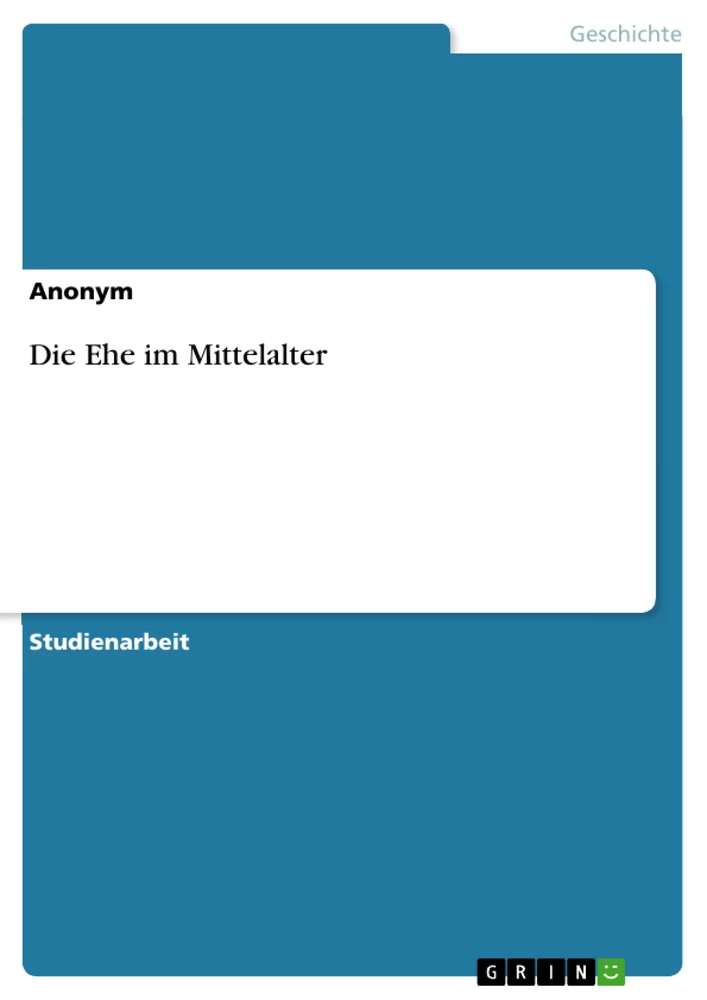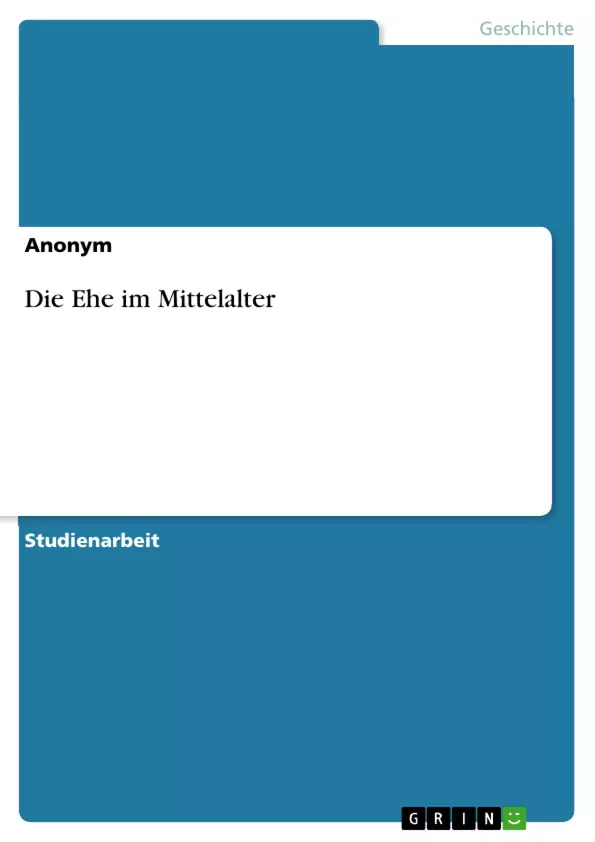Die Ehe markiert die Übereinkunft von Menschen miteinander in dauerhafter Gemeinschaft zu leben. Bereits im Laufe der Geschichte bildet sie seit jeher das Kernstück der familiären Ordnung. In der römisch-katholischen Kirche wird sie seit dem Mittelalter darüber hinaus zu den Sakramenten gezählt, doch nicht jede Eheverbindung konnte nach kirchlichem Recht auch zustande kommen. Die Einführung des Rechts des Konsenses sowie bestehende, nach dem kanonischen Recht aufgestellte Ehehindernisse, konnten eine gültige Eheschließung verhindern.
In dieser Arbeit wird der Frage nach bestehenden Ehehindernissen im Mittelalter nachgegangen sowie der Möglichkeit einer Umgehung bzw. Beseitigung. Dazu soll die Möglichkeit der Dispens untersucht werden. Aufgrund der Komplexität dieses Themas ist eine vollständige Erfassung und Untersuchung nicht möglich, da es den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde. Daher wird die Untersuchung der Dispens vor allem an dem Beispiel einer Dispenserteilung von Papst Nikolaus IV. für eine Ehe zwischen den adligen Geschlechtern von Hohenlohe und Truhendingen erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Ehe im Mittelalter
- 2.1 Das Recht des Konsenses und Eheverträge
- 2.2 Ehehindernisse
- 3. Zum Geschlecht von Hohenlohe und Truhendingen
- 4. Zu Dispensen
- 4.1 Allgemein
- 4.2 Papst und Bischöfe als Bevollmächtigte
- 4.3 Ursache – Wirkung Zusammenhang der päpstlichen Dispens am Beispiel der Ehe Krafts von Hohenlohe und Margarethe von Truhendingen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Ehehindernisse im Mittelalter und die Möglichkeit ihrer Umgehung oder Beseitigung durch päpstliche Dispensen. Der Fokus liegt auf der Analyse des kanonischen Rechts und der Praxis der Dispenserteilung, anhand eines konkreten Beispiels aus den adligen Familien Hohenlohe und Truhendingen.
- Das kanonische Eherecht im Mittelalter
- Ehehindernisse im Mittelalter (göttlichen und menschlichen Rechts)
- Das Recht des Konsenses und Eheverträge
- Päpstliche Dispensen als Mittel zur Umgehung von Ehehindernissen
- Fallbeispiel: Die Ehe Krafts von Hohenlohe und Margarethe von Truhendingen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Ehe im Mittelalter ein, wobei die Bedeutung des Ehekonsenses und die Rolle des kanonischen Rechts hervorgehoben werden. Es wird auf die Problematik von Ehehindernissen und die Möglichkeit ihrer Beseitigung durch Dispensen eingegangen. Die Arbeit konzentriert sich auf ein spezifisches Beispiel einer Dispenserteilung durch Papst Nikolaus IV. für eine Ehe zwischen den adligen Geschlechtern von Hohenlohe und Truhendingen, um die Komplexität des Themas in einem überschaubaren Rahmen zu behandeln und relevante Forschungsliteratur wird vorgestellt.
2. Die Ehe im Mittelalter: Dieses Kapitel beschreibt die Ehe im Mittelalter als eine von der Rechtsordnung anerkannte Lebensgemeinschaft, deren Bedeutung sich im Laufe der Zeit verändert hat. Es erläutert die Bedeutung des Ehewillens und des Konsenses der Partner für eine gültige Eheschließung, wobei die Praxis in adligen Kreisen mit ihren Eheverträgen und der oft mangelnden Durchsetzung des Konsenses im Fokus steht. Die Rolle von Eheverträgen zur Festigung politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Absprachen wird detailliert untersucht. Der Einfluss des Konsenses auf die Vereinbarungen der Eltern für ihre Kinder wird kritisch beleuchtet.
3. Zum Geschlecht von Hohenlohe und Truhendingen: Dieses Kapitel stellt die adligen Geschlechter von Hohenlohe und Truhendingen vor, deren Ehe im Kontext der Dispenserteilung durch Papst Nikolaus IV. im Mittelpunkt der Analyse steht. Es werden die historischen Wurzeln und der soziale Status der Familien kurz dargestellt und bildet somit den Kontext für das Verständnis des Fallbeispiels.
4. Zu Dispensen: Dieses Kapitel behandelt das Thema der Dispensen im kanonischen Recht. Es wird die Unterscheidung zwischen Ehehindernissen göttlichen und menschlichen Rechts erläutert und die Rolle des Papstes und der Bischöfe als Bevollmächtigte bei der Dispenserteilung hervorgehoben. Im Fokus steht die Wirkung und Bedeutung päpstlicher Dispensen zur Umgehung von Ehehindernissen, detailliert anhand des Beispiels der Ehe zwischen Kraft von Hohenlohe und Margarethe von Truhendingen.
Schlüsselwörter
Kanonisches Eherecht, Mittelalter, Ehehindernisse, Dispens, Papst Nikolaus IV., Geschlecht von Hohenlohe, Geschlecht von Truhendingen, Ehekonsens, Eheverträge, Adelsgeschlecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die Ehe Krafts von Hohenlohe und Margarethe von Truhendingen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Ehehindernisse im Mittelalter und wie diese durch päpstliche Dispensen umgangen oder beseitigt werden konnten. Der Fokus liegt auf der Analyse des kanonischen Rechts und der Praxis der Dispenserteilung, anhand des konkreten Beispiels der Ehe zwischen Kraft von Hohenlohe und Margarethe von Truhendingen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das kanonische Eherecht des Mittelalters, Ehehindernisse (göttlichen und menschlichen Rechts), das Recht des Konsenses und Eheverträge, päpstliche Dispensen als Mittel zur Umgehung von Ehehindernissen und detailliert das Fallbeispiel der Ehe zwischen Kraft von Hohenlohe und Margarethe von Truhendingen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Die Ehe im Mittelalter, Zum Geschlecht von Hohenlohe und Truhendingen, Zu Dispensen und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas, wobei Kapitel 4 sich intensiv mit dem Fallbeispiel befasst.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik der Ehe im Mittelalter ein, hebt die Bedeutung des Ehekonsenses und die Rolle des kanonischen Rechts hervor. Sie thematisiert die Problematik von Ehehindernissen und die Möglichkeit ihrer Beseitigung durch Dispensen, konzentriert sich auf das Beispiel der Dispenserteilung durch Papst Nikolaus IV. und stellt relevante Forschungsliteratur vor.
Was wird im Kapitel "Die Ehe im Mittelalter" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die Ehe im Mittelalter als Rechtsordnung, erläutert die Bedeutung des Ehewillens und des Konsenses der Partner, den Einfluss von Eheverträgen in adligen Kreisen und die oft mangelnde Durchsetzung des Konsenses. Die Rolle von Eheverträgen zur Festigung politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Absprachen und den Einfluss des Konsenses auf die Vereinbarungen der Eltern für ihre Kinder wird kritisch beleuchtet.
Was wird im Kapitel "Zum Geschlecht von Hohenlohe und Truhendingen" behandelt?
Dieses Kapitel stellt die adligen Geschlechter von Hohenlohe und Truhendingen vor, deren Ehe im Mittelpunkt der Analyse steht. Es werden die historischen Wurzeln und der soziale Status der Familien kurz dargestellt, um den Kontext für das Fallbeispiel zu liefern.
Was wird im Kapitel "Zu Dispensen" behandelt?
Dieses Kapitel behandelt Dispensen im kanonischen Recht. Es erläutert die Unterscheidung zwischen Ehehindernissen göttlichen und menschlichen Rechts und die Rolle des Papstes und der Bischöfe bei der Dispenserteilung. Der Fokus liegt auf der Wirkung und Bedeutung päpstlicher Dispensen, detailliert anhand des Beispiels der Ehe zwischen Kraft von Hohenlohe und Margarethe von Truhendingen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Kanonisches Eherecht, Mittelalter, Ehehindernisse, Dispens, Papst Nikolaus IV., Geschlecht von Hohenlohe, Geschlecht von Truhendingen, Ehekonsens, Eheverträge, Adelsgeschlecht.
Welches konkrete Beispiel wird analysiert?
Die Arbeit analysiert im Detail die Ehe zwischen Kraft von Hohenlohe und Margarethe von Truhendingen und die Dispenserteilung durch Papst Nikolaus IV. als Fallbeispiel.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich für das kanonische Recht des Mittelalters, Ehehindernisse und die Rolle päpstlicher Dispensen interessieren.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2016, Die Ehe im Mittelalter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1325912