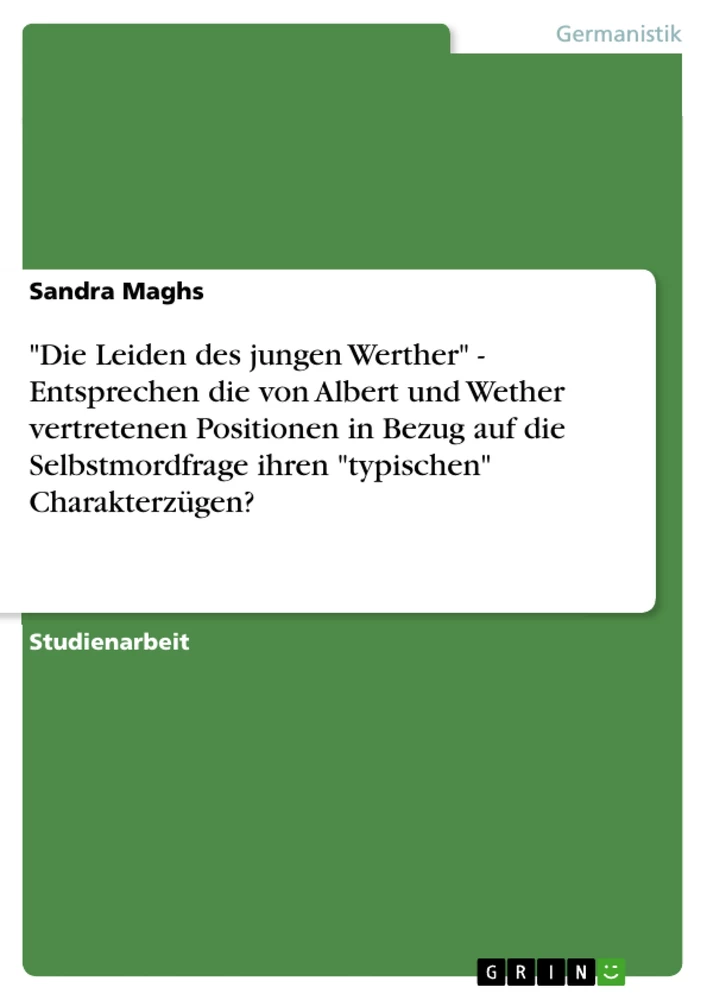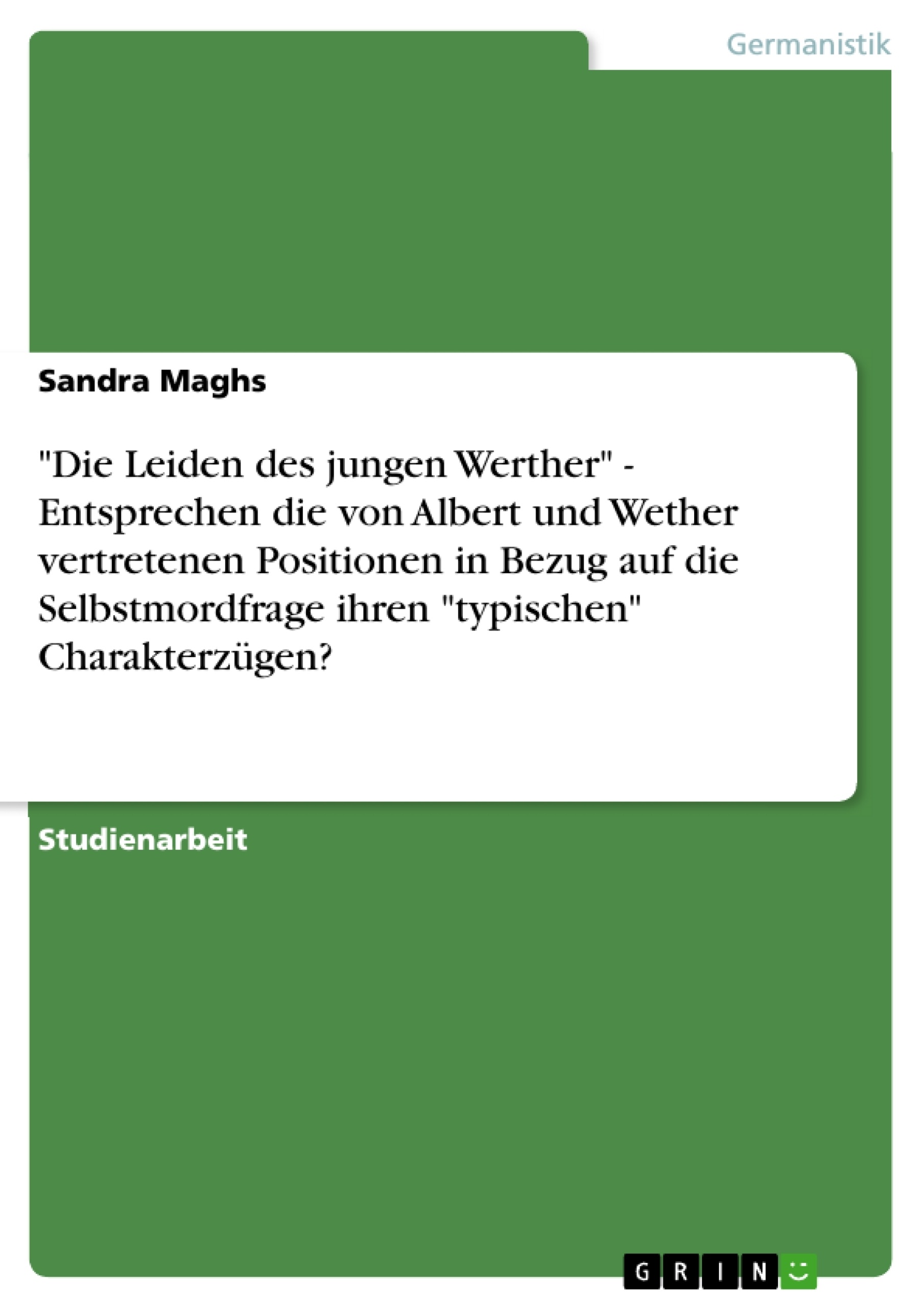In dieser Hausarbeit werde ich zunächst eine Klärung des Begriffs „Suizid“ vornehmen sowie die Darstellung der theologischen und rechtlichen Hintergründe des 18. Jahrhunderts in Bezug auf die Selbsttötung darstellen. Im weiteren Verlauf werde ich dann die Ausgangsposition der beiden Figuren erklären und auf dieser Grundlage die Diskussion (Brief vom 12. August) zwischen Albert und Werther analysieren. Zum Ende der Arbeit sollen einige Beispiele des gesamten Buches, die für die Figuren exemplarischen Charakterzüge hervorheben. Das Ziel dieser Arbeit ist zum Einen, die Darstellung der Positionen, die Albert und Werther hinsichtlich der Selbstmordfrage beziehen. Zum Anderen soll die Untersuchung dazu dienen, herauszustellen inwiefern die vertretenen Positionen „typisch“ für die jeweilige Figur sind, bzw. als Teil einer Charakterisierung gelten können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Definition der Selbsttötung
- Die theologische Sichtweise der Selbsttötung
- Kirchengeschichtlich
- Kirchliche Praxis und Stellungnahmen
- Die rechtliche Sichtweise der Selbsttötung
- Die theologische Sichtweise der Selbsttötung
- Einordnung der Szene in den Kontext
- Die Typisierung der beiden Figuren
- ,,Typisch" Albert
- ,,Typisch" Werther
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Interpretation des Briefes vom 12. August aus Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ und analysiert die Positionen von Albert und Werther in Bezug auf die Selbstmordfrage. Ziel ist es, die Argumente beider Figuren darzustellen und zu untersuchen, ob diese „typisch“ für ihre jeweiligen Charakterzüge sind.
- Definition und historische Einordnung des Selbstmords
- Theologische und rechtliche Sichtweisen auf Selbsttötung im 18. Jahrhundert
- Analyse der Positionen von Albert und Werther im Brief vom 12. August
- Charakterisierung der Figuren Albert und Werther anhand ihrer Positionen zur Selbstmordfrage
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert die Zielsetzung sowie den Aufbau der Arbeit. Im zweiten Kapitel wird der Begriff „Selbstmord“ definiert und die theologischen und rechtlichen Hintergründe des 18. Jahrhunderts in Bezug auf die Selbsttötung dargestellt. Das dritte Kapitel ordnet die Szene des Briefes vom 12. August in den Kontext des Romans ein und beschreibt die Beziehung zwischen Werther, Charlotte und Albert. Das vierte Kapitel analysiert die „typischen“ Charakterzüge von Albert und Werther, indem es ihre Positionen zur Selbstmordfrage im Brief vom 12. August beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Selbstmordfrage, die theologische und rechtliche Sichtweise auf Selbsttötung im 18. Jahrhundert, die Charakterisierung von Albert und Werther, sowie die Analyse des Briefes vom 12. August aus Goethes „Die Leiden des jungen Werther“. Die Arbeit beleuchtet die Positionen der Figuren in Bezug auf die Selbstmordfrage und untersucht, inwiefern diese „typisch“ für ihre jeweiligen Charakterzüge sind.
- Quote paper
- Sandra Maghs (Author), 2005, "Die Leiden des jungen Werther" - Entsprechen die von Albert und Wether vertretenen Positionen in Bezug auf die Selbstmordfrage ihren "typischen" Charakterzügen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132586