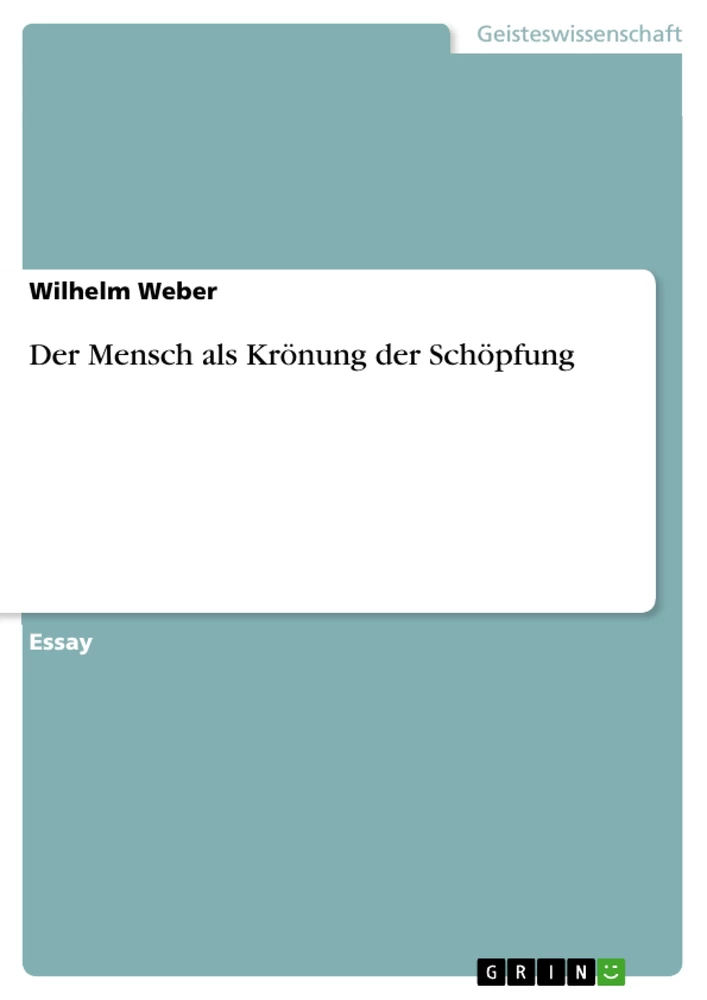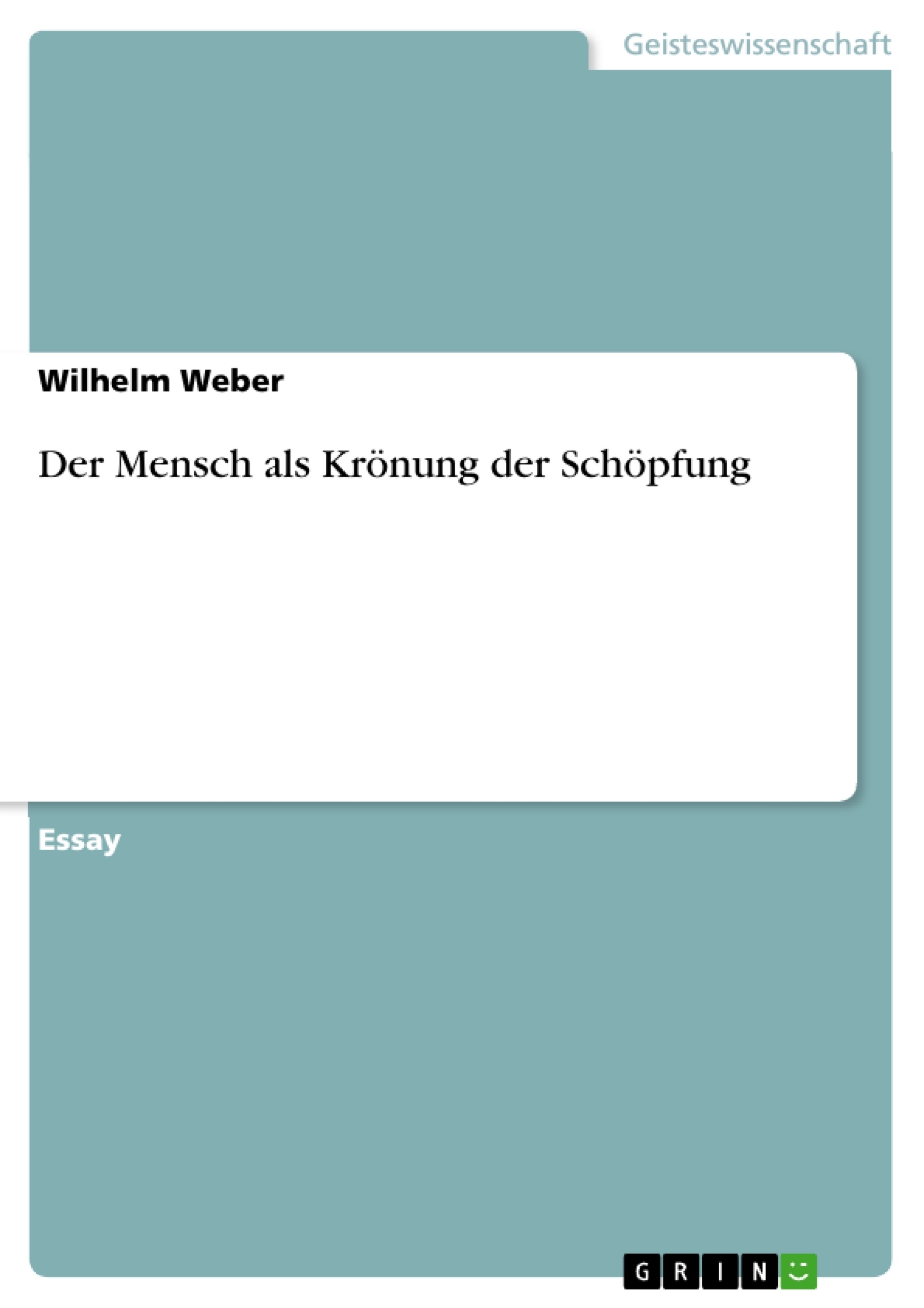In erster Linie assoziiere ich damit die Schöpfungsgeschichte, in welcher der Mensch als Höhepunkt
der Schöpfung dargestellt wird (vgl. Gen 1, 26ff.). In diesen Bibelstellen wird der Mensch dadurch
charakterisiert, dass er zum Ebenbild Gottes geschaffen wurde, dass der Mensch im Auftrag Gottes
die Erde verwalten soll und “der Mensch sich auf der Erde vermehren soll.“ Weiterhin lässt sich die
Redensart vom Menschen als Krönung der Schöpfung bis zu Aristoteles zurückverfolgen. In seinem
Werk “Scala naturae“ wird der Versuch unternommen, die belebte und unbelebte Natur systematisch
zu ordnen. Demnach sind die am kompliziertesten erscheinenden Lebewesen die höher entwickelten.
Daraus wird in diesem Werk der Schluss gezogen, dass der Mensch als das höchst entwickelte
Wesen in der Schöpfung gesehen wird. Ein nicht unwesentlicher Aspekt bildet hierbei die
Evolutionstheorie. Die Evolutionstheorie besagt, dass alle Arten von Lebewesen gleich sind.
Inhaltsverzeichnis
- Der Mensch als Krönung der Schöpfung
- Die Schöpfungsgeschichte
- Aristoteles' "Scala naturae"
- Die Evolutionstheorie
- Der Mensch als Raubtier
- Der Mensch als soziales Wesen
- Der Mensch als Schwellenwesen
- Der Mensch als Vernunftwesen und Gefühlswesen
- Der Mensch als Produkt seiner Umwelt
- Der Mensch als Beziehungswesen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Frage, ob der Mensch als Krönung der Schöpfung betrachtet werden kann. Der Autor analysiert verschiedene Aspekte des menschlichen Wesens, um diese Frage zu beantworten. Dabei werden sowohl die Stärken als auch die Schwächen des Menschen beleuchtet.
- Die Schöpfungsgeschichte und die Rolle des Menschen in der Natur
- Die Evolutionstheorie und die Entwicklung des Menschen
- Die menschliche Natur und ihre Triebe
- Der Einfluss der Umwelt auf das menschliche Verhalten
- Die Bedeutung von Beziehungen für den Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit der Analyse der Schöpfungsgeschichte, in der der Mensch als Höhepunkt der Schöpfung dargestellt wird. Der Autor verweist auf Aristoteles' "Scala naturae", die die belebte und unbelebte Natur systematisch ordnet und den Menschen als das höchst entwickelte Wesen betrachtet. Anschließend wird die Evolutionstheorie betrachtet, die besagt, dass alle Arten von Lebewesen gleich sind. Der Autor stellt die Behauptung auf, dass der Mensch die Fähigkeit und die Anlagen besitzt, sich zur Krönung der Schöpfung zu entwickeln.
Im weiteren Verlauf des Textes wird der Mensch als Raubtier betrachtet, wobei der Autor auf die menschliche Neigung zum Egoismus und zur Gewalt hinweist. Er argumentiert, dass der Mensch durch seine Triebe und seine Umwelt beeinflusst wird und dass diese Einflüsse zu negativem Verhalten führen können. Der Autor stellt fest, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist und dass seine Beziehungen einen großen Einfluss auf seine Entwicklung haben.
Abschließend kommt der Autor zu dem Schluss, dass der Mensch nicht als Krönung der Schöpfung betrachtet werden kann. Er argumentiert, dass der Mensch zwar die Fähigkeit zum Guten besitzt, aber auch durch seine Schwächen und seine Fehlbarkeit gekennzeichnet ist. Der Autor betont die Bedeutung von Liebe, Wärme und Hoffnung für die menschliche Entwicklung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Schöpfungsgeschichte, die Evolutionstheorie, die menschliche Natur, die Triebe des Menschen, die Umwelt, Beziehungen, Egoismus, Gewalt, Liebe, Hoffnung und die Frage, ob der Mensch als Krönung der Schöpfung betrachtet werden kann.
- Quote paper
- Wilhelm Weber (Author), 2008, Der Mensch als Krönung der Schöpfung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132428