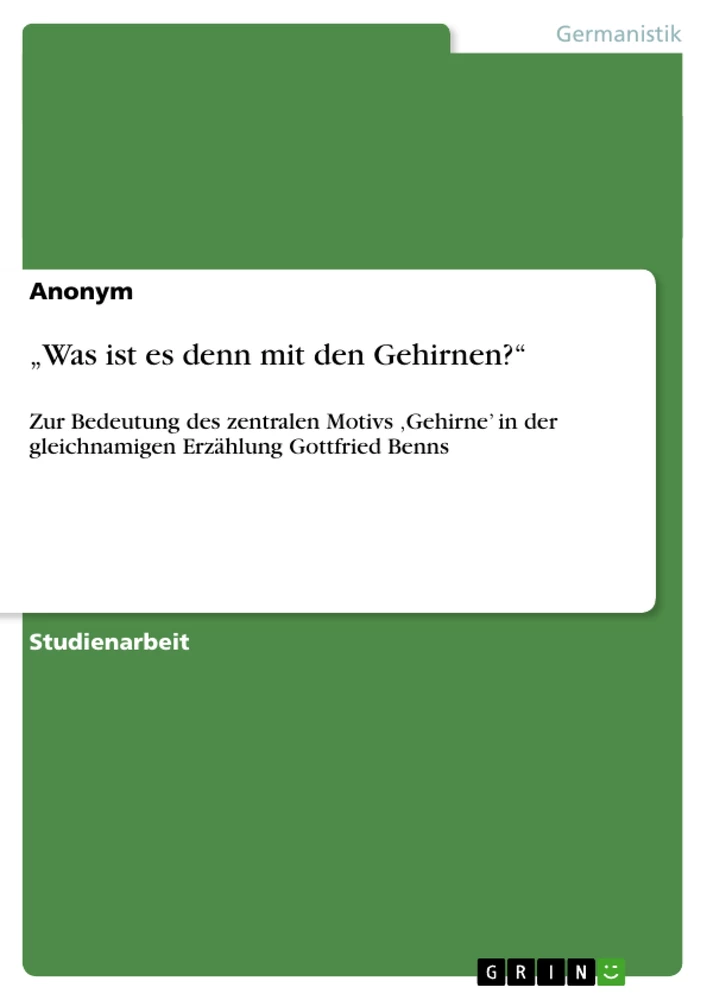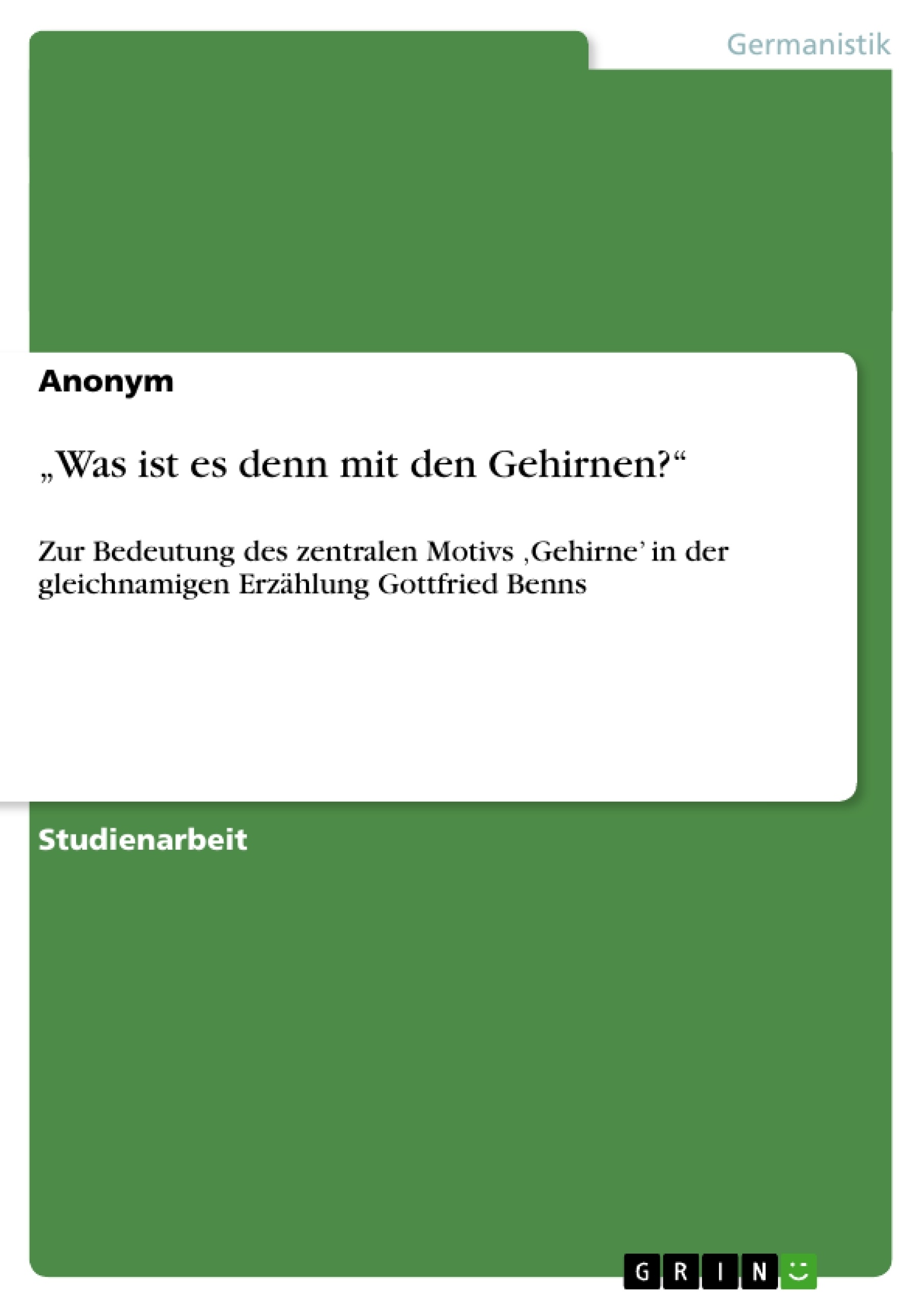Unter dem Schlagwort „Gehirne“ brachte Gottfried Benn im Jahr 1916 fünf Novellen heraus. Die erste Erzählung aus diesem Band, ebenfalls Gehirne genannt, steht im Mittelpunkt dieser Arbeit. Der zentrale Begriff ‚Gehirn’ wird darin, außer im Titel, zwar erst fast am Ende der Erzählung beim Namen genannt, spielt aber für ihr Funktionieren eine entscheidende Rolle.
Das recht kurze Prosastück Gehirne handelt von Rönne, einem Arzt, der sich den Zerfall seiner Großhirnrinde diagnostiziert. Der Fakt, dass der Autor Gottfried Benn selbst Arzt war, erscheint unter diesem Gesichtspunkt besonders interessant. In der Sekundärliteratur lag es da auch häufig nahe, Rönne mit Benn gleichzusetzen. Doch dies ist zu oberflächlich. Hinter den ‚Gehirnen’ steckt mehr als nur eine Anspielung auf Benns Biographie. – Inwiefern Benns „anderes“ Leben, das als Arzt, seine Erzählung Gehirne nicht nur um einen fundierten medizinischen Wissenskontext bereicherte, sondern dadurch auch (wissenschafts-)kritische Elemente mit einflossen, soll im Folgenden aufgezeigt werden. Es gilt dabei, eine Interpretationsmöglichkeit zu finden, welches Programm von der zentralen Metapher ‚Gehirn’ in Hinblick auf den Text ausgeht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wissensstand der Hirnforschung um 1900
- Zerfallsprozess und Gegenmaßnahmen
- Gehirn-Dissoziation als Ich-Dissoziation
- Verlust von Gedächtnis und Zeitgefühl
- Veränderte Wahrnehmung
- Verlust des Realitätsbewusstseins und des Raumgefühls
- Verlust der Kommunikationsfähigkeit
- Erschöpfung, Bewegungsrückgang und Trägheit als Konsequenz
- Maßnahmen Rönnes gegen die Ich-Dissoziation
- Aufschreiben und Dokumentation – (Be)greifbar bleiben
- Problembewältigungsversuche mit Hilfe von (wissenschaftlicher) Routine
- Gehirn-Dissoziation als Ich-Dissoziation
- „Gehirn“ als Prinzip - Das Programm der Erzählung
- Zerfall und Genese in der Erzählung „Gehirne“
- „[...] und muss immer darnach forschen, was mit mir möglich sei..."
- Sinnbildlicher Ausbruch aus dem „,Kristall“.
- Von der Rationalität zurück zur Instinktivität – Wider die Großhirnrinde
- Flucht in die Sprachwelt
- Wissenschaftskritik
- Zerfall und Genese in der Erzählung „Gehirne“
- Zusammenfassung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Gottfried Benns Erzählung „Gehirne“ aus dem Jahr 1914 und untersucht die Bedeutung des zentralen Motivs „Gehirn“ im Kontext der Hirnforschung um 1900. Ziel ist es, das Programm der Erzählung zu entschlüsseln und die Rolle des Gehirns als Metapher für den Zerfall und die Genese der Persönlichkeit des Protagonisten Rönne zu beleuchten.
- Die Bedeutung des Gehirns als Metapher für den Zerfall und die Genese der Persönlichkeit
- Die Rolle des medizinischen Wissens und der Wissenschaftskritik in der Erzählung
- Die Darstellung von Ich-Dissoziation und den damit verbundenen Veränderungen in Wahrnehmung, Gedächtnis und Kommunikation
- Die Analyse von Rönnes Bemühungen, den Zerfall seiner Großhirnrinde aufzuhalten
- Die Verbindung von Benns eigener Biographie als Arzt mit der Erzählung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Erzählung „Gehirne“ ein und stellt den zentralen Begriff „Gehirn“ in den Mittelpunkt der Analyse. Es wird auf die Bedeutung des Gehirns als Organ, das den Menschen seit jeher fasziniert, hingewiesen und die besondere Relevanz des Begriffs für die Erzählung hervorgehoben.
Das zweite Kapitel beleuchtet den Wissensstand der Hirnforschung um 1900, insbesondere die Lokalisation von Hirnfunktionen in Arealen der Großhirnrinde. Es werden Erkenntnisse aus Meyers Großem Konversationslexikon von 1908 herangezogen, die die damalige Vorstellung vom Gehirn als Organ der Seelentätigkeit und die Zuordnung bestimmter psychischer Funktionen zu bestimmten Hirnregionen beleuchten.
Das dritte Kapitel untersucht die Dissoziation des Gehirns in der Erzählung und die Annahme, dass mit ihr eine Ich-Dissoziation, ein Persönlichkeitszerfall des Protagonisten Rönne einhergeht. Es werden die pathologischen Veränderungen in den Bereichen Gedächtnis / Zeitgefühl, Wahrnehmung, Kommunikationsfähigkeit sowie Orientierung im Raum beschrieben, die im Laufe der Erzählung an Rönne auftreten.
Das vierte Kapitel analysiert das Programm der Erzählung „Gehirne“ und die Bedeutung des Zerfalls der Großhirnrinde als sowohl destruktiver als auch generativer Prozess. Es wird auf die Rolle des Gehirns als Prinzip und die Verbindung von Zerfall und Genese in der Erzählung eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Gottfried Benn, „Gehirne“, Hirnforschung, Großhirnrinde, Ich-Dissoziation, Zerfall, Genese, Persönlichkeit, Wahrnehmung, Gedächtnis, Kommunikation, Rönne, Wissenschaftskritik, Medizin, Literatur, Moderne.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2007, „Was ist es denn mit den Gehirnen?“ , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132424