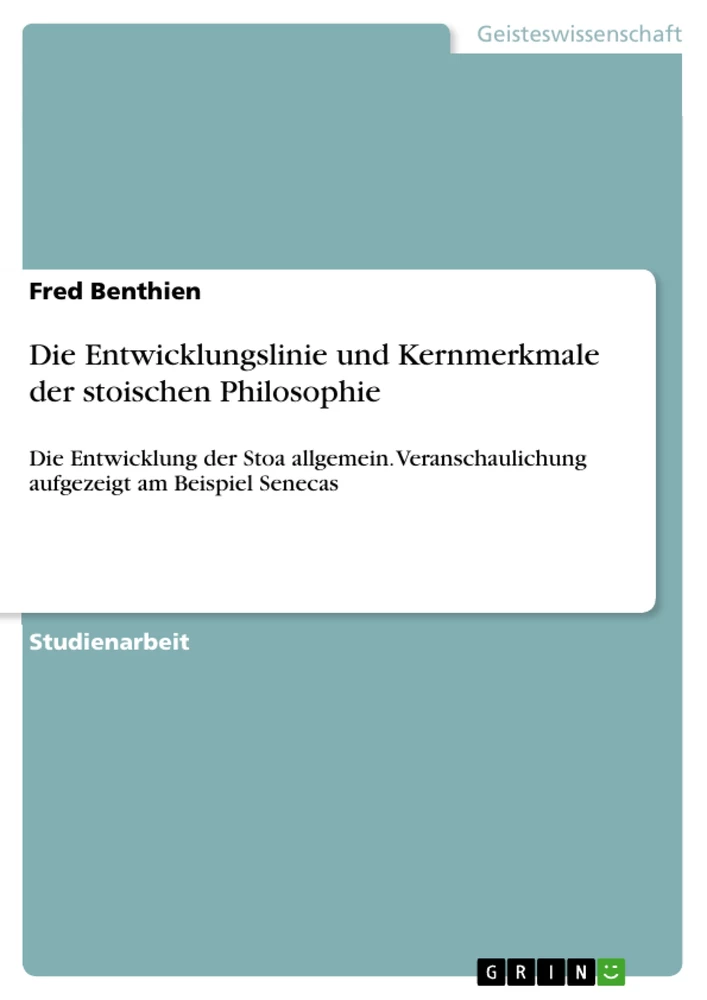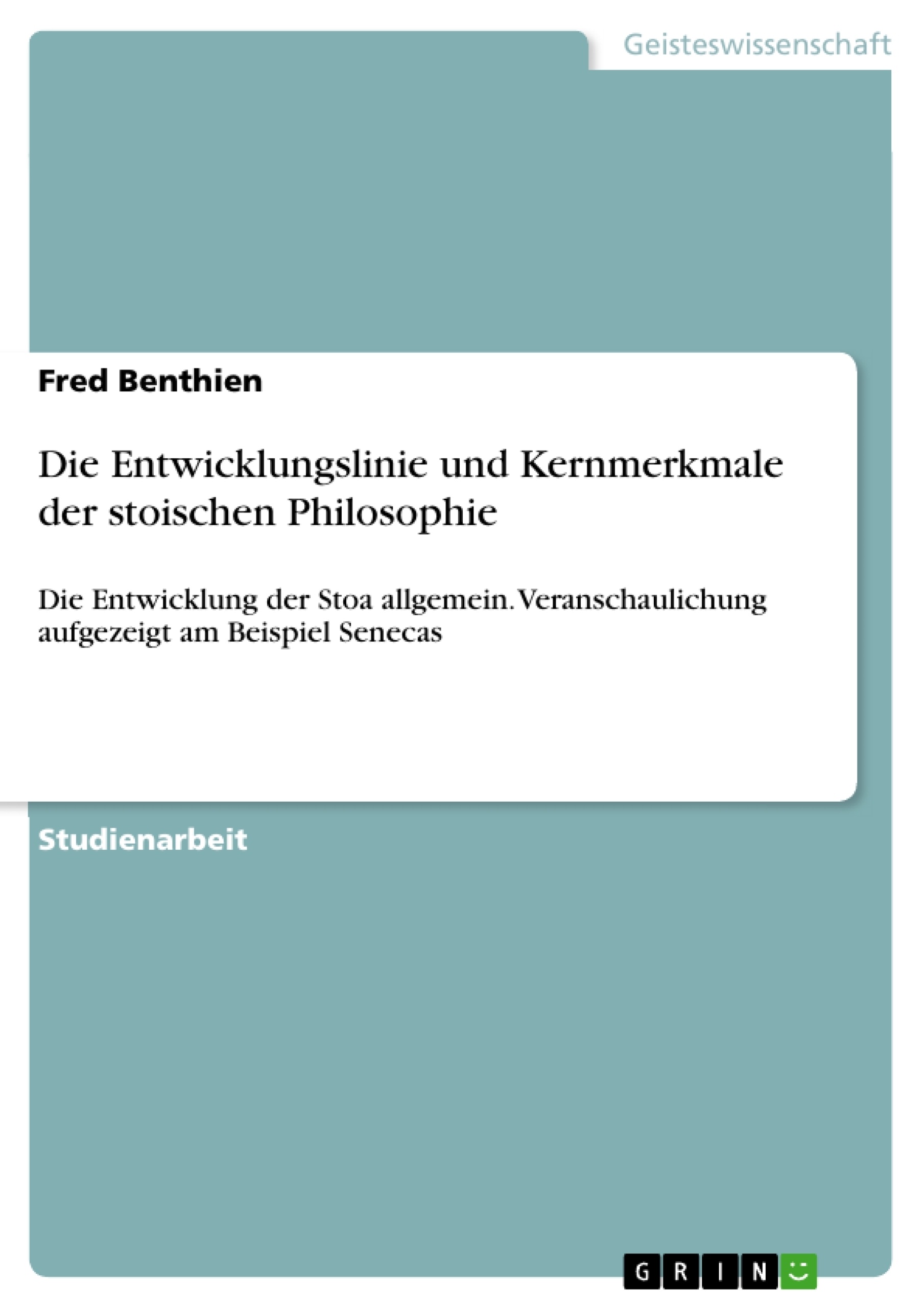Die Stoa ist neben dem Epikureismus eine der bedeutendsten im Hellenismus gegründeten Philosophenschulen. Sie entstand um das Jahr 300 v. Chr. in Athen durch das Gedankengut Zenons aus Kition. Ihren Namen verdankt sie der στοὰ ποικίλη, einer mit bunten mythologischen Szenen verzierten Vorhalle auf der Agora, wo Zenon aufgrund eines anfänglichen Geldmangels seiner Schule in einem öffentlichen Raum seine Lehren zu propagieren pflegte. Die damit einhergehende Bezeichnung seiner Schüler als οἱ ἐκ τῆς στοᾶς hat sich insofern erhalten, als nun die gesamte Philosophie, die sich daraus entwickelt hat, Stoa genannt wird.
Doch auf welche Wesensmerkmale dieser Schule rekurriert wird, wenn einer gewissen Einstellungs- oder Denkweise aus heutiger Sicht das Attribut „stoisch“ zugewiesen wird, lässt sich nicht eindeutig bestimmen. Ferner können keine Verallgemeinerungen darüber getroffen werden, was die stoischen Größen in ihrer Zeit jeweils als dem Dogma entsprechend oder ungeraten erachteten, da sich die 600-jährige Bestandszeit der Stoa nicht im Mindesten als statisches Gebilde zusammenfassen lässt. Vielmehr verliehen die bekannten Vertreter der Lehre ihre eigene Prägung, sodass diese sich stets im Wandel befand. Gemein ist allen Phasen der stoischen Lehre das Streben nach Erkenntnisgewinn in den Kategorien Physik (Kosmogonie), Logik (einschließlich Erkenntnistheorie) und besonders Ethik (Güter- und Tugendlehre). Diese sind stets eng an die Fragen nach dem angemessenen Umgang mit Philosophie sowie der dazugehörigen Weltvorstellung angeknüpft, die wiederum ihrerseits an die jeweiligen Göttervorstellungen gekoppelt ist. Zudem ist die Affektlehre, der rechte Umgang bzw. das Ablassen von Emotionen (apatheia) wie Trauer und Wut diesen angebunden.
In der Forschung werden zumeist moralische Aussprüche oder Sentenzen großer antiker Köpfe mit dem Etikett „stoisch“ versehen und verabsolutiert, ohne weiter zu hinterfragen, wie viel stoischer Gehalt diesen wirklich zu eigen ist. Nun, da dem römischen Denker, Politiker und Schriftsteller Seneca die Zugehörigkeit zur stoischen Lehre allgemein zugesprochen wird – wie er es selbst in seinem Dialog De Constantia Sapientis äußert – soll anhand seiner Person exemplarisch hinterfragt werden, inwiefern seine Lehre in der Tradition der griechischen Philosophen steht und als stoisch zu bezeichnen ist. Hierfür muss jedoch zunächst einmal die Entwicklungslinie der Stoa sowie ihre Kerninhalte betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, das stoische Gedankengut und seine Anwendung in den Schriften des römischen Philosophen Seneca zu untersuchen. Sie analysiert Senecas Schriften im Lichte der stoischen Tradition und beleuchtet, inwieweit seine Lehre im Einklang mit den Kernlehren der griechischen Stoa steht.
- Die Entwicklung und Kerninhalte der stoischen Philosophie
- Die stoische Weltsicht und ihr Verständnis von göttlicher Ordnung und menschlicher Handlungsfreiheit
- Die Rolle der Affektlehre in der stoischen Ethik und die Bedeutung der Apathéia
- Der Einfluss der stoischen Lehre auf Seneca und die Rezeption der stoischen Philosophie im römischen Kontext
- Die Bedeutung der stoischen Lehre für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Stoa als bedeutende philosophische Schule des Hellenismus ein und beleuchtet ihre Entstehung und ihre zentrale Bedeutung im antiken Denken. Sie beschreibt die drei Phasen der stoischen Lehre, die Entwicklung ihrer Kernkonzepte, die Bedeutung der Ethik und die Herausforderungen der Forschung in Bezug auf die Anwendung des Begriffs "stoisch".
Hauptteil
Der Hauptteil der Arbeit konzentriert sich auf die stoische Weltsicht und ihre wichtigsten Lehren. Er beleuchtet die stoische Philosophie der alten Stoa mit Zenon, Kleanthes und Chrysipp und zeigt die Rolle der Affektlehre und die Bedeutung der Eudämonie auf. Die Bedeutung der stoischen Philosophie für den Umgang mit Emotionen und der Suche nach innerem Frieden wird erläutert. Die Bedeutung der stoischen Lehre in Zeiten der Diadochen wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Stoa, Seneca, Hellenismus, Philosophie, Ethik, Apathéia, Affektlehre, Eudämonie, göttliche Ordnung, Handlungsfreiheit, Weltordnung, Logos, Vernunft, Telos, römischer Kontext, Diadochen.
- Quote paper
- Fred Benthien (Author), 2019, Die Entwicklungslinie und Kernmerkmale der stoischen Philosophie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1324010