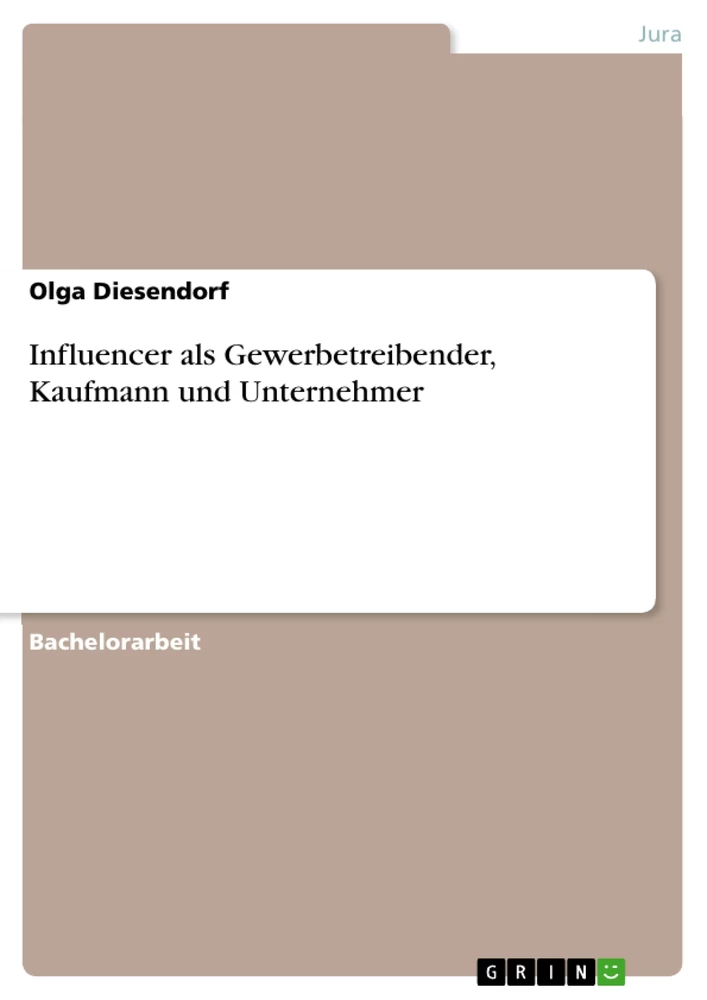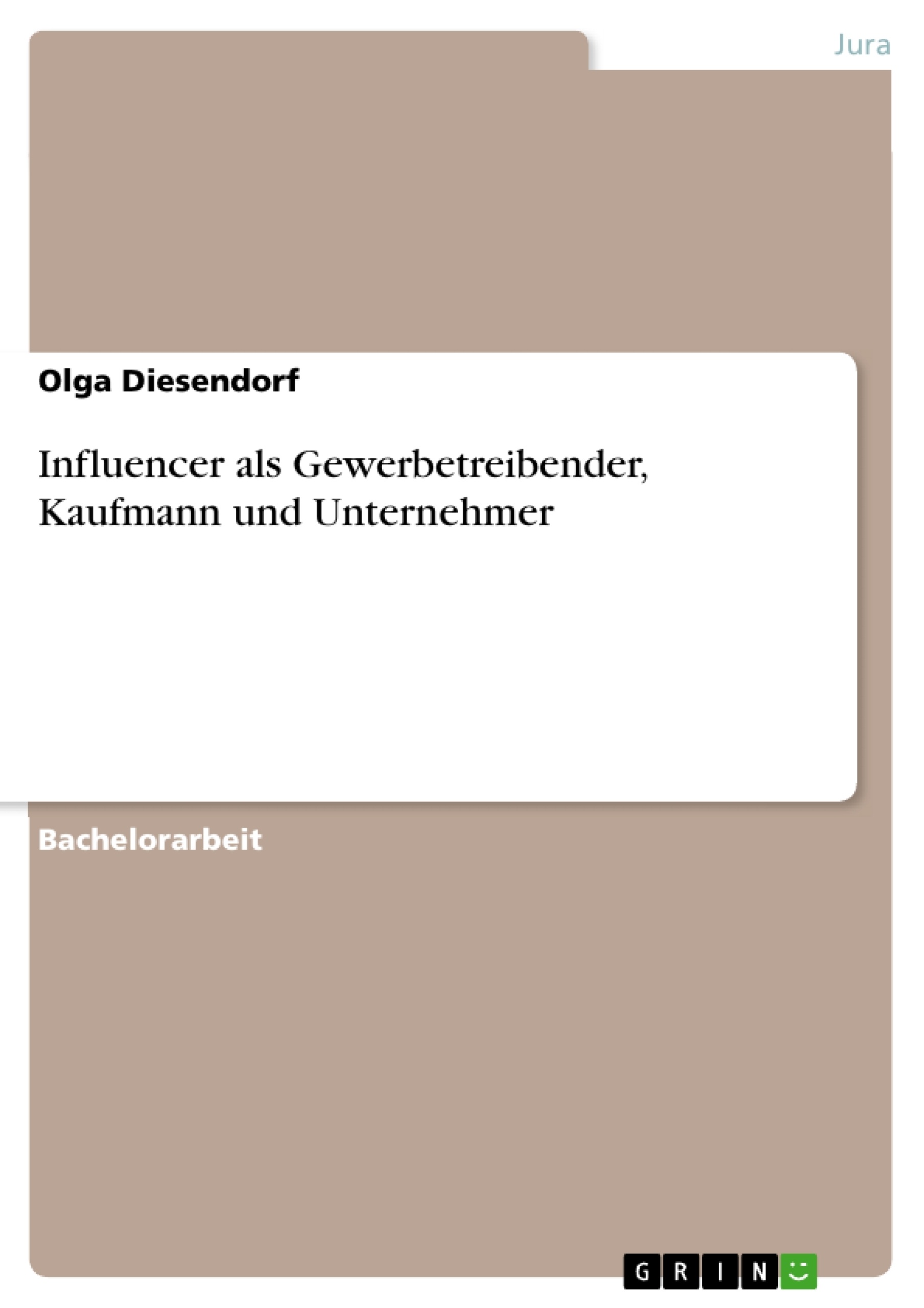In der vorliegenden Arbeit wird das neue Berufsbild "Influencer" aus der Perspektive des bürgerlichen Rechts untersucht. Konkret wird die Frage aufgeworfen, ob Influencer als Gewerbetreibende, Kaufleute und/oder Unternehmen zu qualifizieren sind.
In der heutigen Zeit der voranschreitenden Digitalisierung gewinnen die Social-Media-Plattformen wie YouTube, Instagram, Twitter oder Facebook zunehmend an Bedeutung. Immer mehr Menschen jeden Alters teilen in sozialen Netzwerken ihren Alltag mit der Öffentlichkeit und geben ihre persönliche Meinung zu unterschiedlichen Themen wieder. Dadurch ist ein neues Berufsbild entstanden – Influencer.
Die neuen Social-Media-Stars verfügen über einen direkten Zugang zu ihren Fans und machen neue Formen der medialen Kundenansprache möglich. Durch die einfachen Publishing-Möglichkeiten hat sich die Kommunikation stark verändert. Diese Entwicklung ist den Unternehmen nicht entgangen. Immer mehr Marken setzen auf die Zusammenarbeit mit Influencern. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns haben diese Entwicklung nur noch beschleunigt. Auch bisher eher traditionell agierende Unternehmen haben ihr Geschäft verstärkt in den Onlinebereich verlagert.
Zur Einleitung in die Problematik wird zunächst der Begriff des Influencers definiert sowie zwischen den unterschiedlichen Arten von Influencern differenziert. Sodann werden verschiedene Geschäftsmodelle dargestellt. Anschließend wird analysiert, wie sich Influencer in bürgerlich-rechtlichen Kategorien einordnen lassen. Insbesondere wird geklärt, inwieweit sich die Argumentation zum UWG auf den Begriff des Unternehmers im Sinne des § 14 Abs. 1 BGB über-tragen lässt. Danach werden die steuerlichen Konsequenzen untersucht. Dabei wird zwischen den Einkünften aus selbständiger Tätigkeit sowie aus Gewerbebetrieb differenziert. Abschließend wird ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Begriffe und Geschäftsmodelle
- I. Influencer
- 1. Definition
- 2. Blogger versus Influencer
- 3. Arten von Influencer
- a) Einteilung nach Typologie
- b) Einteilung nach Anzahl der Follower
- II. Geschäftsmodelle
- 1. Social-Media-Werbung
- a) Einkünfte aus Werbekooperationen
- b) Einkünfte aus Affiliate-Marketing
- 2. Verkauf eigener Produkte
- 3. Dienstleistungen
- C. Einordnung von Influencern
- I. Influencer als Gewerbetreibender
- II. Influencer als Kaufmann
- III. Influencer als Unternehmer
- D. Steuerliche Konsequenzen
- I. Einkommensteuer
- II. Gewerbesteuer
- III. Umsatzsteuer
- E. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Berufsbild des Influencers aus wirtschaftsrechtlicher Perspektive. Ziel ist es, die rechtliche Einordnung von Influencern als Gewerbetreibende, Kaufleute und/oder Unternehmer zu klären. Die Arbeit analysiert die relevanten Rechtsgrundlagen und untersucht die steuerlichen Konsequenzen der Influencer-Tätigkeit.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Influencer“
- Analyse verschiedener Geschäftsmodelle von Influencern
- Rechtliche Einordnung von Influencern im bürgerlichen Recht
- Untersuchung der steuerlichen Relevanz der Influencer-Tätigkeit
- Übertragung der Argumentation des UWG auf den Unternehmerbegriff im BGB
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die zunehmende Bedeutung von Social-Media-Plattformen und das daraus entstandene Berufsbild des Influencers. Sie erläutert die Relevanz der rechtlichen Einordnung von Influencern und skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Definition des Begriffs, die Analyse verschiedener Geschäftsmodelle, die rechtliche Einordnung und die steuerlichen Konsequenzen umfasst.
B. Begriffe und Geschäftsmodelle: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Influencer“, differenziert zwischen verschiedenen Arten von Influencern (nach Typologie und Followerzahl) und beschreibt diverse Geschäftsmodelle, darunter Social-Media-Werbung (Werbekooperationen und Affiliate-Marketing), den Verkauf eigener Produkte und die Erbringung von Dienstleistungen. Es legt die Grundlage für die spätere rechtliche Einordnung.
C. Einordnung von Influencern: Dieses Kapitel analysiert die Einordnung von Influencern in die Kategorien Gewerbetreibender, Kaufmann und Unternehmer. Es untersucht die jeweiligen Merkmale und Kriterien und bewertet, inwieweit Influencer diese erfüllen. Die Analyse umfasst sowohl positive als auch negative Merkmale für jede Kategorie und beleuchtet die rechtlichen Implikationen.
D. Steuerliche Konsequenzen: Dieses Kapitel befasst sich mit den steuerlichen Aspekten der Influencer-Tätigkeit. Es differenziert zwischen Einkünften aus selbständiger Tätigkeit und Gewerbebetrieb und analysiert die jeweiligen Besteuerungsregeln. Die Kapitel untersuchen die Einkommensteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer im Kontext der Influencer-Tätigkeit.
Schlüsselwörter
Influencer, Gewerbetreibender, Kaufmann, Unternehmer, Social-Media-Marketing, Werbekooperationen, Affiliate-Marketing, Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, bürgerliches Recht, UWG, § 14 Abs. 1 BGB, Geschäftsmodelle, digitale Wirtschaft.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Influencer - Rechtliche und Steuerliche Einordnung
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht das Berufsbild des Influencers aus wirtschaftsrechtlicher Sicht. Sie klärt die rechtliche Einordnung von Influencern als Gewerbetreibende, Kaufleute und/oder Unternehmer und analysiert die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung des Begriffs „Influencer“, analysiert verschiedene Geschäftsmodelle (Social-Media-Werbung, Affiliate-Marketing, Verkauf eigener Produkte, Dienstleistungen), untersucht die rechtliche Einordnung im bürgerlichen Recht und beleuchtet die steuerliche Relevanz (Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Begriffe und Geschäftsmodelle, Einordnung von Influencern, Steuerliche Konsequenzen und Zusammenfassung/Ausblick. Das Kapitel „Begriffe und Geschäftsmodelle“ differenziert zwischen Influencer-Arten (nach Typologie und Followerzahl). Das Kapitel „Einordnung von Influencern“ analysiert die Einordnung in die Kategorien Gewerbetreibender, Kaufmann und Unternehmer. Das Kapitel „Steuerliche Konsequenzen“ befasst sich mit Einkommensteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer.
Welche Geschäftsmodelle von Influencern werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Geschäftsmodelle, darunter Social-Media-Werbung (einschließlich Werbekooperationen und Affiliate-Marketing), den Verkauf eigener Produkte und die Erbringung von Dienstleistungen.
Wie werden Influencer rechtlich eingeordnet?
Die Arbeit analysiert die Einordnung von Influencern als Gewerbetreibende, Kaufleute und Unternehmer, unter Berücksichtigung der jeweiligen Merkmale und Kriterien und der rechtlichen Implikationen jeder Kategorie.
Welche steuerlichen Konsequenzen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Einkommensteuer-, Gewerbesteuer- und Umsatzsteuerpflicht von Influencern, differenziert zwischen Einkünften aus selbständiger Tätigkeit und Gewerbebetrieb und analysiert die jeweiligen Besteuerungsregeln.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Influencer, Gewerbetreibender, Kaufmann, Unternehmer, Social-Media-Marketing, Werbekooperationen, Affiliate-Marketing, Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, bürgerliches Recht, UWG, § 14 Abs. 1 BGB, Geschäftsmodelle, digitale Wirtschaft.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist die Klärung der rechtlichen Einordnung von Influencern und die Analyse der steuerlichen Konsequenzen ihrer Tätigkeit.
- Quote paper
- Olga Diesendorf (Author), 2022, Influencer als Gewerbetreibender, Kaufmann und Unternehmer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1323275