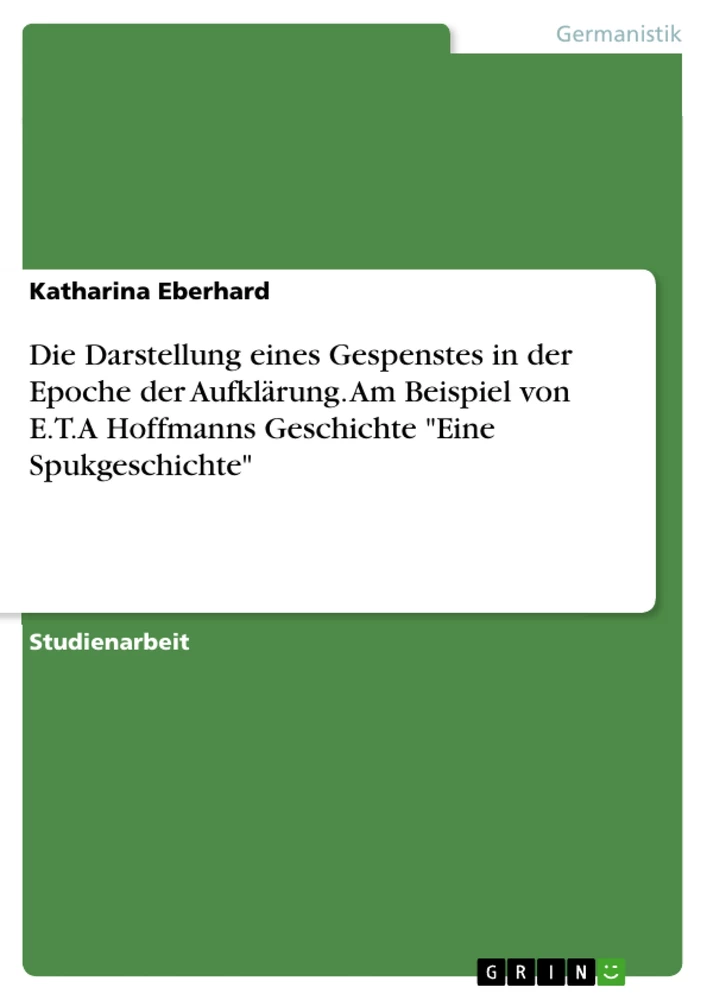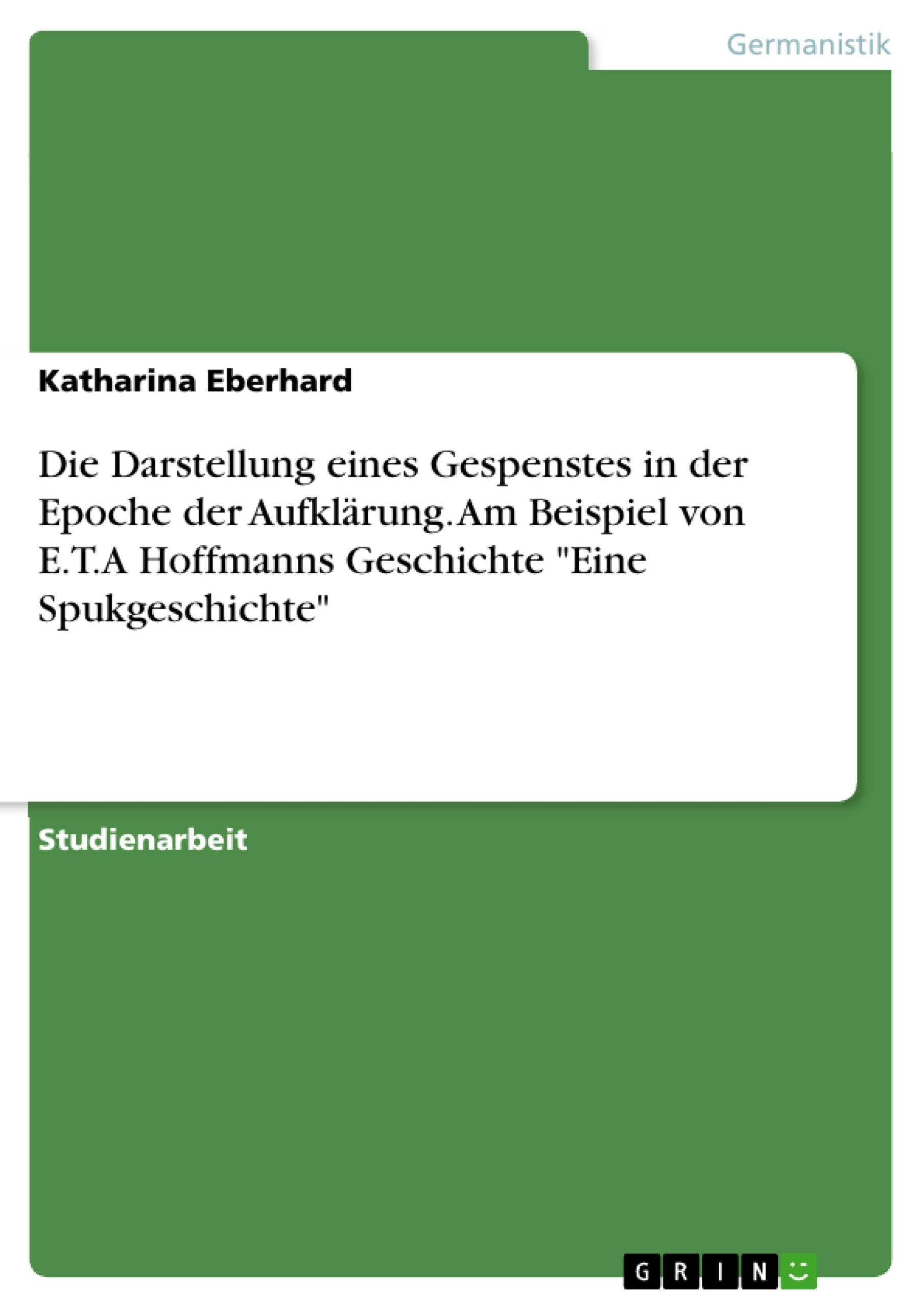Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, inwieweit die Darstellung eines Gespenstes in der Epoche der Aufklärung in E.T.A. Hoffmanns Geschichte „Eine Spukgeschichte“ wiedergegeben wird. Dies zeige ich, indem ich zuerst die Geisterauffassung der Aufklärung erläutere und dabei vor allem auf den Göttinger Professor Georg Christoph Lichtenberg und den Hallenser Philosoph Georg Friedrich Meier eingehe. Als nächstes analysiere ich Hoffmanns Elemente einer Gespenstergeschichte und im Anschluss daran betrachte ich die in der Geschichte vorkommende Figur der weißen Frau als Gestalt des Aberglaubens näher. Danach wende ich mich der Protagonistin der Geschichte, der jüngeren Tochter Adelgunde des Obristen P. und deren Ambivalenz zu. Das Unheimliche leite ich ein, indem ich auf den durch den Spuk erzeugten Wendepunkt eingehe. Als nächstes erläutere ich das Motiv des Arztes, welches vor allem für das Ende der Geschichte sehr wichtig und ausschlaggebend für die Katastrophe ist. Das Ende als Verwurf der Geistertheorie der Aufklärung stelle ich anhand des nächsten Abschnittes dar, woraufhin ich die Folgen des Spuks für die Familie analysiere. Zum Schluss beschreibe ich das Unheimliche im Rahmengespräch der vier Serapionsbrüder und gehe auf den Leser als subjektiven Betrachter ein.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung zur Fragestellung
- Geisterauffassung der Aufklärung
- Hoffmanns Elemente einer Gespenstergeschichte
- Die weiße Frau als Gestalt des Aberglaubens.
- Adelgundes ambivalenter Zustand.
- Der durch den Spuk erzeugte Wendepunkt.....
- Das Motiv des Arztes
- Das Ende als Verwurf der Geistertheorie in der Aufklärung.
- Die Folgen des übernatürlichen Phänomens
- Das Unheimliche im Rahmengespräch
- Der Leser als subjektiver Betrachter .
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Darstellung eines Gespenstes in E.T.A. Hoffmanns Geschichte „Eine Spukgeschichte“ im Kontext der Aufklärung. Sie beleuchtet die gegensätzlichen Weltbilder der Rationalität und des Irrationalen und analysiert die Reaktion der Figuren auf das übernatürliche Phänomen.
- Die Geisterauffassung der Aufklärung
- Hoffmanns Elemente einer Gespenstergeschichte
- Adelgundes ambivalenter Zustand und die Rolle des Unheimlichen
- Die Katastrophe als Folge des Spuks und der Verwerfung der Geistertheorie
- Der Leser als subjektiver Betrachter
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Fragestellung ein und zeigt die Ambivalenz zwischen rationaler und irrationaler Weltdeutung auf, die in Hoffmanns Geschichte „Eine Spukgeschichte“ deutlich wird. Das zweite Kapitel beleuchtet die Geisterauffassung der Aufklärung und untersucht die rationalen Erklärungen für das Übernatürliche. Der dritte Abschnitt analysiert Hoffmanns Elemente einer Gespenstergeschichte und stellt die weiße Frau als Gestalt des Aberglaubens dar.
Kapitel vier befasst sich mit der Protagonistin Adelgunde und ihrer ambivalenten Reaktion auf den Spuk. Kapitel fünf thematisiert den durch den Spuk erzeugten Wendepunkt und die daraufhin entstehende Katastrophe. Kapitel sechs analysiert das Motiv des Arztes und dessen Rolle im Verlauf der Geschichte. Das siebte Kapitel untersucht das Ende der Geschichte als Verwerfung der Geistertheorie der Aufklärung und zeigt die Folgen des Spuks für die Familie auf.
Die Kapitel acht und neun befassen sich mit dem Unheimlichen im Rahmengespräch der Serapionsbrüder und der Rolle des Lesers als subjektiver Betrachter.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Geisterauffassung, Aufklärung, übernatürliche Phänomene, Ambivalenz, Einbildungskraft, Spuk, Unheimliches, Katastrophe und subjektive Wahrnehmung.
- Quote paper
- Katharina Eberhard (Author), 2021, Die Darstellung eines Gespenstes in der Epoche der Aufklärung. Am Beispiel von E.T.A Hoffmanns Geschichte "Eine Spukgeschichte", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1323042