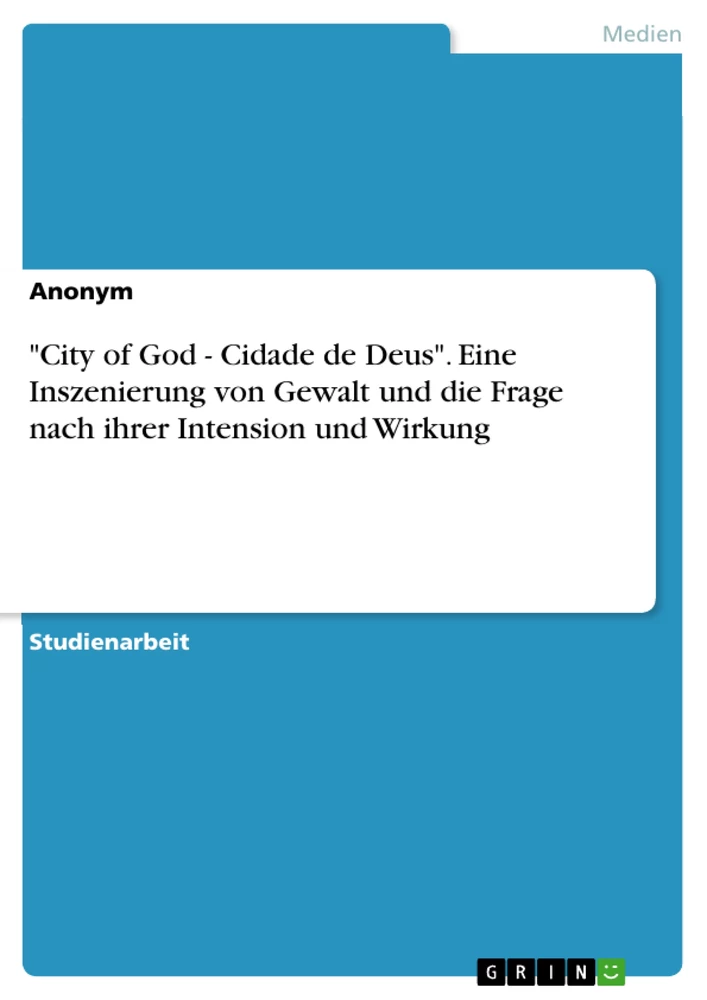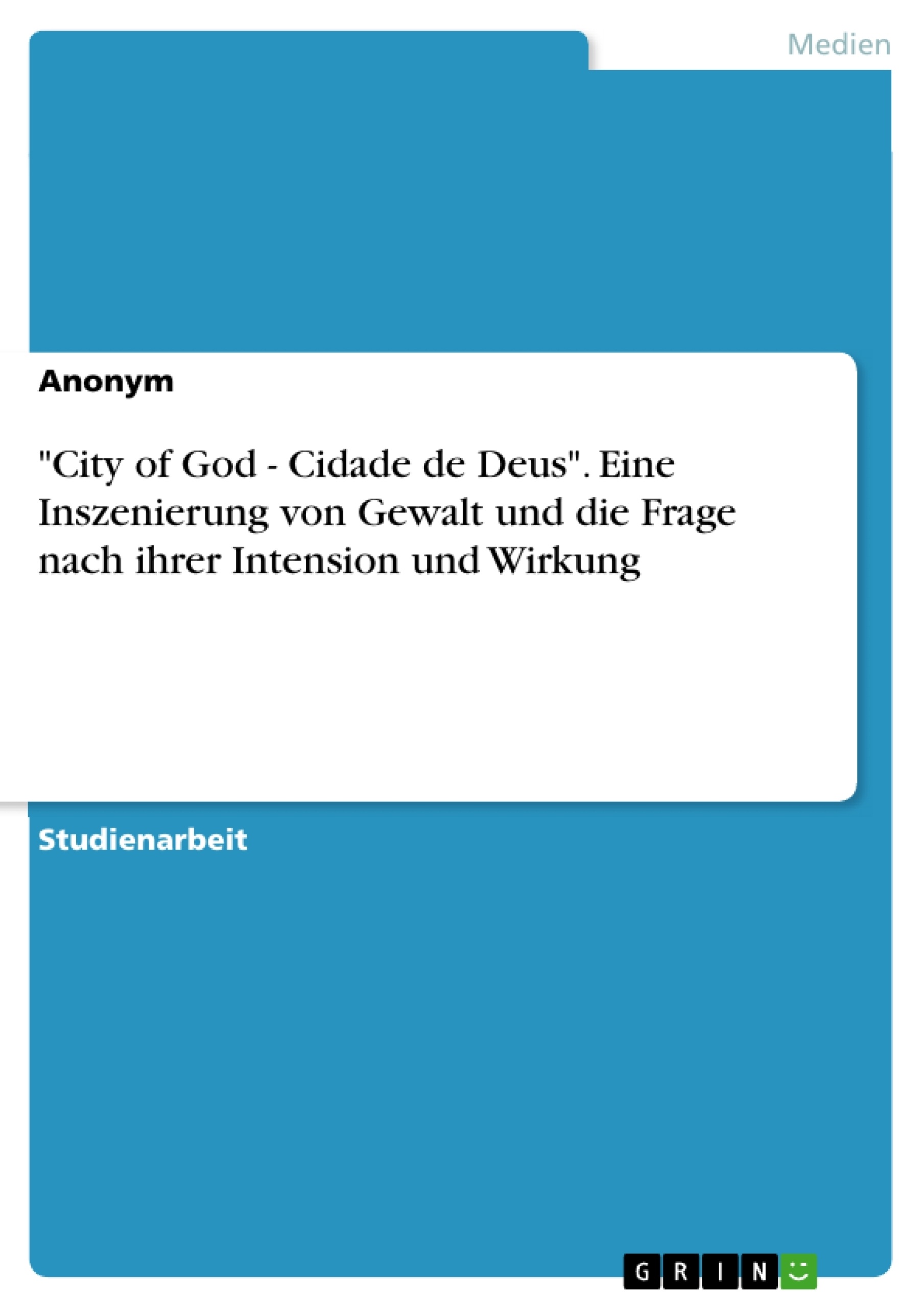Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Inszenierung von Gewalt im zeitgenössischen Lateinamerika. Dabei wird diese Inszenierung anhand des Buches und des Filmes Cidade de Deus/City of God untersucht. Die Kulisse bildet die lateinamerikanische Lebenswelt der Favelas in Rio de Janeiro.
Der Kinofilm Cidade de Deus von Fernando Meirelles wurde auf vielen renommierten Festivals der Filmkunst gefeiert. Er erhielt über zwanzig Auszeichnungen und ist weit über Brasilien hinaus bekannt. Dies alles obwohl er äußerst gewalttätig inszeniert ist, oder besser: Gerade weil er so gewalttätig inszeniert ist?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- II.1. Das Buch und der Autor, Paulo Lins
- II.2. Der Film und seine Inszenierung
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Inszenierung von Gewalt im Film "Cidade de Deus" und analysiert deren Intention und Wirkung. Die Arbeit befasst sich kritisch mit den Aussagen des Regisseurs und des Autors Paulo Lins, um die Gründe für die gewählte Gewaltdarstellung zu ergründen und deren Rezeption beim Zuschauer zu beleuchten. Der soziale Kontext, in dem die Geschichte spielt und der Film gedreht wurde, wird ebenfalls berücksichtigt.
- Gewaltdarstellung als Mittel der Sozialkritik
- Der Einfluss des persönlichen Hintergrunds des Autors auf die Darstellung der Gewalt
- Die Wirkung der direkten Gewaltdarstellung auf den Zuschauer
- Soziale Missstände in den brasilianischen Favelas
- Die Rolle der Medien bei der Darstellung von Gewalt
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Intention und Wirkung der Gewaltdarstellung in "Cidade de Deus" vor. Der Film wird als ein Werk beschrieben, das trotz seiner expliziten Gewaltdarstellung große Anerkennung gefunden hat. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der die Analyse der Inszenierung, die Perspektiven auf die Gewalt und die Aussagen des Autors und Regisseurs umfasst. Der persönliche Bezug des Autors zum Thema wird angesprochen, ebenso wie die Bedeutung des sozialen Kontextes der Favelas.
II.1. Das Buch und der Autor Paulo Lins: Dieses Kapitel beleuchtet den Werdegang der Geschichte und untersucht die Motivationen des Autors Paulo Lins. Lins' persönliche Erfahrungen als aufgewachsener Farbiger in einer Favela bilden die Grundlage des Romans. Die Arbeit analysiert den möglichen Konflikt zwischen der Intention der Sozialkritik und dem kommerziellen Aspekt der Veröffentlichung eines solchen Werkes. Es wird diskutiert, ob die explizite Gewaltdarstellung ein Mittel zur Sozialkritik darstellt, um die Verdrängung des Elends in der brasilianischen Gesellschaft zu überwinden und die Aufmerksamkeit auf die Probleme in den Favelas zu lenken. Das Kapitel argumentiert, dass die rohe Gewaltdarstellung als Schockeffekt dienen soll, um ein Bewusstsein für die Missstände zu schaffen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Schlüsselwörter
Cidade de Deus, Paulo Lins, Gewaltdarstellung, Sozialkritik, Favela, Brasilien, Medien, Rezeption, Armut, Rassismus, Soziale Ungleichheit, Schockeffekt, Kommunikationsstrategie.
Häufig gestellte Fragen zu der Hausarbeit: "Cidade de Deus" - Inszenierung von Gewalt
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Inszenierung von Gewalt im Film "Cidade de Deus" und analysiert deren Intention und Wirkung. Sie befasst sich kritisch mit den Aussagen des Regisseurs und des Autors Paulo Lins, um die Gründe für die gewählte Gewaltdarstellung zu ergründen und deren Rezeption beim Zuschauer zu beleuchten. Der soziale Kontext der brasilianischen Favelas wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Gewaltdarstellung als Mittel der Sozialkritik, den Einfluss des persönlichen Hintergrunds des Autors auf die Darstellung der Gewalt, die Wirkung der direkten Gewaltdarstellung auf den Zuschauer, soziale Missstände in den brasilianischen Favelas und die Rolle der Medien bei der Darstellung von Gewalt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil (mit den Unterkapiteln "Das Buch und der Autor Paulo Lins" und "Der Film und seine Inszenierung") und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage vor und skizziert den methodischen Ansatz. Kapitel II.1 beleuchtet den Werdegang der Geschichte und die Motivationen des Autors Paulo Lins, seine persönlichen Erfahrungen und den möglichen Konflikt zwischen Sozialkritik und kommerziellem Aspekt. Der Hauptteil befasst sich auch mit der Inszenierung des Films. Das Fazit (Kapitel III) wird in der Zusammenfassung nicht explizit erläutert.
Welche Rolle spielt der Autor Paulo Lins in der Analyse?
Paulo Lins' persönliche Erfahrungen als aufgewachsener Farbiger in einer Favela bilden die Grundlage des Romans. Die Arbeit analysiert, wie seine Biografie und Motivationen die Darstellung der Gewalt im Buch und indirekt im Film beeinflussen. Es wird diskutiert, ob die explizite Gewaltdarstellung als Mittel zur Sozialkritik dient, um die Verdrängung des Elends in der brasilianischen Gesellschaft zu überwinden.
Welche Schlussfolgerung wird angestrebt?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, die Intention und Wirkung der Gewaltdarstellung in "Cidade de Deus" zu verstehen. Es wird untersucht, ob die rohe Gewaltdarstellung als Schockeffekt dient, um ein Bewusstsein für die Missstände in den Favelas zu schaffen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Rezeption der Gewaltdarstellung beim Zuschauer wird ebenfalls analysiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Cidade de Deus, Paulo Lins, Gewaltdarstellung, Sozialkritik, Favela, Brasilien, Medien, Rezeption, Armut, Rassismus, Soziale Ungleichheit, Schockeffekt, Kommunikationsstrategie.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2005, "City of God - Cidade de Deus". Eine Inszenierung von Gewalt und die Frage nach ihrer Intension und Wirkung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1322512