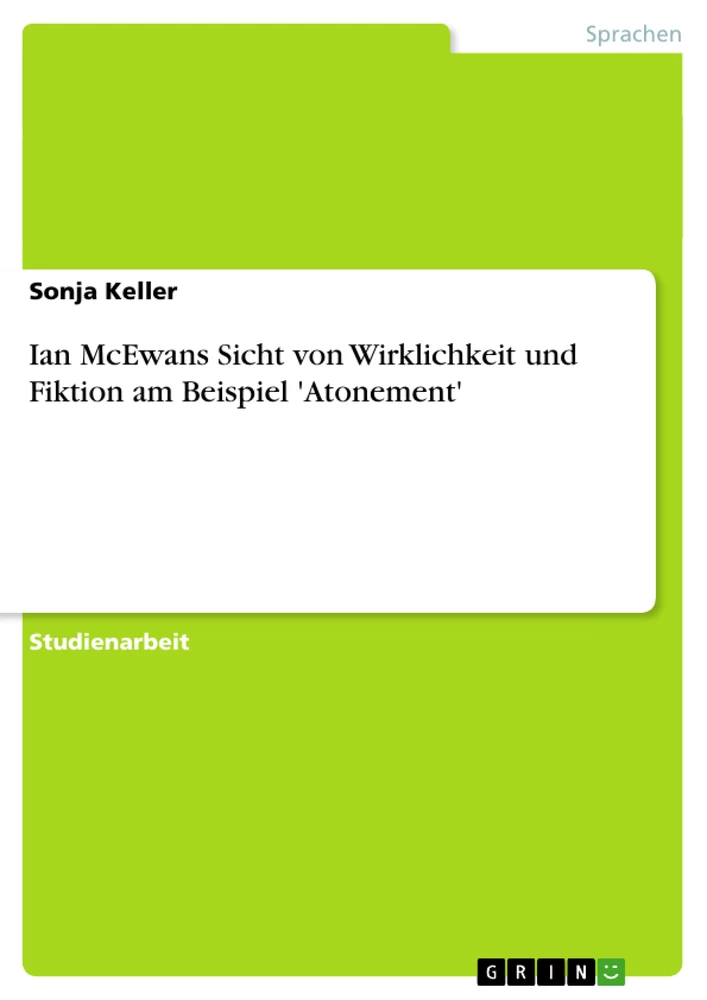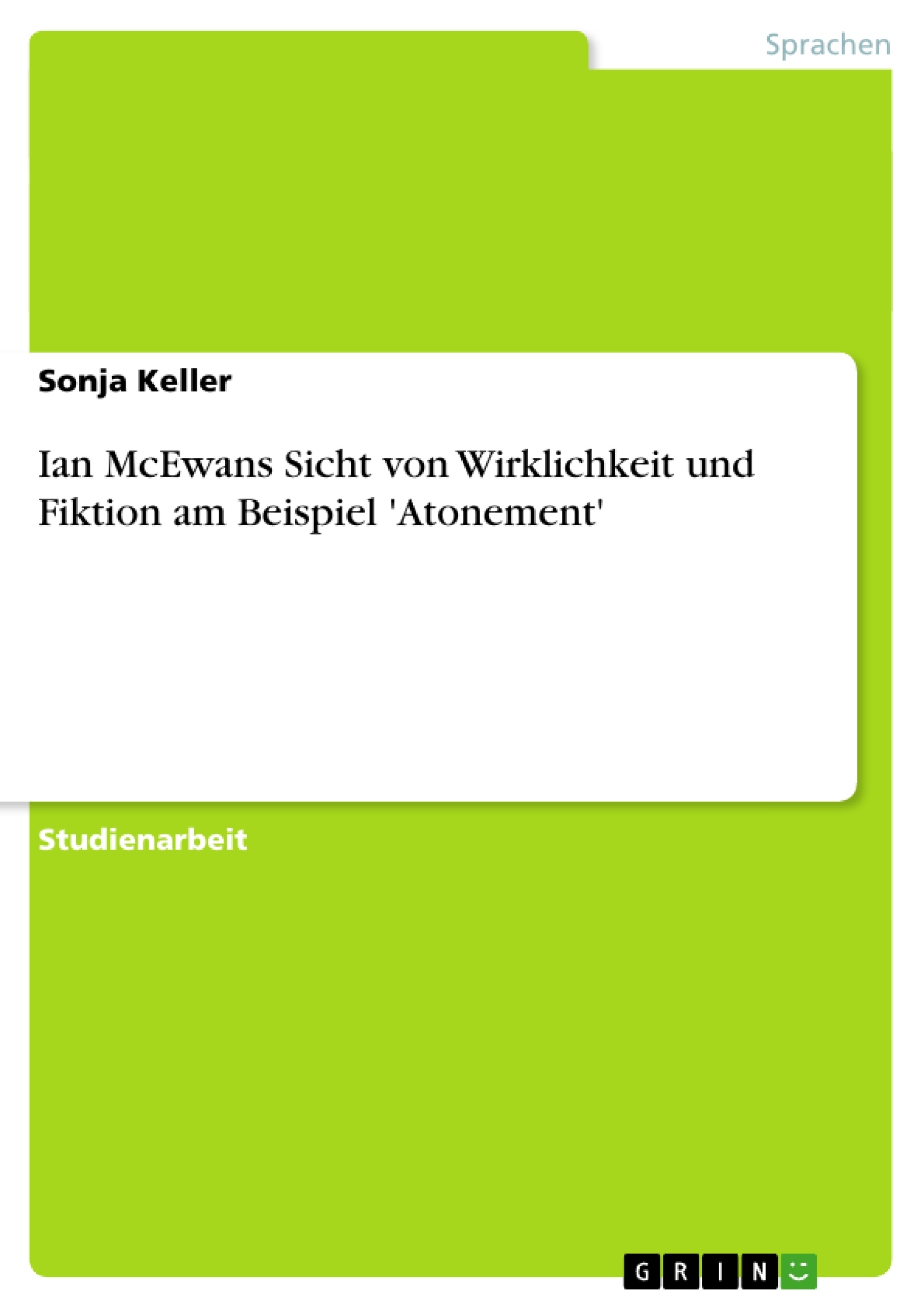Einen fiktionalen Roman als ein rein fiktives Konstrukt eines Autors zu betrachten, erscheint wohl nicht nur für jeden Literaturwissenschaftler die einzig richtige Herangehensweise an ein solches Werk zu sein. Doch genau mit diesem Selbstverständnis spielt Ian McEwan in seinem Roman Atonement, in dem er durch die Figur der Briony mit dem mimetischen Konzept bricht, und den Leser zutiefst erschreckt. Am Ende des eigentlichen Romans erfährt der Leser, der bis zu diesem Zeitpunkt von einem heterogetisch extradiegetischen Erzähler, der in der Geschichte nicht vorkommt, ausgehen musste, dass eine der Hauptfiguren des Romanes, Briony Tallis, die Erzählerin dieser Geschichte ist. Die Wirkung dieses ungewöhnlichen Bruches wird noch durch die Tatsache verstärkt, dass Briony während des ganzen Romanes mit einer von ihr selbst hervorgebrachten Lüge zu kämpfen hat, die schlussendlich auch der Grund für das Schreiben der Geschichte war. Briony war also durch die Geschichte hindurch die Person, die innerhalb der Erzählung am wenigsten glaubwürdig war. Plötzlich muss der Leser des ganzen zuvor gelesenen Roman nochmals neu überdenken, nichts scheint mehr stimmig zu sein, und eine starke Verwirrung setzt ein.
Was aber bezweckt McEwan durch dieses Spiel mit der Fiktion, welche Bedeutung hat für ihn die Wirklichkeit? Ist sie für ihn nicht wichtig, oder versucht er dadurch den Leser auf eine besondere Art und Weise zum Nachdenken anzuregen. Die folgende Arbeit befasst sich mit der Absicht McEwans, die hinter diesem Bruch mit der traditionellen Erzählweise zu Suchen ist und versucht, eine mögliche Sichtweise McEwans von Fiktion und Wirklichkeit im Roman herauszuarbeiten.
Hierzu erfolgt zunächst eine Betrachtung der unterschiedlichen Textarten die Mc-Ewan in Atonement verwendet, und auch auf die verschiedenen Erzählweisen soll kurz eingegangen werden. Im weiteren Verlauf wird das Verhältnis von Illusion und Wirklichkeit innerhalb des Romans aufgezeigt und die Funktion der Person Briony dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. TEXTARTEN IN ATONEMENT
- 3. WECHSEL DER ERZÄHLWEISEN
- 3.1 DER ERZÄHLER
- 3.2 FOKALISIERUNGSWECHSEL
- 4. DAS VERHÄLTNIS VON ILLUSION UND WIRKLICHKEIT ALS ROTER FADEN
- 5. DIE FIGUR DER BRIONY ALS MITTEL DER VERWIRRUNG?
- 6. ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Ian McEwans Roman "Atonement" und analysiert seine spielerische Auseinandersetzung mit den Konzepten von Fiktion und Wirklichkeit. Der Fokus liegt auf der ungewöhnlichen Erzählstruktur und dem Einfluss der Figur Briony auf die Wahrnehmung der Geschichte durch den Leser. Die Arbeit erforscht, wie McEwan die Grenzen zwischen Illusion und Realität verwischt und den Leser zum Nachdenken über seinen Umgang mit Fiktion anregt.
- Die verschiedenen Textarten in "Atonement" und ihre Bedeutung für die Darstellung von Wirklichkeit und Fiktion.
- Der Wechsel der Erzählweisen und die Rolle des Erzählers im Roman.
- Das Verhältnis von Illusion und Wirklichkeit als zentrales Thema.
- Die Funktion der Figur Briony und ihr Einfluss auf die Geschichte.
- McEwans Absicht hinter dem Bruch mit der traditionellen Erzählweise.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Frage nach McEwans Sicht auf Wirklichkeit und Fiktion in "Atonement". Sie hebt den überraschenden Bruch mit dem mimetischen Konzept durch die Enthüllung von Briony als Erzählerin hervor und beschreibt die daraus resultierende Verwirrung des Lesers. Die Arbeit kündigt die Analyse der verschiedenen Textarten, Erzählweisen und die Rolle von Briony an, um McEwans Intentionen zu verstehen.
2. Textarten in Atonement: Dieses Kapitel analysiert die vielschichtigen Textarten in "Atonement", die McEwans Ablehnung eines strikten mimetischen Konzepts zeigen. Es beschreibt die Verwendung von Erzählung, Gedankenfluss, Briefen und Kriegsbeschreibungen, die unterschiedliche Perspektiven und Realitätsstufen bieten. Die Einbeziehung von realen Personen wie Virginia Woolf unterstreicht die Vermischung von Fiktion und Wirklichkeit und eröffnet dem Leser diverse Interpretationsmöglichkeiten. Der Roman wird sowohl als Geschichtsroman als auch als Romanze mit einer zentralen Lüge als Grundlage betrachtet, die durch die Enthüllung am Ende problematisiert wird. Diese Vielschichtigkeit wird als McEwans Kommentar zum Umgang des Lesers mit Fiktion und Wirklichkeit interpretiert.
3. Wechsel der Erzählweisen: Das Kapitel behandelt den heterodiegetischen Erzähler, der die Geschichte erzählt, ohne selbst Teil der Handlung zu sein. Der überraschende Wechsel am Ende, die Enthüllung von Briony als Erzählerin, wird untersucht. Die Analyse des Übergangs von heterodiegetischer zu homodiegetischer Erzählweise im Anhang wird kurz erwähnt und betont den unerwarteten Perspektivwechsel für den Leser.
Schlüsselwörter
Ian McEwan, Atonement, Fiktion, Wirklichkeit, Erzählweise, Briony Tallis, mimetisches Konzept, Illusion, heterodiegetischer Erzähler, homodiegetischer Erzähler, Textarten, Romanze, Geschichtsroman.
Häufig gestellte Fragen zu Ian McEwans "Atonement"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Ian McEwans Roman "Atonement" im Hinblick auf seine spielerische Auseinandersetzung mit den Konzepten von Fiktion und Wirklichkeit. Der Fokus liegt auf der ungewöhnlichen Erzählstruktur und dem Einfluss der Figur Briony auf die Leserwahrnehmung.
Welche Themen werden im Roman untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte, darunter die verschiedenen Textarten im Roman und deren Bedeutung für die Darstellung von Wirklichkeit und Fiktion, den Wechsel der Erzählweisen und die Rolle des Erzählers, das Verhältnis von Illusion und Wirklichkeit als zentrales Thema, die Funktion der Figur Briony und ihren Einfluss auf die Geschichte, sowie McEwans Absicht hinter dem Bruch mit der traditionellen Erzählweise.
Welche Textarten werden in "Atonement" verwendet?
Der Roman verwendet eine Vielzahl von Textarten, darunter Erzählung, Gedankenfluss, Briefe und Kriegsbeschreibungen. Diese unterschiedlichen Perspektiven und Realitätsstufen tragen zur Vermischung von Fiktion und Wirklichkeit bei und bieten dem Leser diverse Interpretationsmöglichkeiten. Die Einbeziehung realer Personen wie Virginia Woolf verstärkt diesen Effekt.
Wie verändert sich die Erzählweise im Laufe des Romans?
Der Roman beginnt mit einem heterodiegetischen Erzähler, der die Geschichte erzählt, ohne selbst Teil der Handlung zu sein. Am Ende kommt es zu einem überraschenden Wechsel, der die Enthüllung von Briony als Erzählerin beinhaltet – ein Übergang von heterodiegetischer zu homodiegetischer Erzählweise. Dieser unerwartete Perspektivwechsel verunsichert den Leser und zwingt ihn zum Nachdenken über die Erzählinstanz und die Realität der dargestellten Ereignisse.
Welche Rolle spielt Briony Tallis im Roman?
Briony Tallis ist eine zentrale Figur, deren Einfluss auf die Wahrnehmung der Geschichte durch den Leser entscheidend ist. Ihre Handlungen und Perspektiven beeinflussen die Ereignisse maßgeblich und tragen zur Verwirrung und dem Verwischen der Grenzen zwischen Illusion und Wirklichkeit bei. Die Arbeit untersucht, wie Briony als Mittel der Verwirrung eingesetzt wird und welche Funktion sie im Kontext des Romans erfüllt.
Wie wird das Verhältnis von Illusion und Wirklichkeit dargestellt?
Das Verhältnis von Illusion und Wirklichkeit ist das zentrale Thema des Romans. McEwan verwischt die Grenzen zwischen diesen beiden Konzepten geschickt, indem er verschiedene Erzähltechniken und Textarten einsetzt. Dies regt den Leser dazu an, über seinen eigenen Umgang mit Fiktion und die Interpretation von narrativen Strukturen nachzudenken. Die Enthüllung am Ende des Romans stellt die vorherige Erzählung in Frage und führt zu einer Neubewertung der dargestellten "Wirklichkeit".
Welche Kapitel werden in der Arbeit zusammengefasst?
Die Arbeit fasst alle Kapitel zusammen: Die Einleitung, die Analyse der verschiedenen Textarten, die Untersuchung des Wechsels der Erzählweisen und die Schlussfolgerung. Jede Zusammenfassung beschreibt die wichtigsten Aspekte des jeweiligen Kapitels und betont die Relevanz für die Gesamtinterpretation des Romans.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Roman und die Arbeit?
Schlüsselwörter, die den Roman und die Analyse beschreiben, sind: Ian McEwan, Atonement, Fiktion, Wirklichkeit, Erzählweise, Briony Tallis, mimetisches Konzept, Illusion, heterodiegetischer Erzähler, homodiegetischer Erzähler, Textarten, Romanze, Geschichtsroman.
- Quote paper
- Sonja Keller (Author), 2003, Ian McEwans Sicht von Wirklichkeit und Fiktion am Beispiel 'Atonement', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132215