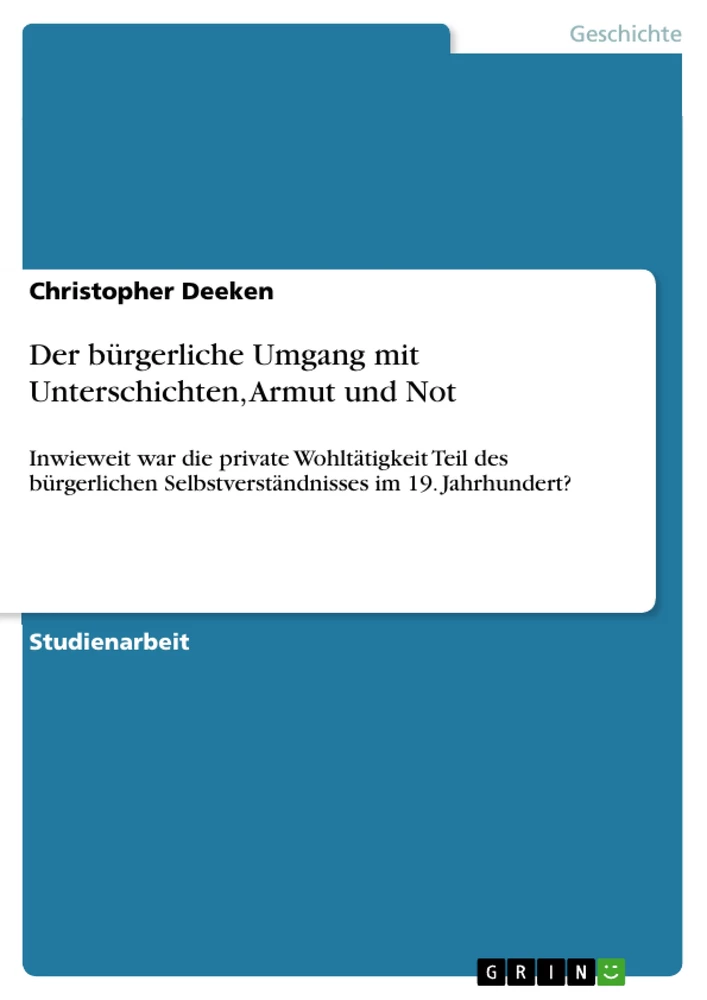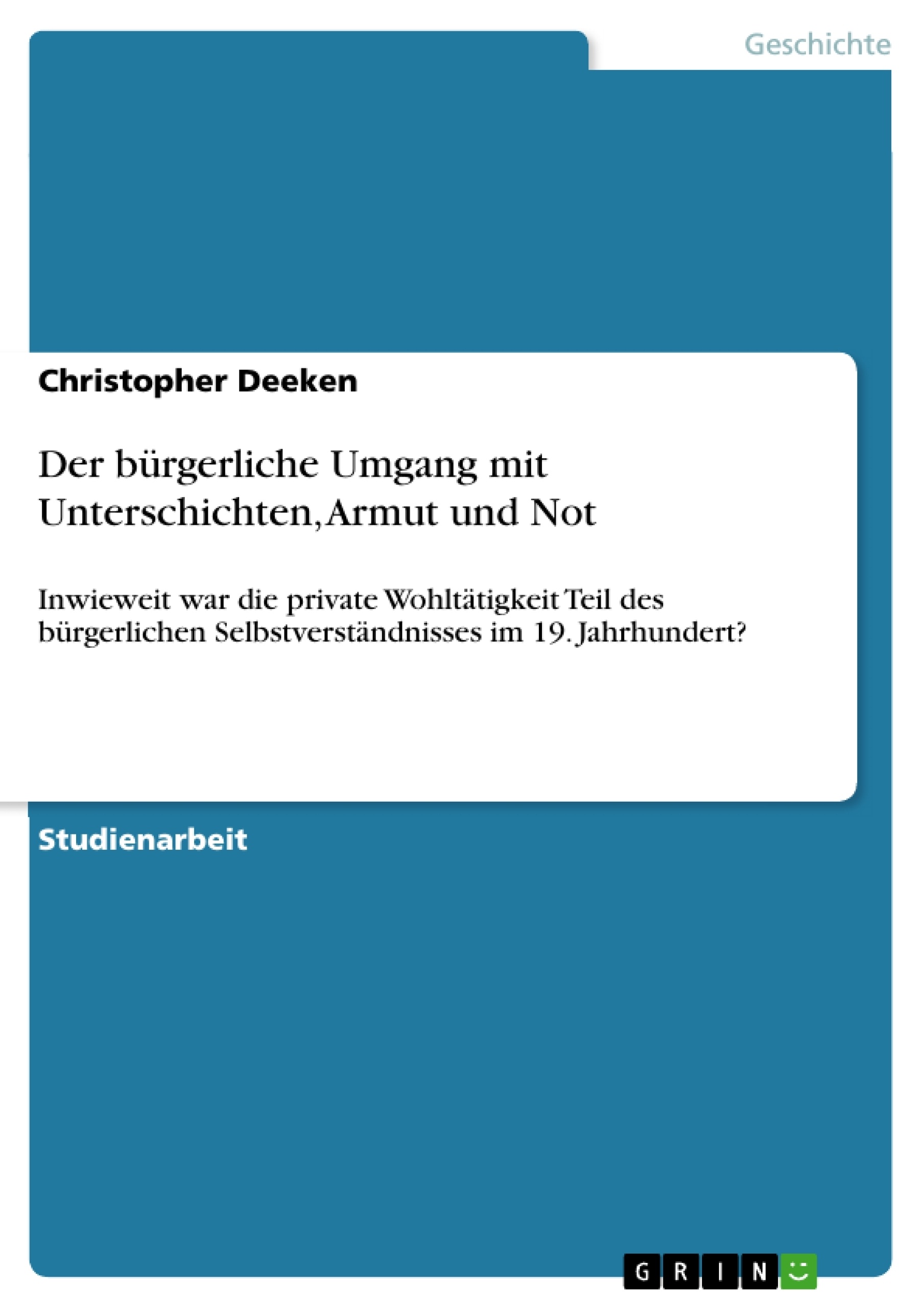Armut, Leid und Elend hat es in der Geschichte der Menschheit schon immer gegeben. Auch in der heutigen Zeit nimmt beispielsweise die Zahl der armen Kinder und Jugendlichen in einem sehr bedenklichen Maße zu. Im Rahmen meiner hier vorliegenden Hausarbeit habe ich mich einem wichtigen Bereich des bürgerlichen Armenwesens aus dem 19. Jahrhundert genähert, der Privatwohltätigkeit. Dabei möchte ich untersuchen inwieweit sich die von mir aufgestellte These, dass der private, oft auch ehrenamtliche Umgang mit den gesellschaftlichen Armutsproblemen Teil ihres bürgerlichen Selbstverständnisses war, bestätigen lässt. Zur Annäherung an dieses Thema werde ich zu Beginn meiner Ausführungen zunächst grundlegendes über die Ausmaße, Gründe und die Folgen der Armut im Deutschland des 19. Jahrhunderts darlegen. Danach folgt eine Vorstellung des Vereins als das entscheidende Medium der privaten Wohltätigkeit, mit Nennung der Vor- und Nachteile dieser Institutionen. Im Anschluss daran werde ich den bürgerlichen Umgang in der Privatwohltätigkeit anhand von einigen praxisbezogenen Beispielen im Detail beleuchten. Dabei werde ich zunächst auf die Tradition des Stiftens eingehen, bevor ich mich weiteren Tätigkeitsfeldern wie der der Errichtung von Wanderarbeitsstätten oder Armenschulen widme, wobei auch die religiös motivierte Wohltätigkeit und kirchliche Armenpflege Thema meiner Darstellung sein wird. Um den Bezug zu meiner Ausgangsfrage zu halten, gehe ich im Zuge dieser Ausführungen auch auf die Motive des Handelns und die Kriterien der Bürger für ihre Hilfeleistung ein. Im Folgenden widme ich mich der Bedeutung der Frauen in der privaten Wohltätigkeit und zeige auf, wie sich weibliches ehrenamtliches Engagement genau darstellte und welche Motive hierfür ausschlaggebend waren. Zum Ende meiner Ausführungen werde ich nach einem kurzen Ausblick über die weitere Entwicklung der Privatwohltätigkeit in einem Fazit versuchen, ein abschließendes Resumee bezüglich meiner zu Beginn aufgestellten These zu ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2.Hauptteil
- 2.1. Die Ausgangslage: Die Ausmaße der Armut im Deutschland des 19. Jahrhunderts, die Gründe und die Folgen
- 2.2. Der Verein als das Medium der privaten Wohltätigkeit:
- 2.3. Der bürgerliche Umgang mit Armut in Form von Privatwohltätigkeit
- 2.3.1.Das Stiftungswesen.
- 2.3.2. Motive des Stiftens.
- 2.3.3.Weitere Formen bürgerlichen Umgangs mit Armut (Armenschulen, Kinderbewahranstalten, Wanderarbeitsstätten):...
- 2.3.4. Religiös motivierte Privatwohltätigkeit und kirchliche Armenpflege:
- 2.4. Die Bedeutung der Frauen in der privaten Wohltätigkeit:
- 2.5. Ein Ausblick.
- 3. Schluss/ Fazit
- 4. Literaturverzeichnis........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit die private Wohltätigkeit im 19. Jahrhundert Teil des bürgerlichen Selbstverständnisses war. Sie untersucht die Ausmaße der Armut im Deutschland des 19. Jahrhunderts und die Gründe dafür, sowie die Rolle des Vereins als Medium der privaten Wohltätigkeit. Dabei werden verschiedene Formen der bürgerlichen Hilfeleistung, wie das Stiftungswesen und die Errichtung von Armenschulen und Wanderarbeitsstätten, beleuchtet.
- Die Ausmaße der Armut im 19. Jahrhundert
- Der Verein als Medium der privaten Wohltätigkeit
- Formen der bürgerlichen Hilfeleistung
- Motive der privaten Wohltätigkeit
- Die Rolle der Frauen in der privaten Wohltätigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen grundlegenden Überblick über die Thematik der privaten Wohltätigkeit im 19. Jahrhundert und stellt die Forschungsfrage nach dem Selbstverständnis des bürgerlichen Umgangs mit Armut. Der Hauptteil beginnt mit einer Darstellung der Ausgangslage, indem er die Ursachen und Folgen der Armut im Deutschland des 19. Jahrhunderts beleuchtet. Anschliessend wird der Verein als Instrument der privaten Wohltätigkeit vorgestellt und in seinen Vor- und Nachteilen analysiert.
Weiterhin wird der bürgerliche Umgang mit Armut in Form von Privatwohltätigkeit anhand von Beispielen wie dem Stiftungswesen, der Errichtung von Armenschulen und Wanderarbeitsstätten sowie der religiös motivierten Wohltätigkeit und kirchlichen Armenpflege näher beleuchtet. Die Motive des Handelns und die Kriterien für die Hilfeleistung werden dabei ebenfalls berücksichtigt.
Schliesslich widmet sich die Arbeit der Bedeutung der Frauen in der privaten Wohltätigkeit und deren spezifischen Motivationsfaktoren. Der Ausblick gibt einen kurzen Einblick in die weitere Entwicklung der Privatwohltätigkeit. Das Fazit zieht ein abschließendes Resumee bezüglich der Forschungsfrage.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Privatwohltätigkeit, bürgerliches Selbstverständnis, Armut, Deutschland 19. Jahrhundert, Verein, Stiftungswesen, Armenschulen, Wanderarbeitsstätten, religiöse Wohltätigkeit, kirchliche Armenpflege, Frauenrolle.
- Quote paper
- Christopher Deeken (Author), 2007, Der bürgerliche Umgang mit Unterschichten, Armut und Not, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132212