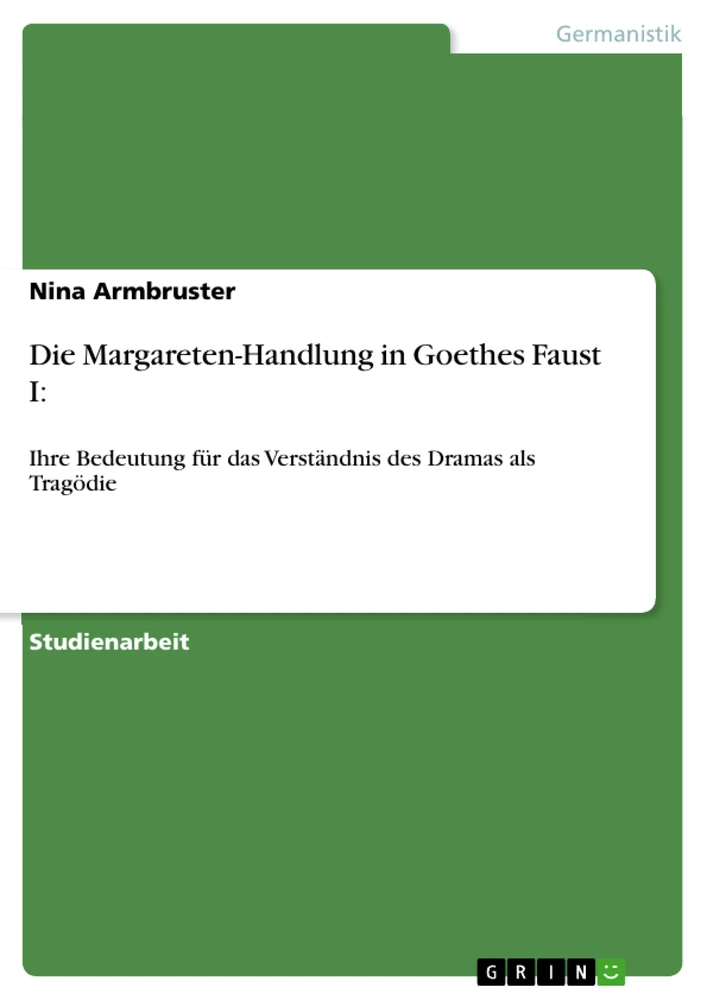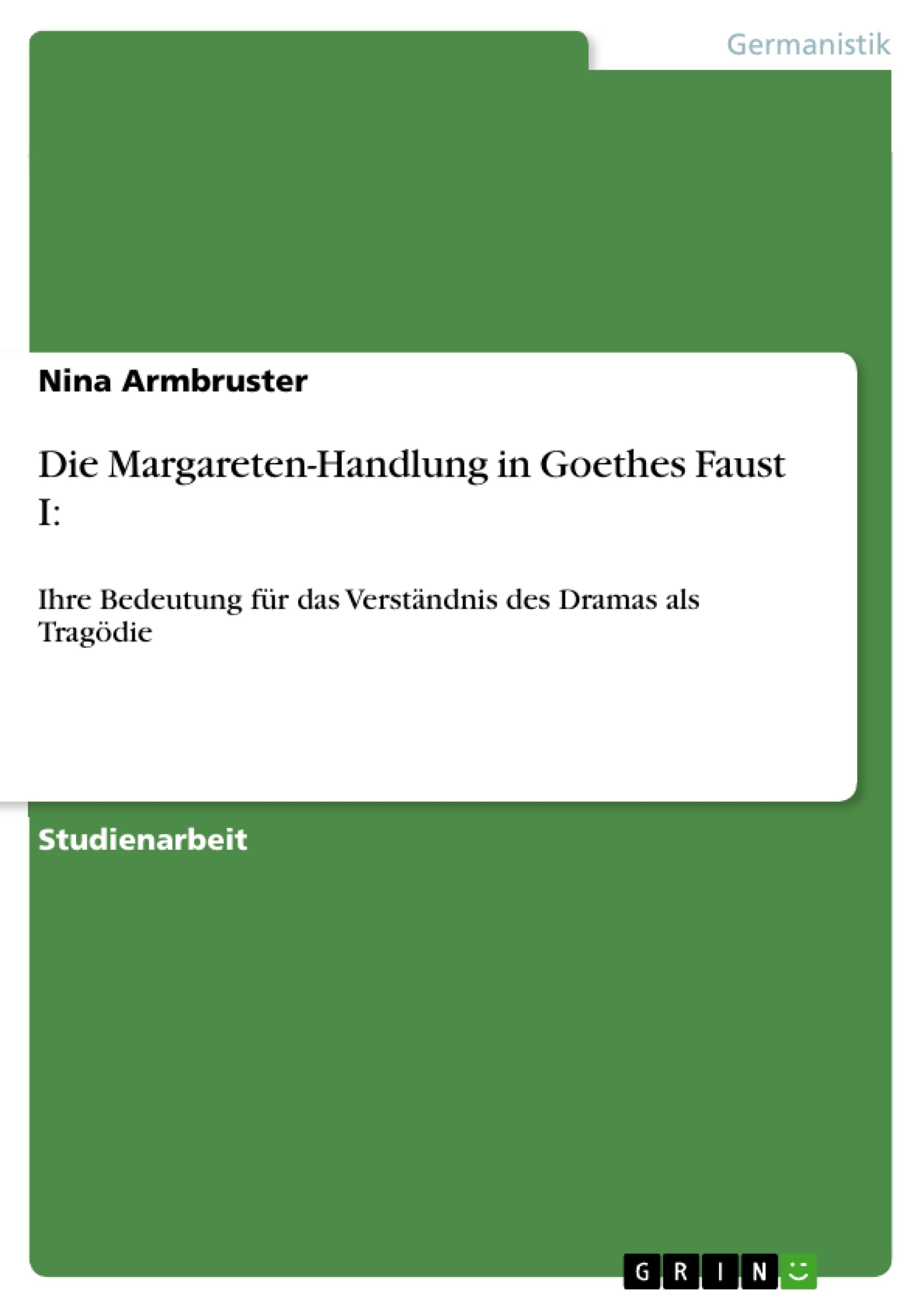In der vorliegenden Arbeit soll die Margareten-Handlung in Faust I untersucht werden und dabei ihre Rolle für das Verständnis des Dramas als Tragödie aufgezeigt werden. Wie die Figur des Fausts hat auch Margarete eine historische Vorlage. Hintergrund der Margareten-Tragödie war die öffentliche Exekution der Kindsmörderin Susanna Margareta Brandt 1772 in Frankfurt. Goethe verfolgte den Prozess und war vermutlich auch bei der Enthauptung dabei. Das Schicksal Margareta Brandts, welche auch namensgebend für Goethes weibliche Hauptfigur war, scheint Goethe somit ganz klar zur Margareten-Tragödie in Faust I inspiriert zu haben.
Im Folgenden werde ich diese anhand verschiedener Aspekte erläutern, um zu klären, inwiefern man von Margarete als eine tragische Figur sprechen kann. Dabei soll zunächst die Bedeutung des Prologs im Himmel für die Margareten-Tragödie untersucht werden. Im Anschluss daran soll auf die unterschiedlichen Namen der weiblichen Hauptfigur eingegangen werden: Es soll erörtert werden, ob die Tatsache, dass sie von ihren Mitfiguren und – das ist das eigentlich Interessante – in den Regieanweisungen unterschiedlich benannt wird, für eine Dopplung oder gar Spaltung ihrer Persönlichkeit steht. Des weiteren soll mit Hilfe der Betrachtung der Margareten-Handlung und der Lieder innerhalb des Dramas untersucht werden, ob Margarete determiniert ist (was Tragik ja ausschließen würde) oder ob sie ein freies, autonomes Subjekt ist, und somit die Bedingung für ihre Schuldfähigkeit und damit für die Tragödie gegeben sind: Insbesondere die Betrachtung der finalen Kerkerszene soll in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedingungen für Tragik in der klassischen Tragödie
- Der Prolog im Himmel als Voraussetzung für die Margareten-Tragödie
- Die Margareten-Handlung
- Margarete / Gretchen - Spaltung der Person?
- Ist Margarete determiniert oder ist sie ein Subjekt? Untersuchung der Margareten-Handlung und der Lieder
- Die Kerkerszene: die Tragik der Margareten-Handlung in ihrer Funktion für die Faust-Handlung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Margareten-Handlung in Goethes Faust I und analysiert ihre Rolle für das Verständnis des Dramas als Tragödie. Dabei wird die Frage untersucht, ob Margarete als tragische Figur verstanden werden kann.
- Die Bedeutung des Prologs im Himmel für die Margareten-Tragödie
- Die unterschiedlichen Namen der weiblichen Hauptfigur (Margarete/Gretchen) und ihre möglichen Bedeutungen
- Die Frage nach der Determiniertheit oder Autonomie Margaretes und die Rolle ihrer Lieder in der Handlung
- Die Kerkerszene als Höhepunkt der Tragik der Margareten-Handlung und ihre Bedeutung für die gesamte Handlung
- Die Anwendung der klassischen Tragödientheorie auf die Margareten-Handlung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext und die Entstehungsgeschichte von Goethes Faust dar, wobei der Fokus auf der Margareten-Handlung und ihrem historischen Hintergrund liegt. Kapitel 2 beleuchtet die Bedingungen für Tragik in der klassischen Tragödie, basierend auf Aristoteles' Poetik. Kapitel 3 analysiert den Prolog im Himmel und seine Bedeutung für die Margareten-Tragödie. Kapitel 4 befasst sich mit der Analyse der Margareten-Handlung und untersucht die Frage nach der Spaltung ihrer Persönlichkeit, ihrer Determiniertheit und ihrer Rolle als tragische Figur.
Schlüsselwörter
Goethe, Faust, Tragödie, Margareten-Handlung, Gretchen, Determinismus, Autonomie, Prolog im Himmel, klassische Tragödientheorie, Aristoteles, Poetik, Kerkerszene, Schuld, Tragische Figur.
- Citation du texte
- Nina Armbruster (Auteur), 2007, Die Margareten-Handlung in Goethes Faust I:, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132164