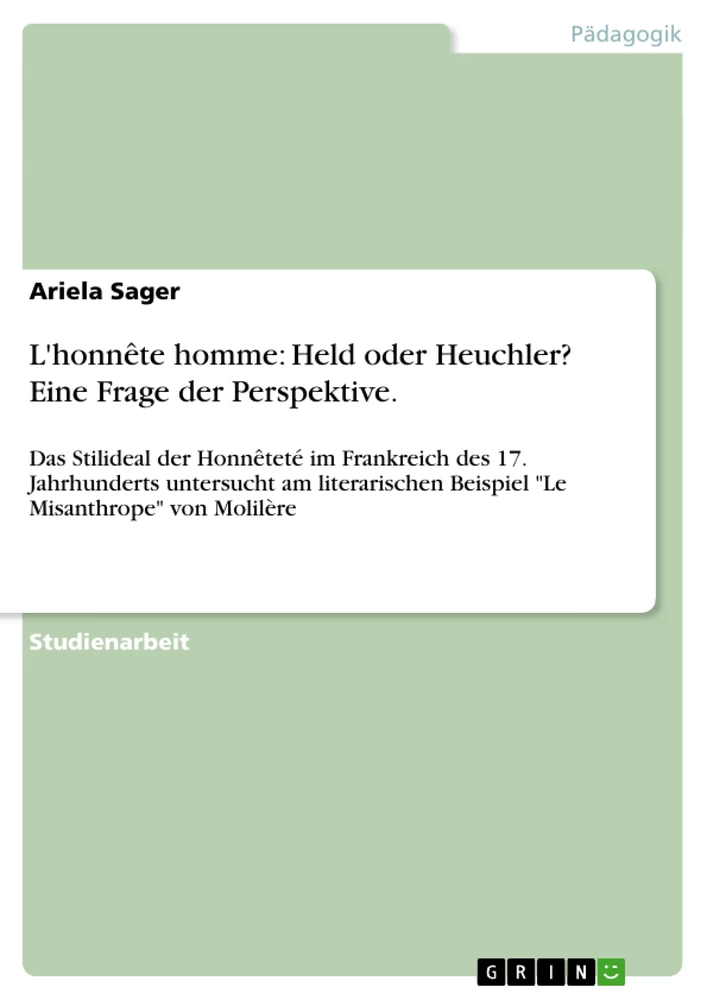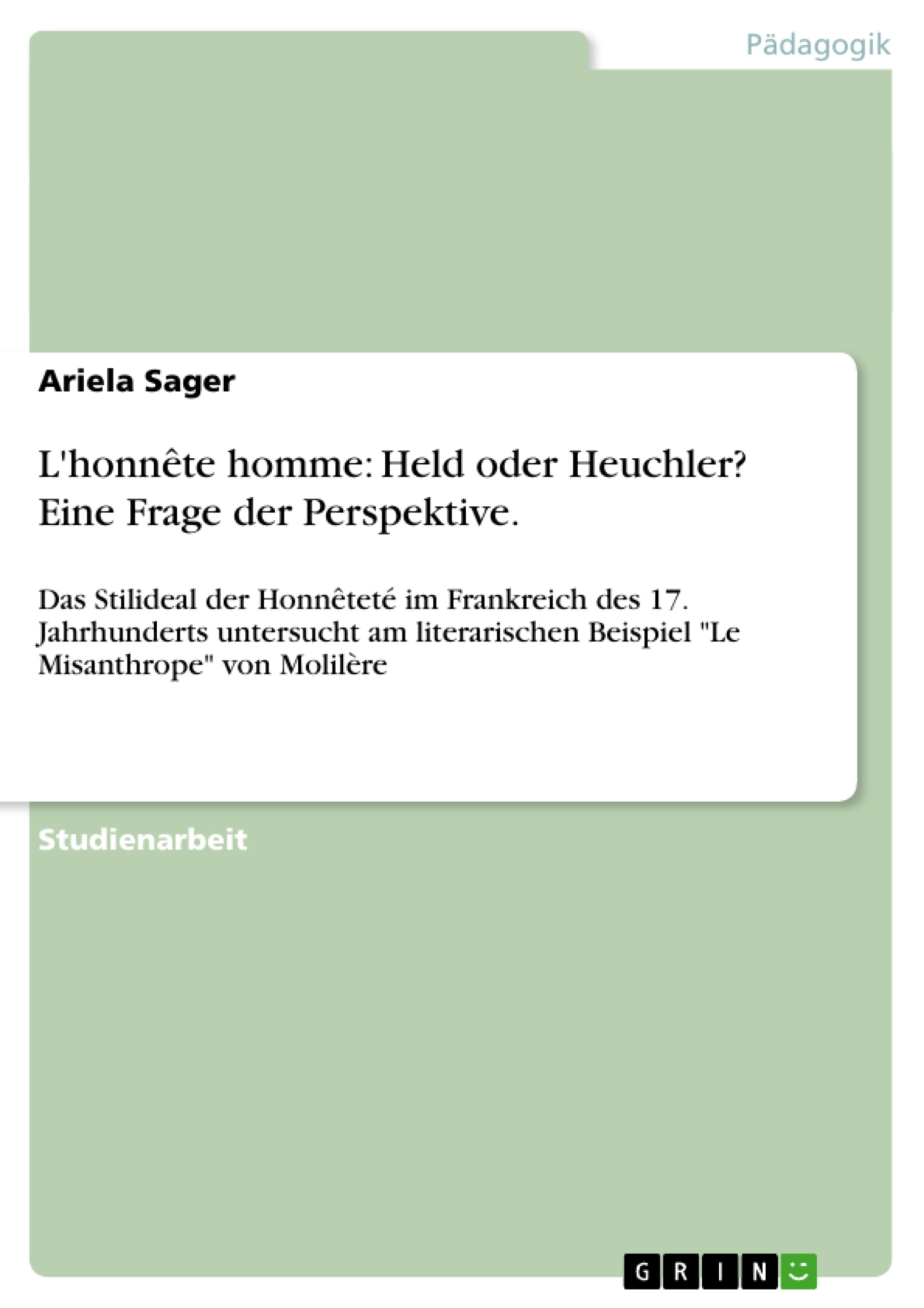Als Gott einsehen muss, dass die Menschen, die er erschaffen hat, "völlig verdorben" sind (Mos/Gen 6,5), entschließt er sich, eben diese Menschen wieder vom Antlitz der Erde zu tilgen. Nach vollbrachter Sintflut sieht Gott aber ein, dass er mit der Vernichtung des Lebens die Schlechtigkeit des Menschengeschlechts trotzdem nicht ausräumen konnte. "Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken udn Planen ist nun einmal böse von Jugend auf" (Mos/Gen 8,21), resigniert Gott Noah gegenüber. Er verspricht Noah trotzdem, "die Erde nicht noch einmal [zu]bestrafen" (Mos/Gen 8,21). In seinem Friedensbund mit den Menschen findet Gott sich mit ihrer Fehlbarkeit, ihren Schwächen, ihrer Schlechtigkeit ab - und liebt sie trotzdem.
Im 17. Jahrhundert, zur Zeit des Sonnenkönigs aber erhebt sich ein junger Mann in den Gedanken des Dichters Molière und empört sich wie einst der ratlose Gott der Bibel, dass überall nur "lâche flatterie / qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie" (Molière) herrsche. Er findet sich nicht mit der Schlechtigkeit der Menschen ab. Sie versetzt ihn so in Wut, dass auch er von dem Wunsch beherrscht wird, "de rompre en visière à tout le genre humain" (Molière).
Und gottgleich nimmt dieser junge Mann, der Dichter nennt ihn Alceste, für sich in Anspruch, nicht nur die "vice du temps" (Molière) zu verurteilen, den "vieux âges" (Molière) den Vorzug zu geben, einem Gott gleich urteilt er auch über den "goût du siècle" (Molière), dem er seinen eigenen als allein gültig, weil überlegen, gegenüber stellt. Sein Absolutheitsanspruch lässt ihn am Zeitgeist verzweifeln, das Moderate der zeitgenössischen 'Honnêteté' ist ihm fremd, ja zuwider. Von der 'bienséance', die das Zusammenleben der Menschen angenehm gestalten soll, hält er nichts. Auch wenn sein Gegenspieler Philinte feststellen muss, dass seine Auffassung von einem ehrenvollen Verhalten "aux mortels trop de perfection" (Molière) abverlangt, beharrt Alceste darauf, "qu'on soit sincère, et qu'en homme d'honneur,/ On ne lâche aucun mot qui ne parte du coeur" (Molière), auch wenn er seine Mitmenschen damit verletzen mag. "Tut nichts", möchte man ihn wie einen christlichen Patriarchen rufen hören, die Ehrlichkeit währt doch am längsten udn man wird sehen, ob sie über die Heuchelei triumphiert. Ob ein 'homme d'honneur' vergangener Zeiten besser ist al ein 'honnête homme' moderner Zeit, wird für ihn zur zentralen Frage, die sich am Ausgang seines Gerichtsprozesses entscheidet...
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Honnêteté
- 2.1 Angestrebt doch unerreicht
- 2.2 Vor Gott und den Menschen angenehm
- 2.3 Nach Keulen und Duellen, Auftakt der Kultur?
- 3 Hintergrund
- 3.1 Le grand siècle
- 3.2 << l'État c'est moi >>
- 4 ,,L'honnête homme": Held oder Heuchler
- 4.1 Die Scheinheiligkeit
- 4.2 Die Ehrenhaftigkeit
- 4.3 Ça dépend: Es kommt drauf an
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Ideal der Honnêteté im Frankreich des 17. Jahrhunderts anhand von Molières „Le Misanthrope“. Die Arbeit analysiert die Widersprüche und Herausforderungen dieses Ideals, indem sie Alcestes Misanthropie als Gegenpol zur gesellschaftlichen Konvention der Höflichkeit und des angepassten Verhaltens betrachtet. Die Arbeit beleuchtet, wie dieses Ideal sowohl erstrebenswert als auch unerreichbar erscheint.
- Das Ideal der Honnêteté und seine Definition
- Die Darstellung der Honnêteté in Molières „Le Misanthrope“
- Alceste als Kritik an der gesellschaftlichen Scheinheiligkeit
- Der Konflikt zwischen individueller Ehrlichkeit und sozialer Anpassung
- Die Frage nach dem wahren Helden und der Bedeutung von „plaire“
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt einen Vergleich zwischen der göttlichen Resignation gegenüber der menschlichen Schlechtigkeit in der Bibel und Alcestes Empörung über die „lâche flatterie“ und „injustice“ seiner Zeit her. Alceste, Molières Figur, lehnt die gesellschaftliche Konvention der Honnêteté ab und strebt nach absoluter Ehrlichkeit, ungeachtet der sozialen Konsequenzen. Die Einleitung etabliert somit den zentralen Konflikt zwischen dem Ideal der Honnêteté und der individuellen Moral, der im Laufe der Arbeit weiter untersucht wird.
2 Die Honnêteté: Dieses Kapitel untersucht das Ideal der Honnêteté, beginnend mit der Feststellung seiner Unerreichbarkeit. Es analysiert Nicolas Farets Werk „L'honnête homme ou l'art de plaire à la cour“, welches ein Idealbild des „honnête homme“ als edlen, gebildeten und höfischen Mann beschreibt, das in der Realität jedoch schwer zu erreichen ist. Der Abschnitt „Vor Gott und den Menschen angenehm“ beleuchtet den Versuch, dieses Ideal in Einklang mit religiösen und gesellschaftlichen Erwartungen zu bringen, wobei die Gunst des Königs im Zentrum steht. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der gesellschaftlichen Normen, die Alceste in Frage stellt.
Schlüsselwörter
Honnêteté, Le Misanthrope, Molière, Alceste, Philinte, 17. Jahrhundert, Frankreich, Scheinheiligkeit, Ehrlichkeit, Höflichkeit, Soziales Verhalten, Bildungsideal, „plaire“, „l'État c'est moi“, Le grand siècle.
Häufig gestellte Fragen zu "Die Honnêteté in Molières Le Misanthrope"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert das Ideal der Honnêteté im Frankreich des 17. Jahrhunderts, insbesondere anhand von Molières "Le Misanthrope". Sie untersucht die Widersprüche und Herausforderungen dieses Ideals und betrachtet Alcestes Misanthropie als Gegenpol zur gesellschaftlichen Konvention der Höflichkeit und des angepassten Verhaltens.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Definition und Darstellung der Honnêteté, Alceste als Kritik an gesellschaftlicher Scheinheiligkeit, den Konflikt zwischen individueller Ehrlichkeit und sozialer Anpassung, und die Frage nach dem wahren Helden und der Bedeutung von „plaire“ (gefallen).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel über die Honnêteté (inklusive Unterkapitel zu ihrer Erreichbarkeit, ihrer religiösen und gesellschaftlichen Aspekte und ihrer Rolle im Kontext von Gewalt und Kultur), ein Kapitel zum historischen Hintergrund (Le grand siècle und "l'État c'est moi"), ein Kapitel über Alceste als Held oder Heuchler (mit Unterkapiteln zu Scheinheiligkeit, Ehrenhaftigkeit und der Ambivalenz des Ideals), sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Das Ideal der Honnêteté im 17. Jahrhundert Frankreich erscheint sowohl erstrebenswert als auch unerreichbar. Molières "Le Misanthrope" und die Figur des Alceste verdeutlichen diesen Widerspruch zwischen individueller Moral und gesellschaftlicher Konvention.
Welche Rolle spielt Alceste?
Alceste dient als zentrale Figur zur Kritik an der gesellschaftlichen Scheinheiligkeit und der Konvention der Honnêteté. Seine Misanthropie repräsentiert den Konflikt zwischen absoluter Ehrlichkeit und der Notwendigkeit sozialer Anpassung.
Was ist die Honnêteté?
Die Honnêteté ist ein Ideal des 17. Jahrhunderts Frankreichs, das einen edlen, gebildeten und höfischen Mann beschreibt. Die Arbeit zeigt jedoch, dass dieses Ideal schwer zu erreichen und oft mit Scheinheiligkeit verbunden war.
Welche Bedeutung hat der historische Kontext?
Der historische Kontext des "grand siècle" und Ludwig XIV's Maxime "l'État c'est moi" wird beleuchtet, um das Verständnis des gesellschaftlichen Drucks und der Erwartungen, die auf das Ideal der Honnêteté einwirken, zu ermöglichen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen Honnêteté, Le Misanthrope, Molière, Alceste, Philinte, 17. Jahrhundert, Frankreich, Scheinheiligkeit, Ehrlichkeit, Höflichkeit, Soziales Verhalten, Bildungsideal, „plaire“, „l'État c'est moi“, und Le grand siècle.
- Quote paper
- Ariela Sager (Author), 2006, L'honnête homme: Held oder Heuchler? Eine Frage der Perspektive., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132132