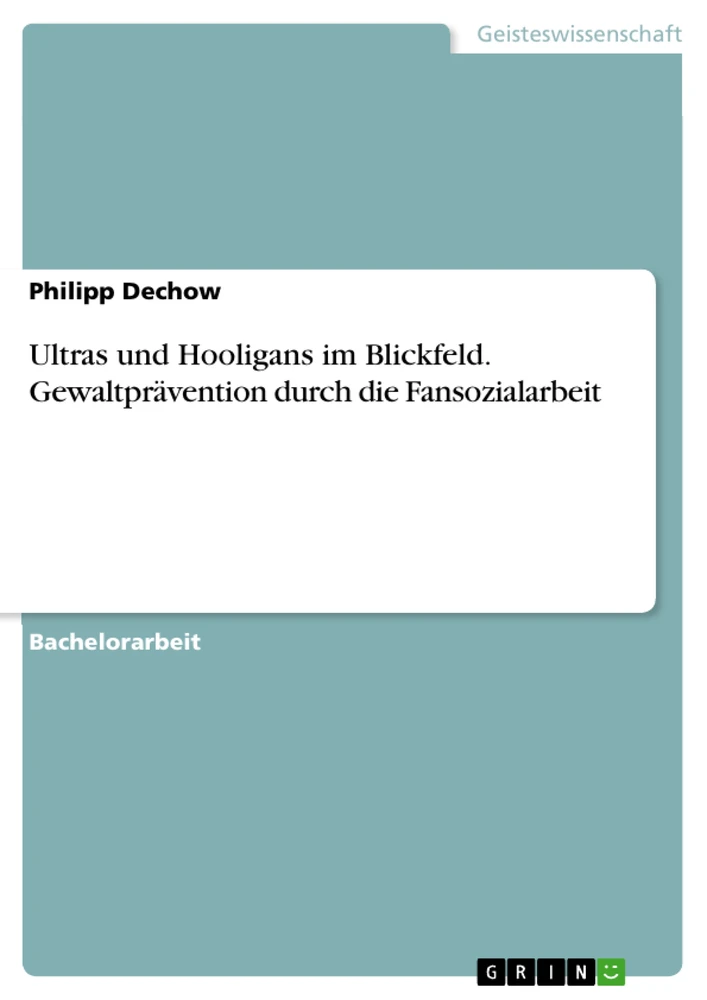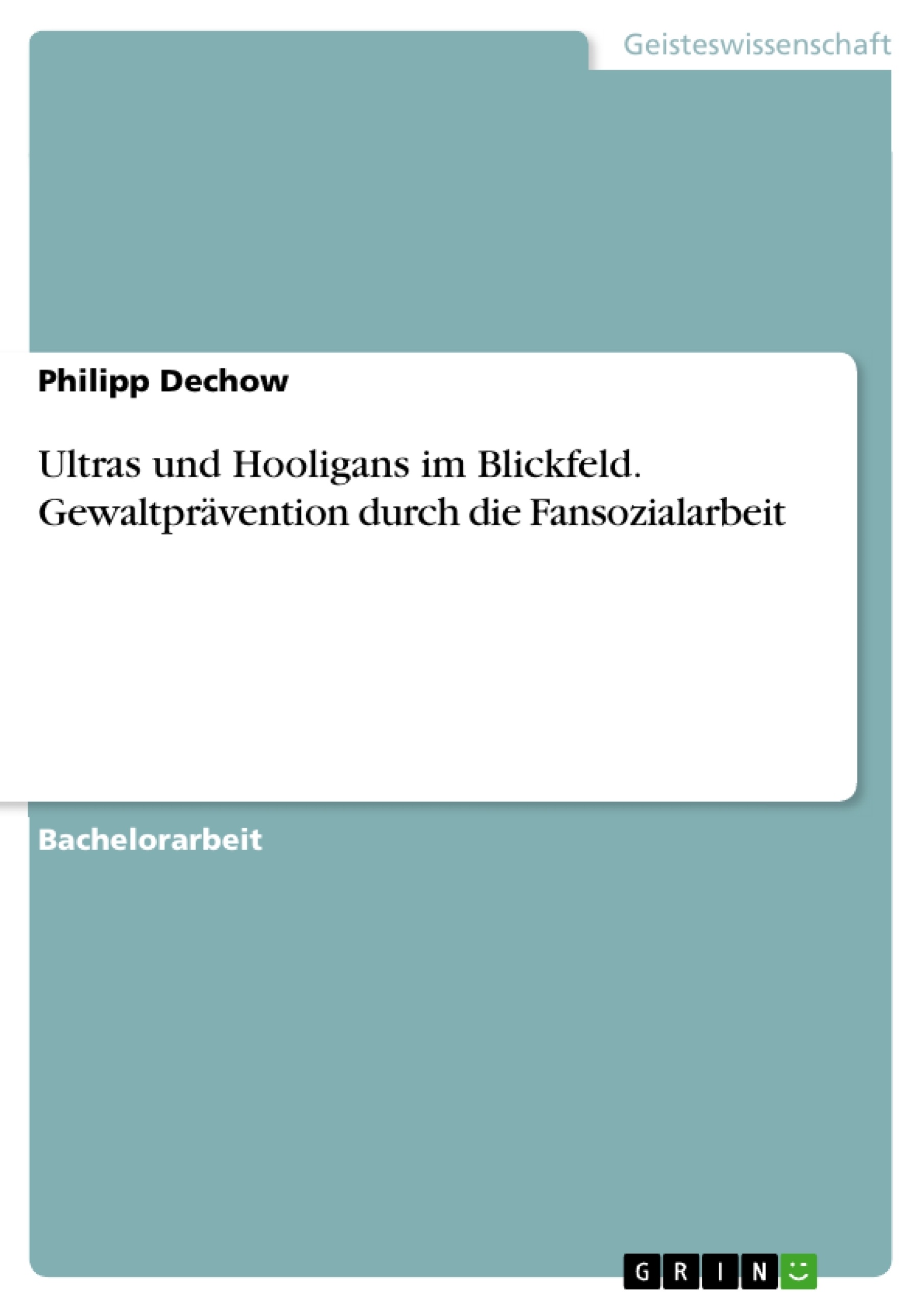In der vorliegenden Arbeit möchte ich anhand verschiedener Literatur und Studien herausarbeiten, warum Hooligans und gewaltbereite Ultras Gewalt ausüben. Ebenso sollen die Maßnahmen zur Vermeidung von Gewalt und die Prävention der jeweiligen Akteure im Fußball erläutert und bewertet werden. Daraus ergibt sich die folgende Forschungsfrage: Was treibt die Subkulturen der Hooligans und der Ultras zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und wie wird versucht durch verschiedene Akteure ihr entgegenzuwirken?
Diese Fragestellung wird mit folgender Struktur behandelt. Eingangs werden die verschiedenen Klassifizierungen der Stadionbesuchenden dargestellt. Hieran schließt sich die nähere Betrachtung der verschiedenen Subkulturen im Fußball. Ultras, Hooltras und Hooligans werden in ihrer Entwicklung und Definition vorgestellt. Darauffolgend werden im dritten Kapitel, die Gewalttheorien vorgestellt, die im Zusammenhang mit Hooliganismus von Bedeutung sind. Zuerst werden die Erklärungsansätze für die Gewalt des einzelnen Individuums skizziert. Gewalttheoretische Ursachen finden sich sowohl in biologisch-evolutionären, als auch in sozial-psychologischen Begründungen. Hooliganismus findet zwar durch den Einzelnen statt, wird jedoch in der Regel durch Gruppen verübt. Welche gruppenbezogenen Erklärungsansätze Gewalt im Fußball begünstigen, wird anschließend im Kapitel 3.2 dargestellt.
Anhand des Forschungsprojektes „Hooliganismus in Deutschland: Ursachen, Entwicklung, Prävention und Intervention“ von Lösel et al. (2000) und der Studie „Wandlungen des Zuschauerverhaltens im Profifußball“ von Pilz et al. (2006) werden die handelnden Gewalttäter:innen der Subkulturen nach Sozialisation und Motivation näher betrachtet. Im fünften Kapitel wird ein politischer und medialer Exkurs zu beiden Subkulturen umrissen. Aufbauend darauf werden der Berliner Fußballclub Dynamo e.V. und die „HoGeSa“ als Fallbeispiele einer rechtsextremen Hooliganszene vorgestellt. Schließlich wird betrachtet, welche Rolle die Polizei bei der Thematik Hooliganismus einnimmt. Im sechsten Kapitel werden die wichtigsten nationalen Präventionsangebote und Maßnahmen gegen Gewalt im Kontext Fußball dargelegt. Der Fokus liegt hier insbesondere auf der sozialen, sowie polizeilichen Arbeit und deren Handlungsmöglichkeiten. Abschließend werden die Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsfrage im Fazit kritisch diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Fußballfan
- 2.1 Kategorisierungen von Fußballzuschauer:innen
- 2.2 Subkultur Fußballfan
- 3. Gewalt
- 3.1 Gewalttheorien des Individuums
- 3.2 Kollektive Gewalttheorien
- 4. Gewaltakteure im Fußball
- 4.1 Motivation von Gewalt
- 5. Ultras, Hooligans und Politik
- 6. Nationale Präventionsangebote und Maßnahmen gegen Gewalt im Fußball
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen von Gewalt im Fußball, insbesondere im Kontext der Subkulturen von Hooligans und Ultras. Ziel ist es, die Motivationen für gewalttätige Auseinandersetzungen dieser Gruppen zu analysieren und die präventiven Maßnahmen verschiedener Akteure zu beleuchten. Die Forschungsfrage lautet: Was treibt die Subkulturen der Hooligans und der Ultras zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und wie wird versucht durch verschiedene Akteure ihr entgegenzuwirken?
- Kategorisierung und Charakterisierung von Fußballfans
- Gewalttheorien im Kontext von Fußballgewalt
- Motivationen gewalttätiger Hooligans und Ultras
- Präventionsmaßnahmen und deren Wirksamkeit
- Der Einfluss von Politik auf das Phänomen Hooliganismus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext von Fußballgewalt dar und verweist auf ein konkretes Beispiel von Ausschreitungen in Berlin. Sie betont, dass Gewalt ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, das auch den Fußball betrifft, und nicht umgekehrt. Die Arbeit wird als Untersuchung der Ursachen von Gewalt durch Hooligans und Ultras sowie der präventiven Maßnahmen positioniert, mit dem Fokus auf der Forschungsfrage nach den treibenden Kräften hinter der Gewalt und den Gegenmaßnahmen.
2. Der Fußballfan: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Arten von Fußballzuschauern und untersucht die Subkultur der Fußballfans. Es differenziert zwischen verschiedenen Gruppen und beleuchtet deren Zusammengehörigkeitsgefühl und Identitätsbildung, die eine wichtige Rolle in der Entstehung von Gruppendynamiken spielen und somit auch im Zusammenhang mit Gewalt relevant sind.
3. Gewalt: Hier werden verschiedene Gewalttheorien, sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene, präsentiert. Der Abschnitt analysiert verschiedene Ansätze und Erklärungsmodelle für gewalttätiges Verhalten, um ein breites Verständnis für die Ursachen von Gewalt zu schaffen und diese im Kontext von Fußballgewalt anzuwenden.
4. Gewaltakteure im Fußball: Dieses Kapitel analysiert die Akteure, die an Fußballgewalt beteiligt sind und die Motivationen hinter deren gewalttätigem Handeln. Die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Akteuren und deren Motivationen werden analysiert und die verschiedenen Perspektiven werden gegenübergestellt.
5. Ultras, Hooligans und Politik: Dieser Abschnitt beleuchtet den Einfluss der Politik auf die Phänomene Hooliganismus und Ultra-Szene. Es wird die Interaktion zwischen diesen Subkulturen und politischen Maßnahmen sowie deren Wirkung auf die Gewaltprävention untersucht.
6. Nationale Präventionsangebote und Maßnahmen gegen Gewalt im Fußball: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die in Deutschland bestehenden Strategien und Maßnahmen zur Gewaltprävention im Fußball. Die Wirksamkeit und die Herausforderungen verschiedener Ansätze werden detailliert beschrieben und analysiert.
Schlüsselwörter
Hooliganismus, Ultras, Fußballgewalt, Gewaltprävention, Fansozialarbeit, Gewalttheorien, Subkultur, Kollektive Gewalt, Präventionsmaßnahmen, Polizeiarbeit, Gruppenidentität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gewalt im Fußball: Hooligans, Ultras und Präventionsmaßnahmen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Ursachen von Gewalt im Fußball, insbesondere im Kontext der Subkulturen von Hooligans und Ultras. Sie analysiert die Motivationen für gewalttätige Auseinandersetzungen dieser Gruppen und beleuchtet präventive Maßnahmen verschiedener Akteure. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Was treibt die Subkulturen der Hooligans und der Ultras zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und wie wird versucht, dem entgegenzuwirken?
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themenschwerpunkte: Kategorisierung und Charakterisierung von Fußballfans, Gewalttheorien im Kontext von Fußballgewalt, Motivationen gewalttätiger Hooligans und Ultras, Präventionsmaßnahmen und deren Wirksamkeit, sowie der Einfluss von Politik auf das Phänomen Hooliganismus.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Der Fußballfan (inkl. Kategorisierung von Zuschauern und der Subkultur Fußballfan), Gewalt (inkl. individueller und kollektiver Gewalttheorien), Gewaltakteure im Fußball (inkl. Motivationen für Gewalt), Ultras, Hooligans und Politik, Nationale Präventionsangebote und Maßnahmen gegen Gewalt im Fußball, und Fazit.
Welche Arten von Fußballfans werden unterschieden?
Das Kapitel "Der Fußballfan" beschreibt verschiedene Arten von Fußballzuschauern und untersucht die Subkultur der Fußballfans. Es differenziert zwischen verschiedenen Gruppen und beleuchtet deren Zusammengehörigkeitsgefühl und Identitätsbildung im Zusammenhang mit Gewalt.
Welche Gewalttheorien werden betrachtet?
Das Kapitel "Gewalt" präsentiert verschiedene Gewalttheorien, sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene. Es analysiert verschiedene Ansätze und Erklärungsmodelle für gewalttätiges Verhalten im Kontext von Fußballgewalt.
Wer sind die Gewaltakteure im Fußball?
Das Kapitel "Gewaltakteure im Fußball" analysiert die an Fußballgewalt beteiligten Akteure und deren Motivationen. Die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Akteuren und deren Motivationen werden analysiert und die verschiedenen Perspektiven gegenübergestellt.
Wie beeinflusst die Politik das Phänomen Hooliganismus?
Das Kapitel "Ultras, Hooligans und Politik" beleuchtet den Einfluss der Politik auf Hooliganismus und die Ultra-Szene. Es untersucht die Interaktion zwischen diesen Subkulturen und politischen Maßnahmen sowie deren Wirkung auf die Gewaltprävention.
Welche Präventionsmaßnahmen werden in Deutschland eingesetzt?
Das Kapitel "Nationale Präventionsangebote und Maßnahmen gegen Gewalt im Fußball" konzentriert sich auf deutsche Strategien und Maßnahmen zur Gewaltprävention im Fußball. Die Wirksamkeit und Herausforderungen verschiedener Ansätze werden detailliert beschrieben und analysiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hooliganismus, Ultras, Fußballgewalt, Gewaltprävention, Fansozialarbeit, Gewalttheorien, Subkultur, Kollektive Gewalt, Präventionsmaßnahmen, Polizeiarbeit, Gruppenidentität.
Wie wird die Einleitung gestaltet?
Die Einleitung stellt den Kontext von Fußballgewalt dar, verweist auf ein konkretes Beispiel von Ausschreitungen und betont, dass Gewalt ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, das auch den Fußball betrifft. Die Arbeit wird als Untersuchung der Ursachen von Gewalt durch Hooligans und Ultras sowie der präventiven Maßnahmen positioniert.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die zentralen Inhalte und Ergebnisse jedes Kapitels kurz beschreibt.
- Quote paper
- Philipp Dechow (Author), 2022, Ultras und Hooligans im Blickfeld. Gewaltprävention durch die Fansozialarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1319453