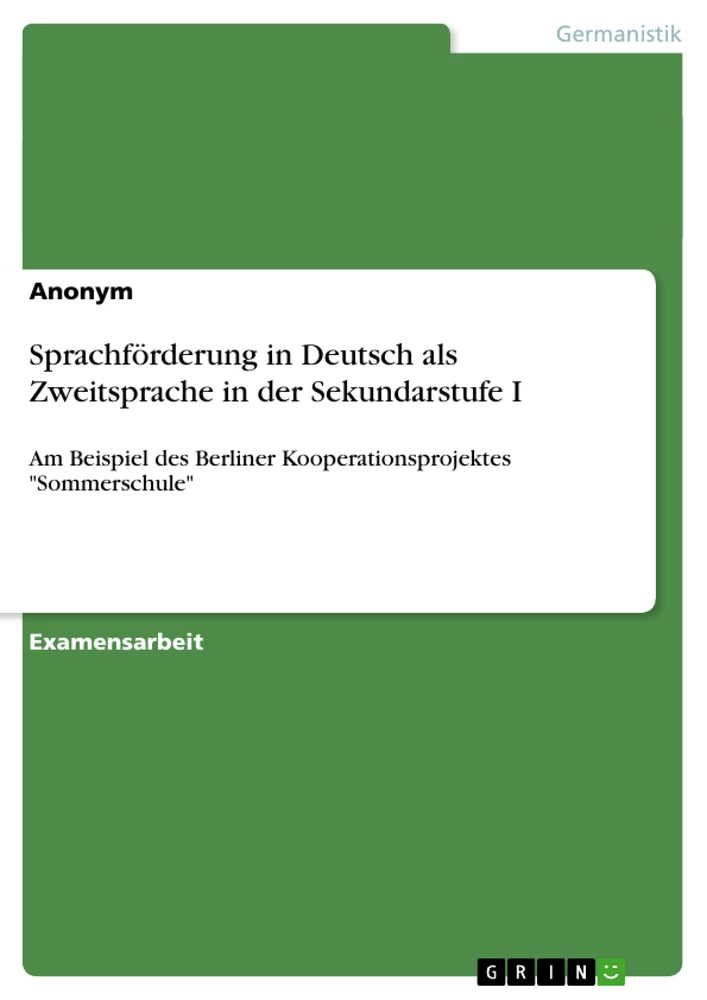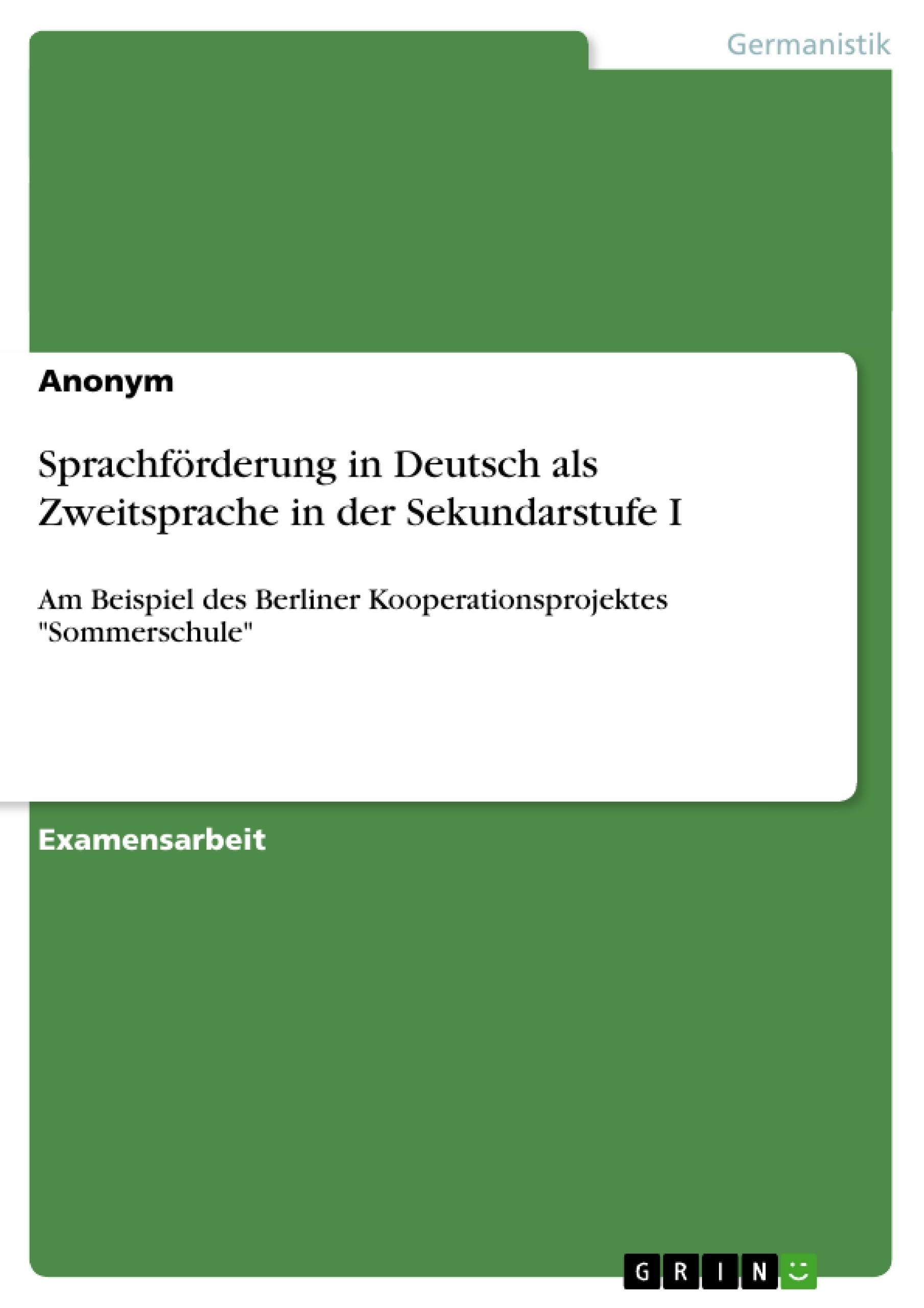Das Thema Bildung hat in Deutschland in den letzten Jahren - nicht zuletzt durch die alarmierenden Ergebnisse von Schulleistungsuntersuchungen wie PISA, IGLU oder TIMSS - zunehmend an öffentlicher Bedeutung gewonnen. Der dritte PISA-Bericht zeigt, dass die Leistungsunterschiede zwischen einheimischen und nicht-deutschstämmigen Schülern1 zwar relativ zurückgegangen, jedoch nach wie vor besonders deutlich sind. Laut PISA 3 liegen in der Bundesrepublik geborene Kinder von Einwanderern in der Lernleistung fast zweieinhalb Schuljahre hinter gleichaltrigen deutschstämmigen Mitschülern. In keinem anderen Industriestaat der Welt ist die Schulsituation für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund der so genannten zweiten und dritten Generation so problematisch wie in Deutschland.2 Angesichts dieser Probleme erscheint es umso notwendiger, entsprechende Maßnahmen in der Bildungspolitik zu veranlassen, welche die angesprochenen Leistungsunterschiede zwischen Heranwachsenden nicht-deutscher sowie deutscher Herkunft vermindern. Die wichtigste Schlüsselkompetenz für entsprechende Bildungserfolge der Schüler fällt dabei der Beherrschung der deutschen Sprache zu. Nur eine zureichende Kenntnis des Deutschen ermöglicht den Kindern und Jugendlichen nicht-deutscher Herkunftssprache die Chance auf eine berufliche Karriere und eine gesamtgesellschaftliche Teilhabe. Die unabdingbare Konsequenz dieser Erkenntnis ist demzufolge eine individuelle Sprachförderung sowohl im schulischen als auch außerschulischen Bereich langfristig zu etablieren. Dies setzt eine angemessene Berücksichtigung anerkannter Theorien aus der Spracherwerbsforschung bei der Entwicklung von Sprachförderprogrammen voraus. Einigkeit unter Experten herrscht insofern, dass hinsichtlich der nicht-muttersprachlichen Spracherwerbstypen zwischen Deutsch als Zweitsprache bzw. Fremdsprache unterschieden werden muss. Je nachdem, ob es sich um einen Fremdsprachenlerner, welcher die Sprache gesteuert außerhalb der Zielkultur erlernt oder einen Zweitsprachenlerner handelt, welcher die Sprache gesteuert sowie ungesteuert innerhalb der Zielkultur erwirbt, muss ein erfolgreicher Unterricht entsprechend angepasst und aufgearbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- MIGRATION UND BILDUNG IM ZUWANDERUNGSLAND DEUTSCHLAND
- Einwanderungsgeschichte Deutschlands (sechziger Jahre bis heute)
- Begriffklärung: Migrant und Mensch mit Migrationshintergrund
- Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Deutschland
- Bildungsstand der jungen Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Deutschland
- Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Berlin
- Bildungsstand der Schüler mit Migrationshintergrund
in der Sekundarstufe 1 in Berlin
- Gründe für das schulische Versagen Jugendlicher mit Migrationshintergrund
- Bildungsstand der Schüler mit Migrationshintergrund
in der Sekundarstufe 1 in Berlin
- BILDUNGSPOLITISCHE KONSEQUENZEN
- Schulsprachenpolitik - Umgang mit Zweisprachigkeit
- Empfehlungen der ständigen Kultusministerkonferenz
- Rahmenpläne für Deutsch als Zweitsprache
- Schulsprachenpolitik - Umgang mit Zweisprachigkeit
- DEUTSCH ALS ZWEITE SPRACHE UND DEREN ERWERB
- Begriffsklärung Deutsch als Zweitsprache
- Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Muttersprache
- Zweitspracherwerb
- Einflussfaktoren auf den Zweitspracherwerb
- Die Kontrastivhypothese
- Die Identitätshypothese
- Die Interlanguagehypothese
- Grundgrößen des Zweitspracherwerbs
- Einflussfaktoren auf den Zweitspracherwerb
- Begriffsklärung Deutsch als Zweitsprache
- SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE ZWEITSPRACHENDIDAKTIK
- Pädagogische Prinzipien
- Interkulturelles Lernen
- (Schrift-)sprachliche Mittel
- Korrekturverhalten
- Sprachstandserhebung
- MABNAHMEN ZUR SPRACHFÖRDERUNG IN DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE
- Überblick zu aktuellen Sprachförderprogrammen in Berlin
- Projekte zur Sprachförderung außerhalb der Unterrichtszeit
- Das Jacobs-Sommercamp Bremen 2004
- Das Sommercamp Nürnberg 2005
- Das Berliner Kooperationsprojekt „Sommerschule“
- Die Kooperationspartner
- Projekte zur Sprachförderung außerhalb der Unterrichtszeit
- Überblick zu aktuellen Sprachförderprogrammen in Berlin
- FAZIT UND AUSBLICK
- LITERATURLISTE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Sprachförderung in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in der Sekundarstufe I. Sie analysiert die Herausforderungen, die sich aus der Einwanderungssituation in Deutschland für die schulische Integration von Schülern mit Migrationshintergrund ergeben, und beleuchtet die Rolle der Sprachförderung in diesem Kontext. Die Arbeit untersucht die bildungspolitischen Rahmenbedingungen, die Bedeutung von DaZ-Theorien für die Unterrichtsgestaltung und stellt ein konkretes außerschulisches Sprachförderprojekt in Berlin vor.
- Die Bedeutung von Deutsch als Zweitsprache für die schulische Integration von Schülern mit Migrationshintergrund
- Die Herausforderungen des Zweitspracherwerbs und die Rolle von Sprachförderprogrammen
- Die bildungspolitischen Rahmenbedingungen für DaZ-Förderung in Deutschland
- Die Anwendung von DaZ-Theorien in der Praxis
- Die Analyse eines konkreten Sprachförderprojektes in Berlin
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit stellt die Relevanz des Themas Sprachförderung in Deutsch als Zweitsprache im Kontext der Einwanderungssituation in Deutschland dar. Sie beleuchtet die Bildungsdefizite von Schülern mit Migrationshintergrund und die Notwendigkeit einer gezielten Sprachförderung.
Kapitel 1 beleuchtet die Einwanderungsgeschichte Deutschlands und die Entwicklung der Bildungslandschaft im Kontext der Zuwanderung. Es werden wichtige Begriffe wie „Migrant“ und „Migrationshintergrund“ definiert und der Bildungsstand der jungen Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Deutschland und Berlin analysiert.
Kapitel 2 befasst sich mit den bildungspolitischen Konsequenzen der Einwanderungssituation. Es werden die Empfehlungen der ständigen Kultusministerkonferenz und die Rahmenpläne für Deutsch als Zweitsprache in verschiedenen Bundesländern vorgestellt.
Kapitel 3 widmet sich dem Begriff „Deutsch als Zweitsprache“ und unterscheidet ihn von „Deutsch als Fremdsprache“ und „Deutsch als Muttersprache“. Es werden wichtige Theorien zum Zweitspracherwerb beleuchtet, wie die Kontrastivhypothese, die Identitätshypothese und die Interlanguagehypothese.
Kapitel 4 leitet aus den Erkenntnissen der Zweitspracherwerbstheorien Konsequenzen für die Zweitsprachendidaktik ab. Es werden pädagogische Prinzipien für den DaZ-Unterricht, die Bedeutung des interkulturellen Lernens, die Verwendung von sprachlichen Mitteln und die Bedeutung von Korrekturverhalten und Sprachstandserhebung diskutiert.
Kapitel 5 stellt das Berliner Kooperationsprojekt „Sommerschule“ vor, ein außerschulisches Sprachförderprogramm für Schüler mit Migrationshintergrund. Es werden das konzeptionelle Hintergrund, das Sprachförderkonzept, die Umsetzung des Konzeptes und die Auswertung des Projektes beschrieben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Deutsch als Zweitsprache, Sprachförderung, Migrationshintergrund, schulische Integration, Zweitspracherwerb, Bildungsdefizite, bildungspolitische Rahmenbedingungen, DaZ-Theorien, Sprachförderprogramme, außerschulische Sprachförderung, Berliner Kooperationsprojekt „Sommerschule“.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2008, Sprachförderung in Deutsch als Zweitsprache in der Sekundarstufe I, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131869