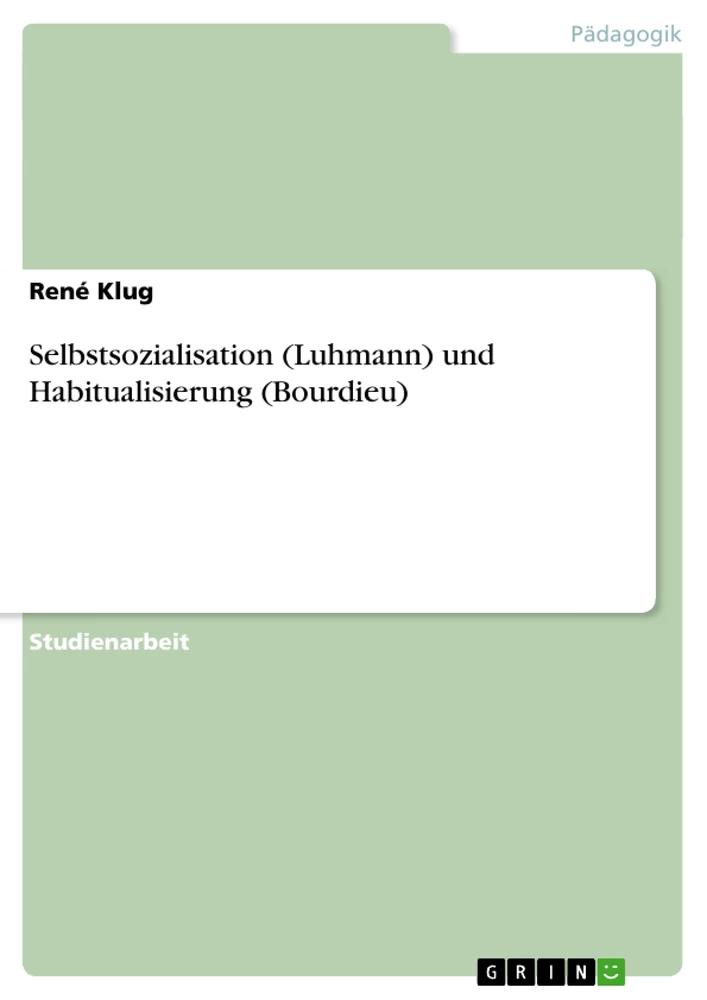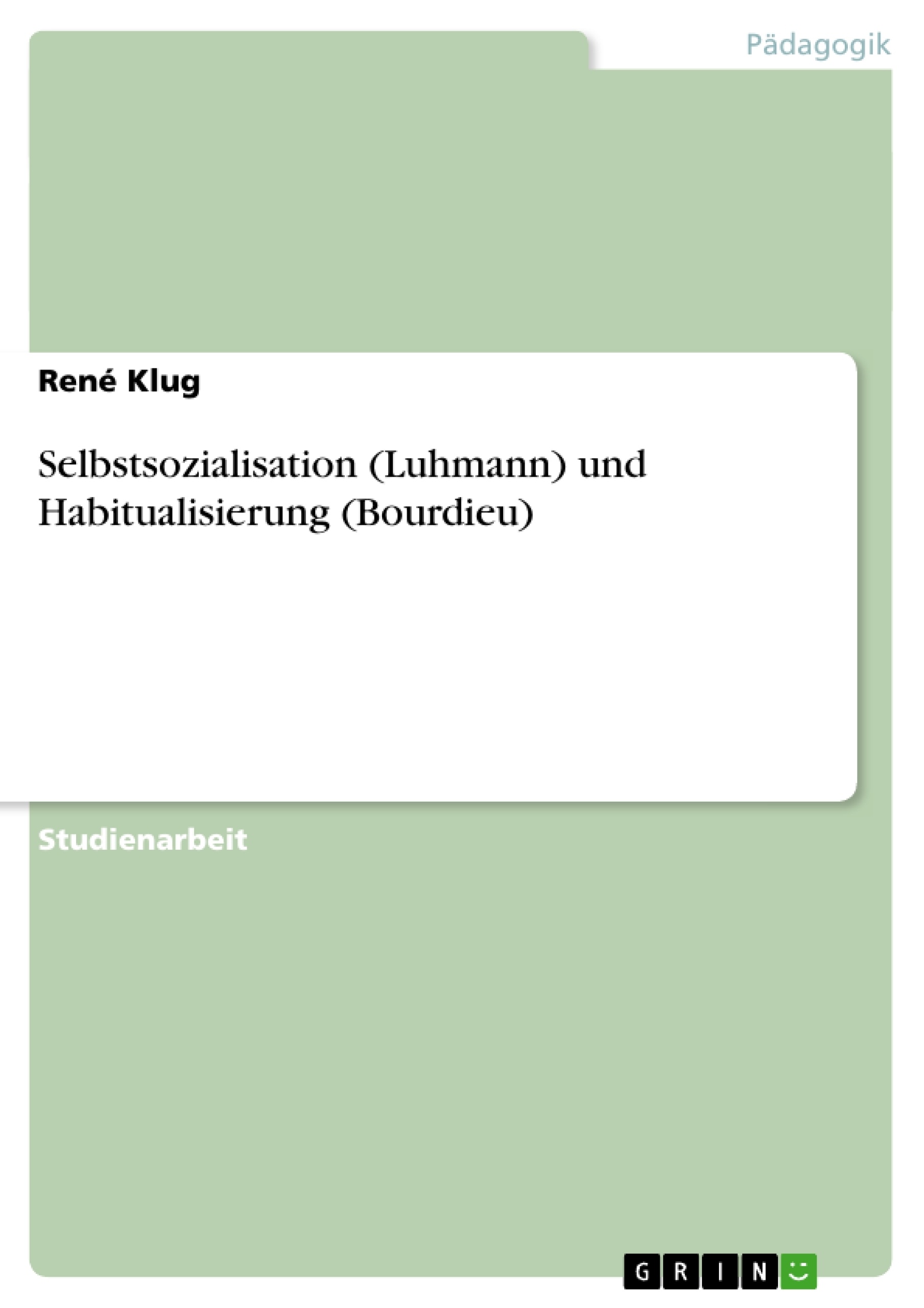Ziel dieser Arbeit soll es sein, die Konzepte von Sozialisation der beiden einflussreichen Soziologen Niklas Luhmann und Pierre Bourdieu vorzustellen, sowie in einem nächsten Schritt zu überprüfen, ob –und falls ja, inwiefern– sich beide Konzepte in ein Verhältnis zueinander setzen lassen. Sozialisationsprozesse standen weder für Luhmann noch für Bourdieu im Zentrum ihrer Arbeit. Während Luhmann sich vorrangig an einer allgemeinen Theorie sozialer Systeme abarbeitete, die dann erst später sozusagen auf einzelne gesellschaftliche Teilsysteme angewendet und übertragen werden sollte (etwa auf das Rechtssystem, die Religion oder auch das Erziehungssystem), so widmete sich Bourdieu vornehmlich der –meist im Alltagsleben verwurzelten– empirischen Forschung, dabei insbesondere zur gesellschaftlichen Reproduktion. Auf diese Weise ist der Begriff der Sozialisation im Gesamtwerk Luhmanns nur von marginaler Bedeutung, während Bourdieu erst gar keine Theorie der Sozialisation entwickelt hat. Dennoch lassen sich Bourdieus Ausführungen zum Habitus für eine Sozialisationstheorie anschlussfähig machen, und auch Luhmanns knappe Ausführungen zum Begriff der (Selbst-)Sozialisation bieten neue Erkenntnisse auf dem Feld der Sozialisationsforschung.
Um ein angemessenes Verständnis von Selbstsozialisation und Habitualisierung zu ermöglichen, ist es unumgänglich, zunächst jeweils einige zentrale Grundbegriffe Luhmanns und Bourdieus einzuführen sowie im Kontext zu erläutern. Insbesondere im Hinblick auf die Systemtheorie ist dies ein durchaus schwieriges Unterfangen, da Luhmann diese so angelegt hat, dass man zur Darstellung einzelner systemtheoretischer Sachverhalte im Grunde immer auch auf andere Begriffe aus der Systemtheorie zurückgreifen muss. Dennoch kann in dieser Arbeit keine vollständige systemtheoretische Rezeption erfolgen, weshalb ich mich auf eine Darstellung der für Luhmanns Sozialisationskonzept zentralen Begriffe Autopoiesis und Kommunikation sowie auf eine überblicksartige Beschreibung sozialer Systeme beschränken möchte, bevor der Begriff der Sozialisation selbst diskutiert wird. Bourdieus Modell der Habitualisierung wiederum setzt eine Klärung des Habitusbegriffs sowie der von ihm differenzierten Kapitalformen voraus. Im Anschluss an die Beschreibung der beiden Sozialisationskonzepte sollen jeweils die Konsequenzen für die Pädagogik diskutiert werden, bevor es abschließend um die Frage geht, in welchem Verhältnis beide Theorien zueinander gedacht werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Niklas Luhmann: Sozialisation als Selbstsozialisation
- Autopoiesis
- Intentionale Sozialisation
- Kommunikation
- Soziale Systeme
- Sozialisation
- Sekundäre Sozialisation
- Pierre Bourdieu: Sozialisation als Habitualisierung
- Habitus
- Kapital
- Ökonomisches Kapital
- Kulturelles Kapital
- Soziales Kapital
- Symbolisches Kapital
- Konsequenzen für die Pädagogik
- Selbst- und/oder Fremdsozialisation?
- Fazit
- Abbildungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Sozialisationskonzepten von Niklas Luhmann und Pierre Bourdieu. Ziel ist es, die beiden Konzepte vorzustellen und zu analysieren, ob und inwiefern sie sich zueinander in Beziehung setzen lassen. Obwohl Sozialisationsprozesse weder für Luhmann noch für Bourdieu im Zentrum ihrer Arbeit standen, bieten ihre Ansätze neue Erkenntnisse für die Sozialisationsforschung. Luhmanns Konzept der Selbstsozialisation basiert auf seiner Systemtheorie, während Bourdieus Habitus-Konzept eine wichtige Grundlage für eine Sozialisationstheorie bietet.
- Selbstsozialisation nach Luhmann
- Habitualisierung nach Bourdieu
- Die Rolle von Kommunikation und sozialen Systemen
- Die Bedeutung von Kapitalformen für die Sozialisation
- Konsequenzen für die Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Zielsetzung der Arbeit dar und führt in die Konzepte von Selbstsozialisation und Habitualisierung ein. Im zweiten Kapitel wird Luhmanns Systemtheorie vorgestellt, wobei die zentralen Begriffe Autopoiesis, Kommunikation und soziale Systeme erläutert werden. Anschließend wird Luhmanns Konzept der Selbstsozialisation im Kontext seiner Systemtheorie diskutiert. Das dritte Kapitel widmet sich Bourdieus Habitus-Konzept und den verschiedenen Kapitalformen, die er unterscheidet. Es werden die Konsequenzen von Bourdieus Theorie für die Pädagogik beleuchtet. Im vierten Kapitel wird die Frage nach Selbst- und Fremdsozialisation diskutiert, wobei die beiden Konzepte von Luhmann und Bourdieu in Beziehung gesetzt werden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Selbstsozialisation, Habitualisierung, Systemtheorie, Autopoiesis, Kommunikation, soziale Systeme, Habitus, Kapitalformen, Pädagogik, Sozialisationstheorie.
- Citar trabajo
- B.A. René Klug (Autor), 2009, Selbstsozialisation (Luhmann) und Habitualisierung (Bourdieu), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131597