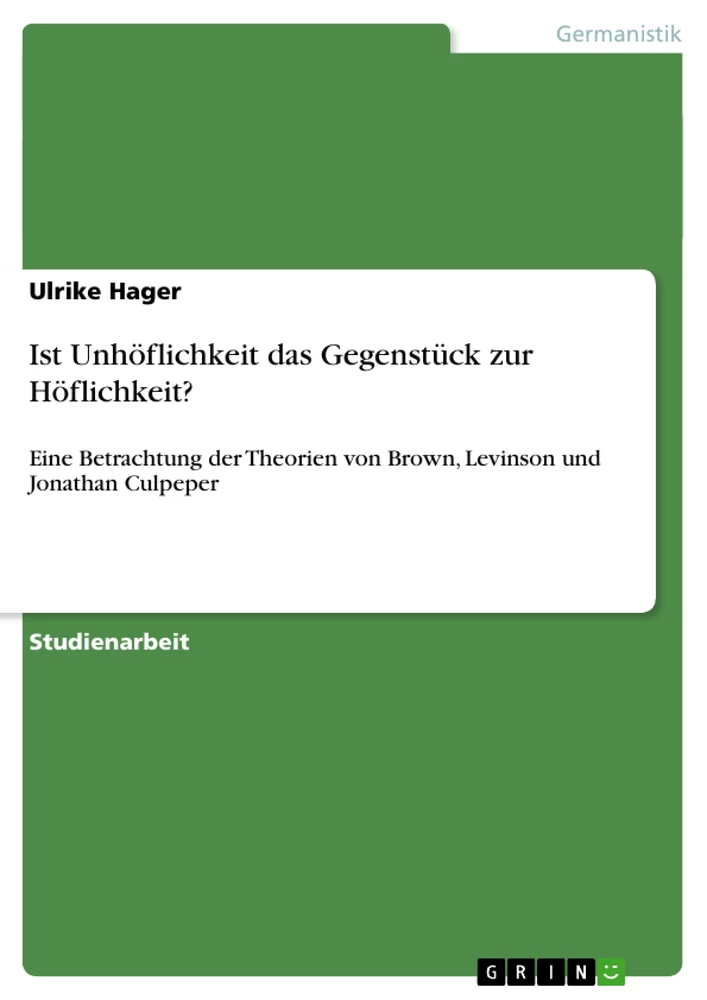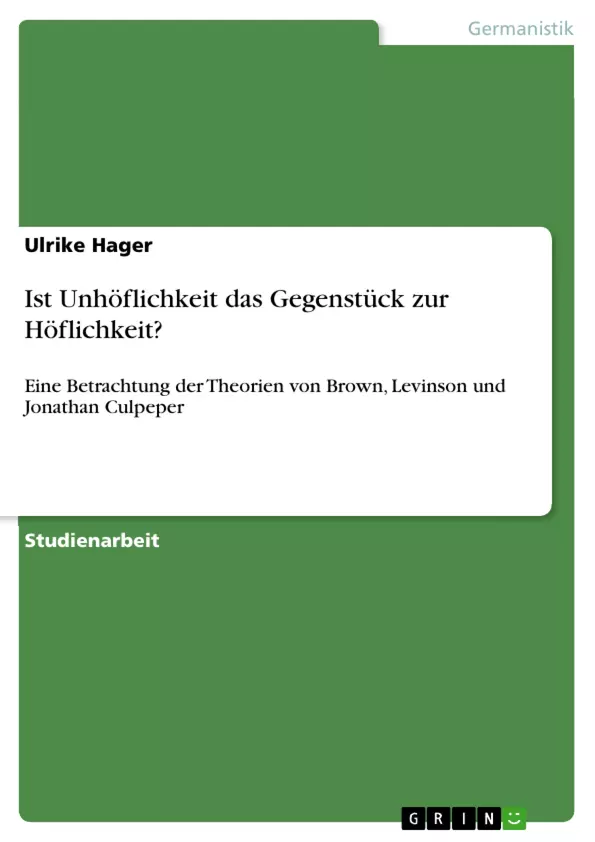Dass Höflichkeit zu den Tugenden gehört, ist ein ungeschriebenes
Gesetz in einer Gesellschaft. Aber ist sie heute immer noch so wichtig wie Generationen zuvor? Ist nicht inzwischen eher Unhöflichkeit die Regel? Denn muss heutzutage nicht alles schneller, effektiver, Erfolg versprechender sein – und Höflichkeit stellt doch eher ein Hindernis dar als einen Antrieb, da sie vielmehr die Dinge aufhält als sie in Gang zu bringen.
Nun nimmt Unhöflichkeit nicht zwangsläufig die Bedeutung an, die
Höflichkeit trotz allem noch zugeschrieben wird. Dies verdeutlicht, dass sie immer noch als negative Eigenschaft bewertet wird. Dennoch ist Unhöflichkeit in vielen Alltagssituationen latent aber auch offensichtlich spürbar – jeder hat schon die Erfahrung einer Situation gemacht, in der er nicht anders konnte, als die scheinbare Höflichkeit als Unhöflichkeit zu empfinden und seine Reaktion nicht eindeutig darstellen zu können. In der vorliegenden Arbeit soll es um die Theorie zur Unhöflichkeit gehen–ein Unterfangen, das durch bisher wenige Erforschungen mit der Einflechtung eigener Erfahrungen verbunden werden muss. Forschungen und Theorien zur linguistischen Unhöflichkeit sind eher rar gesät, daher beziehe ich mich vorwiegend auf Jonathan Culpeper, der mit dem Artikel „Towards an anatomy of impoliteness“ (1996) eine erste linguistische Basis bildet. Ich möchte mit dieser Arbeit als Ergebnis die wichtigsten Aspekte einer möglichen Theorie der Unhöflichkeit herausarbeiten, und schließe dabei meine eigenen Standpunkte mit ein, um der Theorie einen zwar individuellen und subjektiven, aber doch auch praktischen Aspekt hinzuzufügen. Im Blickpunkt soll dabei immer bleiben, dass ich Unhöflichkeit und Höflichkeit nicht als gegensätzliches Paar einer möglichen Art von Handlung sehe, sondern dass beide Aspekte sich auf einem Kontinuum befinden und eine von vielen Möglichkeiten darstellen, wie man sich in einer Situation mit seinem Gesprächspartner verhält. Diese Erkenntnis ziehe ich selbst, und auch aus dem Aufsatz von Locher und Watt: „Politeness theory and relational work“ (2005).
Alle Beispiele und Abbildungen, die nicht auf eine Quelle verweisen, sind selbst erzeugt beziehungsweise aus der eigenen Erfahrung geschöpft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Theorie der Höflichkeit
- 2.1 Brown und Levinsons Höflichkeitstheorie
- 2.1.1 Positives und negatives Face
- 2.1.2 Face threatening acts
- 2.2 Höflichkeitsstrategien nach Brown und Levinson
- 3. Zur Theorie der Unhöflichkeit - Jonathan Culpeper
- 3.1 Verschiedene Ausprägungen von Unhöflichkeit: inherent und mock impoliteness
- 3.1.1 Inhärente Unhöflichkeit
- 3.1.2 Scheinunhöflichkeit
- 3.2 Unhöflichkeitsstrategien nach Culpeper
- 4. Auswertung und Vergleich der Modelle nach Brown & Levinson und Culpeper
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Theorie der Unhöflichkeit im Kontext der bestehenden Höflichkeitstheorien. Sie zielt darauf ab, eine adäquate Theorie der Unhöflichkeit zu entwickeln, indem sie die Ansätze von Brown & Levinson und Jonathan Culpeper vergleicht und kontrastiert. Der Fokus liegt auf der Frage, ob Unhöflichkeit das genaue Gegenstück von Höflichkeit darstellt oder ob beide Konzepte eher auf einem Kontinuum existieren.
- Brown & Levinsons Höflichkeitstheorie und das Konzept des "Face"
- Culpepers Theorie der Unhöflichkeit und deren verschiedene Ausprägungen
- Vergleich der beiden Theorien und deren Anwendbarkeit auf konkrete Situationen
- Die Rolle von "Face Threatening Acts" (FTAs) in der Kommunikation
- Die Frage nach dem Gegensatzpaar Höflichkeit/Unhöflichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis von Höflichkeit und Unhöflichkeit in den Mittelpunkt. Sie argumentiert, dass Unhöflichkeit, obwohl oft als negativ bewertet, in vielen Alltagssituationen präsent ist. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, eine Theorie der Unhöflichkeit zu entwickeln, die auf den Arbeiten von Jonathan Culpeper aufbaut und eigene Erfahrungen miteinbezieht. Dabei wird betont, dass Höflichkeit und Unhöflichkeit nicht als strikte Gegensätze, sondern als Punkte auf einem Kontinuum betrachtet werden sollten.
2. Zur Theorie der Höflichkeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Höflichkeitstheorie von Brown und Levinson. Es erklärt das Konzept des "Face" (positives und negatives Face) und die Bedeutung von "Face Threatening Acts" (FTAs). Die Theorie basiert auf der Annahme, dass Menschen rational handeln, um ihren eigenen "Face" und den ihres Gegenübers zu wahren. Der Schwerpunkt liegt auf der Minimierung von Gesichtsverlust durch strategisches Handeln.
3. Zur Theorie der Unhöflichkeit - Jonathan Culpeper: Dieses Kapitel präsentiert Culpepers Ansatz zur Unhöflichkeit, der verschiedene Ausprägungen von Unhöflichkeit wie "inherent impoliteness" und "mock impoliteness" unterscheidet. Es beschreibt Strategien der Unhöflichkeit und analysiert, wie diese im Kontext der Kommunikation wirken. Im Gegensatz zu Brown und Levinson rückt Culpeper die Intention des Sprechers stärker in den Vordergrund.
4. Auswertung und Vergleich der Modelle nach Brown & Levinson und Culpeper: Dieses Kapitel (welches im Ausgangstext nicht ausführlich beschrieben wird) würde einen detaillierten Vergleich zwischen den Theorien von Brown & Levinson und Culpeper durchführen. Es würde Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Ansätze herausarbeiten, die Stärken und Schwächen beider Modelle analysieren und möglicherweise einen integrierten Ansatz vorschlagen.
Schlüsselwörter
Höflichkeit, Unhöflichkeit, Brown & Levinson, Jonathan Culpeper, Face, Face Threatening Acts (FTAs), Kommunikation, linguistische Pragmatik, Gesprächsanalyse, Politeness Theory, Impoliteness Theory.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Theorie der Unhöflichkeit im Kontext der Höflichkeitstheorien
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Theorie der Unhöflichkeit im Kontext bestehender Höflichkeitstheorien. Sie vergleicht und kontrastiert die Ansätze von Brown & Levinson und Jonathan Culpeper, um eine adäquate Theorie der Unhöflichkeit zu entwickeln. Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob Unhöflichkeit das genaue Gegenteil von Höflichkeit ist oder ob beide Konzepte eher auf einem Kontinuum existieren.
Welche Theorien werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Höflichkeitstheorie von Brown & Levinson mit der Unhöflichkeitstheorie von Jonathan Culpeper. Brown & Levinsons Theorie fokussiert auf das Konzept des „Face“ (positives und negatives Face) und „Face Threatening Acts“ (FTAs). Culpepers Theorie unterscheidet verschiedene Ausprägungen von Unhöflichkeit, wie „inherent impoliteness“ und „mock impoliteness“, und betont die Intention des Sprechers.
Was ist das Konzept des "Face" nach Brown & Levinson?
Das „Face“ in Brown & Levinsons Theorie bezeichnet das öffentliche Selbstbild einer Person. Es besteht aus dem positiven Face (Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung) und dem negativen Face (Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Freiheit). „Face Threatening Acts“ (FTAs) sind Handlungen, die das Face einer Person bedrohen können.
Wie unterscheidet sich Culpepers Unhöflichkeitstheorie von Brown & Levinsons Höflichkeitstheorie?
Culpeper rückt im Gegensatz zu Brown & Levinson die Intention des Sprechers stärker in den Vordergrund. Er unterscheidet verschiedene Arten von Unhöflichkeit, betont die kontextuelle Abhängigkeit und analysiert, wie Unhöflichkeitsstrategien in der Kommunikation wirken. Während Brown & Levinson die Minimierung von Gesichtsverlust betonen, fokussiert Culpeper auch auf die bewusste und strategische Anwendung von Unhöflichkeit.
Welche Arten von Unhöflichkeit werden bei Culpeper unterschieden?
Culpeper unterscheidet unter anderem zwischen „inherent impoliteness“ (inhärente Unhöflichkeit, die durch die Äußerung selbst bedingt ist) und „mock impoliteness“ (Scheinunhöflichkeit, die ironisch oder spielerisch gemeint ist).
Wie werden die Theorien von Brown & Levinson und Culpeper verglichen?
Ein Kapitel der Arbeit (welches im Ausgangstext nicht detailliert beschrieben wird) vergleicht die Theorien von Brown & Levinson und Culpeper detailliert. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Stärken und Schwächen beider Modelle herausgearbeitet und möglicherweise ein integrierter Ansatz vorgeschlagen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Höflichkeit, Unhöflichkeit, Brown & Levinson, Jonathan Culpeper, Face, Face Threatening Acts (FTAs), Kommunikation, linguistische Pragmatik, Gesprächsanalyse, Politeness Theory, Impoliteness Theory.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Höflichkeitstheorie (Brown & Levinson), Unhöflichkeitstheorie (Culpeper), einem Vergleich beider Theorien und einem Fazit.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist das Verhältnis von Höflichkeit und Unhöflichkeit. Die Arbeit untersucht, ob diese als strikte Gegensätze oder als Punkte auf einem Kontinuum zu betrachten sind.
- Quote paper
- Ulrike Hager (Author), 2008, Ist Unhöflichkeit das Gegenstück zur Höflichkeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131462