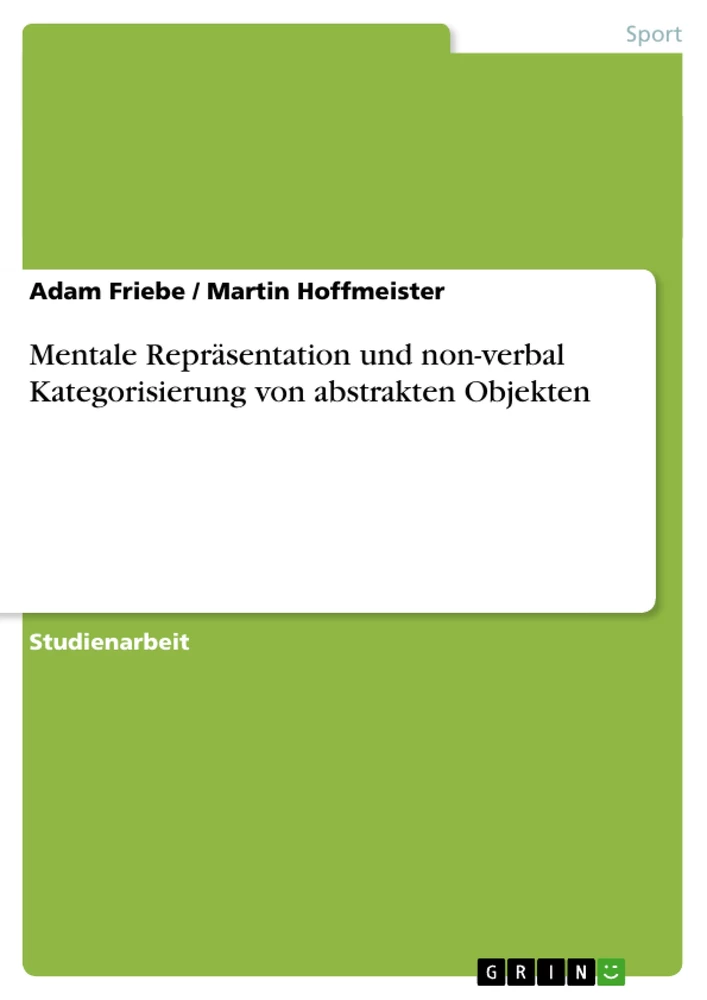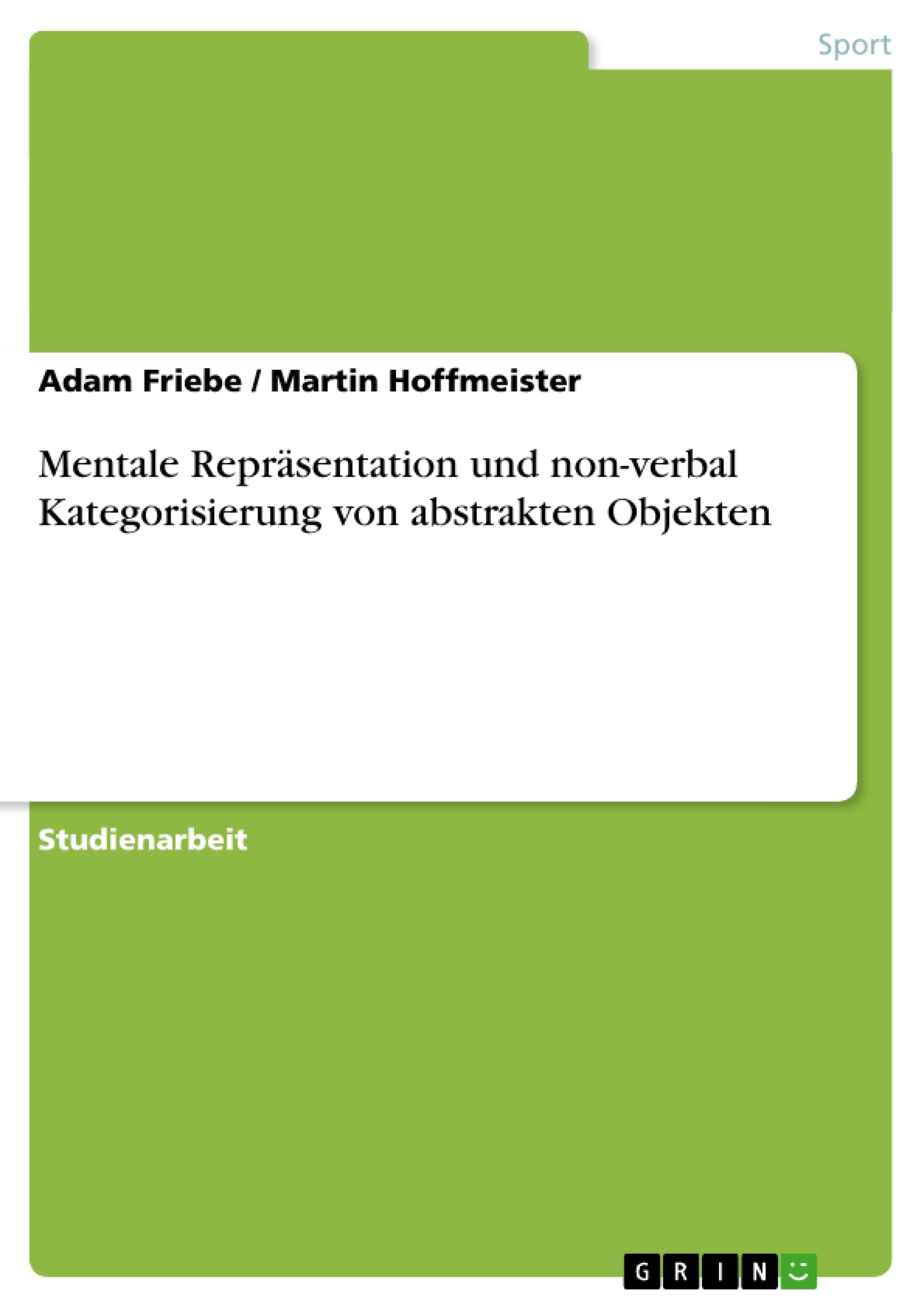Unser Alltag wird bestimmt von der Interaktion mit verschiedensten Objekten. Diese sind
sehr vielfältig und unüberschaubar. In der Regel können wir jedoch alle Objekte unserer
Umwelt, wie beispielsweise Tische, Stühle etc., einordnen und auch meistens die richtige
Verwendung dafür finden. Um all die Eindrücke kognitiv einordnen zu können, bedient sich
unserer Gedächtnis der Kategorisierung. Eine scheinbar leichte Aufgabe für das Gehirn.
Tatsächlich jedoch gibt es bis heute kein automatisches Erkennungssystem, welches diese
Aufgabe lösen kann. Somit gehört die Bildung und Erhaltung von Kategorien zu den
schwierigsten und wichtigsten Fragestellungen der kognitiven Neurobiologie bzw. Wahrnehmungspsychologie.
Dazu wurden seit Ende der 1960er Jahre die verschiedensten
Studien durchgeführt. Die Anfänge machten Berlin und Kay mit Untersuchungen zur
sprachlichen Einordnung von Farben. Während die Gruppierung von Farben auch bis heute
das vorrangige Thema der Kategorisierung bildet, sind Formen bisher nur selten als
Versuchsgegenstand verwendet worden. Hierfür könnte das, gegenüber Farben, komplexere
Vokabular für Formen eine Rolle spielen. Außerdem ist die Umsetzung in ein experimentelles
Design vielseitiger als bei Farben. Somit ist die Durchführung um einiges umfangreicher.
Weiter wird mit den meisten Objekten ein Zusammenhang zwischen ihnen
und ihrer Umwelt hergestellt. Somit können sie aus diesem Kontext nicht so leicht gelöst
werden, was die Einordung innerhalb evtl. Experimente erschwert.
Im Rahmen eines umfassenden Studienprojekts des Arbeitsbereichs für Neurokognition
und Bewegung der Universität Bielefeld mit dem Thema „Manuel Repräsentation and categorisation
of abstract objects“ werden die verschiedensten Studien zur verbalen, nonverbalen
und Greifbewegungs-Kategorisierung von abstrakten Objekten durchgeführt.
In der vorliegenden Arbeit wurden abstrakte Objekte als Grundlage für Kategorisierung
verwendet. Dabei wurde ein non-verbales Paradigma zur Untersuchung der mentalen
Repräsentation verwendet. Somit ist das Experiment nicht sprachgebunden. Es beinhalten
vielmehr zwei andere Intentionen. So sollten die Probanden auf der einen Seite die Objekte
auf Grund ihres Aussehens kategorisieren, d. h. sie sollen die Objekte im Bezug auf ihre
Ähnlichkeit miteinander vergleichen. Weiter sollen auf der anderen Seite Probanden Greifbewegungen
der Objekte miteinander vergleich und für sich als ähnlich bzw. nicht ähnlichen
beurteilen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Mentale Repräsentation & Kategorisierung
- vertikale Dimension der Kategorisierung
- Horizontale Ebene der Kategorisierung
- Prototypikalität
- Familienähnlichkeit, Prägnanz und cue validity
- Repräsentation des Prototyps
- Modell der Objektwahrnehmung
- Strukturelle Repräsentation
- Ansichtsbasierte Repräsentation
- Objekt-Repräsentation im Cortex
- Klassifizierung von Handgriffen
- Mentale Repräsentation von Handgriffen
- Mentale Repräsentation & Kategorisierung
- Methodik
- Probanden
- Probanden Objektvergleich
- Probanden Greifbewegungsvergleich
- Objektauswahl
- SDA-Methode
- Ablauf
- Datenauswertung
- Probanden
- Ergebnisse
- Experimentteil „Kategorisierung Objekte"
- Kategorisierung Objekt Probanden gesamt
- Kategorisierung Objekt männliche Probanden
- Kategorisierung Objekt weibliche Probanden
- Kategorisierung Greifbewegung Probanden gesamt
- Kategorisierung Greifbewegung Probanden männlich
- Kategorisierung Greifbewegung Probanden weiblich
- Prüfung auf Invarianz
- Experimentteil „Kategorisierung Objekte"
- Diskussion
- Experimenteil Kategorisierung Objekte
- Experimenteil Kategorisierung Greifbewegungen
- Vergleich der Intention
- Allgemeine Diskussion der Ergebnisse
- Kritik und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die mentale Repräsentation und Kategorisierung von abstrakten Objekten im Kontext von visueller Wahrnehmung und Greifbewegungen. Ziel ist es, die Kategorien zu identifizieren, die aus der visuellen Wahrnehmung und der Intention der Greifbewegung gebildet werden, sowie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Experimentteilen zu analysieren. Darüber hinaus wird untersucht, ob es geschlechtsspezifische Unterschiede in der Kategorisierung gibt.
- Mentale Repräsentation und Kategorisierung von abstrakten Objekten
- Vergleich von visueller Wahrnehmung und Greifbewegungen
- Identifizierung von Kategorien in beiden Experimentteilen
- Untersuchung von geschlechtsspezifischen Unterschieden
- Analyse von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Experimentteilen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der mentalen Repräsentation und Kategorisierung von Objekten ein und erläutert die Relevanz der Thematik für die kognitive Neurobiologie und Wahrnehmungspsychologie. Sie stellt die Fragestellungen der Arbeit vor, die sich auf die Kategorienbildung aus visueller Wahrnehmung und Greifbewegungen sowie auf geschlechtsspezifische Unterschiede beziehen.
Der theoretische Hintergrund beleuchtet die Konzepte der mentalen Repräsentation und Kategorisierung, wobei die vertikale und horizontale Dimension der Kategorisierung sowie die Repräsentation des Prototyps im Detail betrachtet werden. Weiterhin werden Modelle der Objektwahrnehmung, die Objekt-Repräsentation im Cortex sowie die Klassifizierung und mentale Repräsentation von Handgriffen behandelt.
Die Methodik beschreibt die Probanden, die Objektauswahl, die SDA-Methode, den Ablauf des Experiments und die Datenauswertung. Die Ergebnisse präsentieren die Kategorien, die aus der visuellen Wahrnehmung und der Greifbewegung gebildet wurden, sowie die Ergebnisse der Prüfung auf Invarianz.
Die Diskussion analysiert die Ergebnisse der beiden Experimentteile, vergleicht die Intentionen der visuellen Wahrnehmung und der Greifbewegung und diskutiert die allgemeinen Ergebnisse der Untersuchung. Abschließend werden kritische Aspekte der Untersuchung beleuchtet und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsrichtungen gegeben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die mentale Repräsentation, die Kategorisierung, die visuelle Wahrnehmung, die Greifbewegung, abstrakte Objekte, die Prototypikalität, die Familienähnlichkeit, die cue validity, die Objekt-Repräsentation im Cortex, die Klassifizierung von Handgriffen, die geschlechtsspezifischen Unterschiede und die SDA-Methode.
- Quote paper
- Adam Friebe (Author), Martin Hoffmeister (Author), 2008, Mentale Repräsentation und non-verbal Kategorisierung von abstrakten Objekten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131393