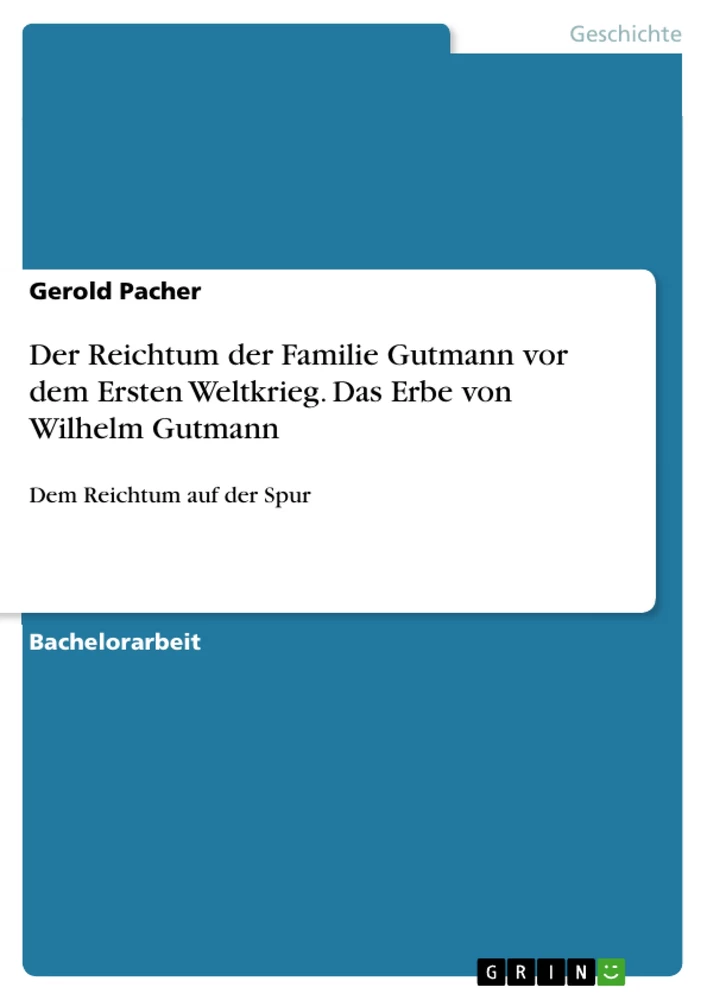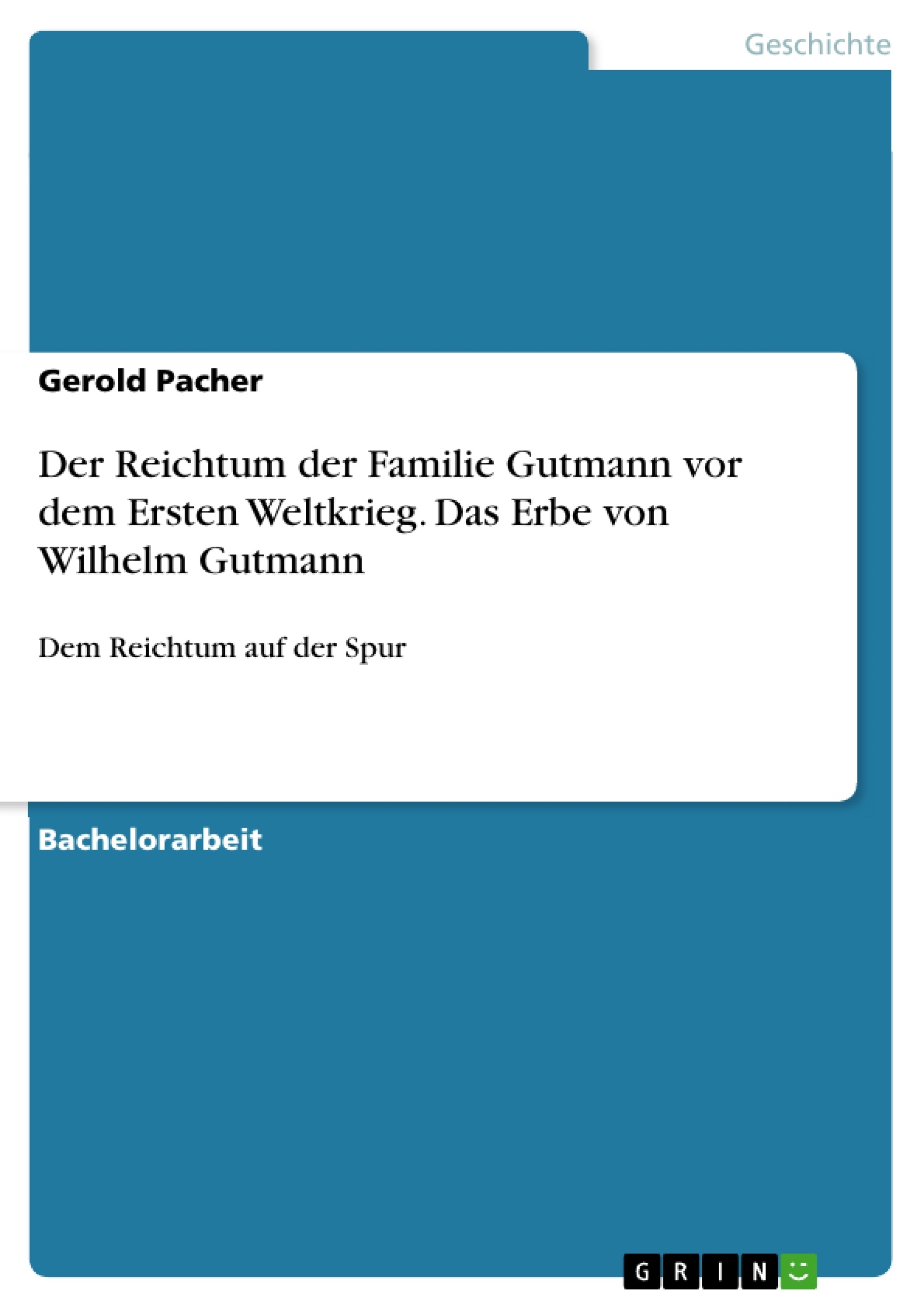In dieser Bachelorarbeit wird der Reichtum der Familie Gutmann in den letzten Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg untersucht. Dazu wird auf die Erbschaft Wilhelm Gutmanns fokussiert. Erbschaften geben zwar nur zu einem punktuellen Moment Einblick, sie können dennoch wesentliche Hinweise zu Vermögen beinhalten.
Wilhelm war Firmengründer und legte mit seiner Vermögensanhäufung den Grundstein dafür, dass seine Hinterbliebenen in Wien um 1910 zu einer der reichsten Familien gehörten. Wie umfassend sein Vermögen bis zu seinem Ableben war, wird anhand der beiden Hauptquellen Testament und Verlassenschaftsakt untersucht.
Zusätzlich werden andere Quellen einbezogen, wie etwa Wilhelms Memoiren, das Testament seines Bruders David, Gebäudeschematismen oder zeitgenössische Unternehmensverzeichnisse. Dabei zeigt sich, dass sich das Testament und die Verlassenschaft für die Reichtumsforschung unterschiedlich eignen.
Während das Testament zwar manch Fährte enthält und gewisse persönliche Ansichten des Erblassers vermittelt, findet sich in diesem Fall keine Aufstellung des Gesamtvermögens. Diese ist jedoch im Verlassenschaftsakt enthalten, weshalb dieser zur Konkretisierung des gegenständlichen Vermögens unerlässlich ist.
Deutlich wird in den Quellen auch, dass die Familie Gutmann hinter Rothschild durchaus als zweitreichste Familie in Wien um 1900 genannt werden kann. Im Vergleich mit anderen stichprobenartigen Auswertungen wird aber deutlich, dass Gutmanns deutlich näher an der Gruppe der Rothschild-Nachfolger stehen – vielleicht sogar mittendrin – als an Rothschild selbst.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Methode und Quellen
2.1. Motiv Reichtum
2.2. Quellen
2.3. Methodik
3. Rahmen
3.1. Reich und Arm
3.2. Strategien und Struktur
4. Familie um Wilhelm Gutmann
5. Hinweise zum Reichtum der Gutmanns
6. Dem Reichtum auf der Spur
6.1. Testament Wilhelms
6.2. Verlassenschaftsakt
7. Schlusswort
8. Literaturverzeichnis
9. Quellen
10. Anhang
10.1. Auszug der Liste der Reichsten in Wien 1910
10.2. Auszug aus dem Verwandtschaftsdiagramm der Gutmanns
10.3. „Bestandtheile des Erbvermögens“
10.4. Einblick in die Unterlagen
10.4.1. Auszug Testament Wilhelm
10.4.2. Auszug Verlassenschaftsakt Wilhelm
10.5. Weiterführende Fragen
Abstract
In dieser Bachelorarbeit wird der Reichtum der Familie Gutmann in den letzten Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg untersucht. Dazu wird auf die Erbschaft Wilhelm Gutmanns fokussiert. Erbschaften geben zwar nur zu einem punktuellen Moment Einblick, sie können dennoch wesentliche Hinweise zu Vermögen beinhalten.
Wilhelm war Firmengründer und legte mit seiner Vermögensanhäufung den Grundstein dafür, dass seine Hinterbliebenen in Wien um 1910 zu einer der reichsten Familien gehörten. Wie umfassend sein Vermögen bis zu seinem Ableben war, wird anhand der beiden Hauptquellen Testament und Verlassenschaftsakt untersucht. Zusätzlich werden andere Quellen einbezogen, wie etwa Wilhelms Memoiren, das Testament seines Bruders David, Gebäudeschematismen oder zeitgenössische Unternehmensverzeichnisse.
Dabei zeigt sich, dass sich das Testament und die Verlassenschaft für die Reichtumsforschung unterschiedlich eignen. Während das Testament zwar manch Fährte enthält und gewisse persönliche Ansichten des Erblassers vermittelt, findet sich in diesem Fall keine Aufstellung des Gesamtvermögens. Diese ist jedoch im Verlassenschaftsakt enthalten, weshalb dieser zur Konkretisierung des gegenständlichen Vermögens unerlässlich ist. Deutlich wird in den Quellen auch, dass die Familie Gutmann hinter Rothschild durchaus als zweitreichste Familie in Wien um 1900 genannt werden kann. Im Vergleich mit anderen stichprobenartigen Auswertungen wird aber deutlich, dass Gutmanns deutlich näher an der Gruppe der Rothschild Nachfolger stehen – vielleicht sogar mitten drin – als an Rothschild selbst.
1. Einleitung
Moriz ist eines der Kinder und Erbe von Wilhelm Gutmann, dem namengebenden Protagonisten dieser Bachelorarbeit. Vor Gericht streitet er über seine Zahlungsfähigkeit, ob seine „Schuldenlast an einen Punkt gediehen ist, dass die Einkünfte des Vermögens nicht mehr ausreichen, um die Gläubiger zu befriedigen“.1 So betont er im offiziellen Schriftverkehr, dass das Gericht in „absoluter Unkenntnis der Größe der Einkünfte“ aus seiner Erbschaft sei. In dieser Formulierung mag Moriz in seiner misslichen Lage durchaus versuchen, dieses Erbe größer darzustellen als es war. Dabei ist er aber im Testament nur minder bedacht, im Vergleich zu den Haupterben mit Brosamen abgespeist worden – dazu aber im Detail später.
Sein Halbbruder Maximilian ist einer der beiden Haupterben, mit der Weiterführung des familiären Firmenbetriebes beauftragt und Empfänger eines wesentlichen größeren Erbschaftsteiles. Er gibt in der gerichtlichen Korrespondenz jedoch nur indirekt Hinweis auf dessen Umfang. Nämlich was die finanzielle Situation der Firma betrifft:2
Die Sicherheit der Firma Gebrüd. Gutmann ist über jeden Zweifel erhaben, ihre Vermögensverhältnisse sind dem hochlöblichen Gerichte aus dem Abhandlungsacte bekannt. [kursive Hervorhebung G.P.]
Zwar ist vom florierenden Familienunternehmen nicht zwingend auf die Höhe seines geerbten Reichtums zu schließen, dennoch legt Max offenbar Wert darauf, „jeden Zweifel“ zu deren Zahlungsfähigkeit auszuräumen. Wie groß, wie umfassend war aber nun das Erbe des Wilhelm Ritter von Gutmann wirklich? Welches Vermögen konnte er bis zu seinem Tod erwerben und seinen Kindern hinterlassen?
Die Familie Gutmann war 1910, also 15 Jahre nach dem Tod Wilhelms, dem Gründer der Firma „Gebrüder Gutmann“, unter den reichsten Steuerzahlern der Monarchie: unter den zehn Menschen, die die höchsten Jahreseinkommen versteuerten, finden sich gleich fünf Gutmanns3. Zum Ausmaß ihres Vermögens wurde im Unterschied zu den noch deutlich reicheren Rothschilds bisher wenig geforscht.4
In dieser Bachelorarbeit möchte ich meine bisherige Forschung zur Familie Gutmann vertiefen. Während ich zuvor ihre Strategien zur Erlangung und Bewahrung von Reichtum anhand zeitgenössischer Berichterstattung untersucht habe5, möchte ich nun anderen Spuren folgen, um mich dem Ausmaß des Gutmann‘schen Reichtums weiter anzunähern.
In einer Welt, in der Reichtum einerseits nicht unbedingt an der großen Glocke hängt,6 andererseits nicht eindeutig zu definieren und zu quantifizieren ist,7 stützt sich die historische Reichtumsforschung auf verschiedene Quellenkorpi. Darunter fallen eben auch Schriftstücke rund ums Erben, wie etwa Testamente oder Verlassenschaftsakte.8 Diese Quellen können ein Schlaglicht auf Vermögen, die zu Lebzeiten nicht umfassend dokumentiert sind, zum Zeitpunkt des Todes werfen.
Deshalb soll in dieser Arbeit zunächst das Testament von Wilhelm Gutmann untersucht werden. Wie im nächsten Abschnitt deutlich wird, werde ich auch den Verlassenschaftsakt, also die gerichtlich dokumentierte Abhandlung des Testamentes einbeziehen. Zusätzlich sollen vereinzelte Hinweise aus der Literatur und anderen zeitgenössischen Quellen zu Rate gezogen werden.
Die Forschungsfrage beruht auf der oben genannten Hypothese, dass Testamente und Verlassenschaftsakten in der Reichtumsforschung zweckdienliche Hinweise beinhalten können. Diese soll geprüft werden und lautet somit: Können am Fallbeispiel der Familie Gutmann diese Quellen dazu beitragen, den Reichtum der Familie klarer zu erkennen? In diesem Rahmen sollen das Testament und der Verlassenschaftsakt von Wilhelms Erbschaft auf Hinweise zu Vermögensumfang und Vermögensstruktur untersucht werden.
Im folgenden Abschnitt werden die Quellenauswahl und die damit verbundenen Erwartungen dargelegt (Kapitel 2). Dann werden für diese Arbeit wesentliche Rahmenbedingungen skizziert (Kapitel 3) und die Familienkonstellation rund um Wilhelm erörtert (Kapitel 4). Danach werden in der Literatur anzutreffende Hinweise auf den Gutmann’schen Reichtum gesammelt (Kapitel 5). Anschließend werden die Ergebnisse der Quellenauswertung besprochen und in einer Zusammenschau mit anderen zeitgenössischen Hinweisen beurteilt (Kapitel 6).
2. Methode und Quellen
2.1. Motiv Reichtum
Historische Reichtumsforschung ist ein vielschichtiger Bereich. So kann Reichtum recht weit definiert werden. Bourdieu betont neben der ökonomischen auch die kulturelle, soziale und symbolische Ebene von Reichtum.9 In dieser Arbeit ist der Fokus deutlich enger auf dessen ökonomischer Dimension. Doch auch dieser Aspekt alleine ist durchaus uneindeutig. Nicht nur, dass manche Reiche „wenig auskunftsfreudig“ sind,10 alleine schon die Bewertung von verschiedenen Vermögenswerten ist nicht immer zuverlässig: „Vermögensportfolios waren und sind sehr komplex, Vermögensformen verschieden“.11 Das Gesamtvermögen einer Person oder Familie eindeutig zu beziffern ist also ein schwieriges Unterfangen.
Wie bereits erwähnt, ist gerade in Österreich der historische Reichtum ein wenig erforschtes Feld.12 Die Superreichen13 der späten Habsburgermonarchie haben abseits der Familie Rothschild wenig Beachtung gefunden. Und wenn sie diese doch einmal erhalten, wird in populären Darstellungen, anstatt das Zustandekommen und Ausmaß des Vermögens zu fokussieren, eher auf gesellschaftliche oder kulturelle Errungenschaften verwiesen, die manch „Ringstraßenbaron“ ob seines unermesslichen Reichtums fördern konnte. So etwa in einer kürzlich ausgestrahlten Fernsehproduktion.14 In dieser wird noch immer die Geschichte verbreitet, der Wohltäter und Kulturliebhaber Wilhelm Gutmann habe mit „viel Fleiss, etwas Risiko und unternehmerischem Geschick“ sein Vermögen aufgebaut, und dieses dann mit beiden Händen an Arme verteilt. Die Herkunft des Reichtums an sich wird nicht näher behandelt. Sie ist auch in manchen wissenschaftlichen Darstellungen oft nebensächlich.15
An dieser Stelle möchte ich kurz innehalten. Historische Forschung sagt oft mehr über die Zeit aus, in der sie vollzogen wird, als über die Vergangenheit selbst.16 Quellen werden „nicht nur in der Gegenwart gelesen, sondern auch durch und für die Gegenwart“.17 Weil die Quellenauswahl alleine schon einen spezifischen Blick des Autors beinhaltet18, möchte ich meinen offenlegen.
Wie bereits angesprochen, herrschen gesellschaftliche Narrative vor, in denen der Reichtum an sich eher eine Nebenrolle spielt. In der Hauptrolle werden lieber glitzernde Wohltätigkeit oder Gönnerhaftigkeit gesehen. Wie es dazu kam, dass jemand so viel Geld hat, dass er oder sie sich diese leisten kann, bleibt gerne außen vor. In einer Zeit, in der wenige Superreiche immer mehr, riesige Teile der Weltbevölkerung immer weniger Anteil am Gesamtvermögen haben,19 empfinde ich dieses Ausblenden der immer absurder werdenden Ungleichverteilung von Reichtum gesellschaftlich problematisch. Ich glaube, dass die verstärkte Sichtbarmachung dieses Missverhältnisses zumindest ein kleines Rädchen im Prozess einer erhofften Umwälzung zur Umkehrung der aktuellen Dynamik sein kann. Als Historiker möchte ich dazu beitragen, dass die Geschichten über vergangene Superreiche auch beinhalten, wie unverhältnismäßig reich sie waren. Der Gedanke der Sichtbarmachung ist Grundmotiv dieser Arbeit, oder um es mit Moriz Gutmann zu sagen: ich möchte die „absolute Unkenntnis der Größe der Einkünfte“ verringern.20
Seine Familie in den Mittelpunkt der Untersuchung zu stellen, ist eher zufällig geschehen. Die bereits angesprochene Dominanz der Gutmanns auf der Steuerliste von 1910 qualifiziert die Familie eindeutig als damalige Superreiche.21 Der Kontrast ihrer geringen wissenschaftlichen Beachtung scheint mir die Möglichkeit zu eröffnen, mit wenig behandelten Quellen zu arbeiten. Der Fokus auf die Erbschaft Wilhelms ist aus drei Gründen naheliegend. Erstens sind sowohl sein Testament als auch der dazugehörige Verlassenschaftsakt im Wiener Stadt- und Landesarchiv (WSTLA) öffentlich zugänglich.22 Zwar ist Wilhelm selbst auf der besagten Liste gar nicht anzutreffen, weil er bereits 15 Jahre zu vor verstorben ist. Als Firmengründer der Firma „Gebrüder Gutmann“ hat er zweitens aber wesentlichen Anteil am Familienreichtum. Drittens werden beide Quellentypen in der Reichtumsforschung verwendet, oder um diesmal mit Max zu sprechen: „Ihre Vermögensverhältnisse sind aus dem Abhandlungsacte bekannt“.23
2.2. Quellen
Zunächst möchte ich auf allgemeine quellenkritische Aspekte der beiden Hauptdokumente der Erbschaft Wilhelms eingehen. Dabei wird – nebenbei bemerkt – die Frage nach der Rolle von Erben an sich im Prozess einer möglichen Einzementierung von gesellschaftlichen Ungleichheiten in dieser Arbeit nicht behandelt, genauso wenig die rechtlichen Rahmenbedingungen von Erbschaften, wie etwa etwa die zum Pflichtteil von Erbberechtigten.24
Die wesentlichen Quellen dieser Arbeit, ein Testament und der damit verbundene Verlassenschaftsakt entstehen zwar beide rund um das Erben, unterscheiden sich aber in Entstehung und Auswertungspotential.
Was deren Entstehung betrifft, sind Testamente deutlich näher an der Verfasserin als Abhandlungsakte, denn sie bringen deren letzten Willen zum Ausdruck. Durch die Benennung jener Empfänger, die das Erbe erhalten sollen, werden einerseits Vermögenswerte an sich, andererseits inner- und außerfamiliäre Verbindungen erkennbar. Nach Pammer stellt „die Interpretation der Erbeinsetzung und der Legate […] im allgemeinen keine besonderen Probleme“ dar.25 In dieser Hinsicht kann von einem Testament als Quelle durchaus erwartet werden, durch die explizite Benennung der Legate, also der zu vererbenden „Sachen oder Summen“, Hinweise auf Reichtum zu enthalten.26 Auch mentalitätsgeschichtliche Aspekte können anhand dieses Quellentypus festgestellt werden, wenn „Geisteshaltungen gegenüber Gott und der Welt“ formuliert werden.27 Aus quellenkritischer Sicht muss weiters berücksichtigt werden, dass verschiedene Transfermotive vorliegen können.28 So kann eine Autorin vor ihrem Tod das Testament bewusst dazu verwenden, um die Erinnerung an sich selbst nach ihrem Tod zu formen, etwa indem ein Teil des Vermögens für karitative Zwecke vermacht wird.29
Verlassenschafts- oder synonym Abhandlungsakte unterscheiden sich wesentlich von Testamenten. Letztere sind vielmehr Auslöser der Verlassenschaftsabhandlung. Nach dem Tod des Verfassers kümmert sich das Gericht oder eingesetzte Notare um die offizielle Abwicklung des im Testament verfügten Vermögenstransfers.30 Nicht die Verstorbene kommt darin zu Wort sondern offizielle Stimmen, aber auch gegebenenfalls die Hinterbliebenen wie die Beispiele von Max und Moriz bereits gezeigt haben. So werden neben personenbezogenen Daten wie Name, Alter, Beruf, Familienstand oder Vormundschaften eben auch die Vermögenswerte des Erblassers angeführt. Der Akt enthält eine „summarische Beschreibung des Vermögens und Nennung einzelner wichtiger Vermögensposten wie Herrschaften oder Immobilien“.31 Dieser grobe Überblick muss in verschiedenen Fällen in einer „Inventarisierung“ konkretisiert werden, etwa wenn es zu Erbstreitigkeiten kommt, oder Unmündige unter den Erben sind.32 Auch können zu Beginn der Abhandlung offene Passiva oder der Wert von Wertpapieren noch nicht bekannt sein. In solchen Fällen entstehen während der Abhandlung vollständigere Verzeichnisse, der Prozess kann sich also über einen längeren Zeitraum erstrecken.33 Weil die Verlassenschaftsabhandlungen nicht nur „den gesamten Vermögensstand des Erblassers“ aufschlüsseln, sondern auch über die Zusammensetzung dieses Bestandes informieren, sind sie in der Reichtumsforschung gerne verwendete Quellen.34 Unterschiedliche Kategorien werden aufgelistet: Bargeld, Wertpapiere, Lebensversicherungen, Unternehmensanteile, Immobilien, Preziosen, Mobilien oder Schulden. So spielt dieser Quellenbestand in verschiedenen Forschungen zu Reichtum eine zentrale Rolle.35 Er ist aber auch nicht unumstritten. So nennt etwa Pammer „Erfassungs- und Bewertungsfehler“, die je nach Vermögenskategorie unterschiedlich wiegen können.36 Trotzdem sei eine zu drastische Über- oder Unterbewertung auszuschließen, weil die Einschätzung sowohl für die Finanzbehörde als auch für etwaige miteinander streitende Erben plausibel sein muss. Größere Fehler seien nur dann möglich, wenn „sich Erben untereinander absprachen“.37 In dasselbe Horn stößt Niederacher, sie bemängelt an Verlassenschaftsakten, dass diese mit Absicht unvollständig sein können, etwa zur Verringerung der Erbschaftsteuerlast.38 Neben dem absichtlichen Verschweigen von Vermögensteilen und der möglichen ungenauen Bepreisung von Besitztümern nennt Stekl einen weiteren Aspekt:39
Zudem ist noch der Umstand zu berücksichtigen, dass Verlassenschaftsakten Momentaufnahmen des Vermögens von Menschen in meist fortgeschrittenem Alter sind; beträchtliche Vermögensteile konnten früher verschenkt oder veräußert [...] worden sein.
Verlassenschaftsinventare bilden also das Vermögen nur zum Zeitpunkt des Todes ab, was zu vor oder danach passiert, können sie nicht abbilden.
Auch Sandgruber stützt sich nicht nur auf Steuerlisten, er bezieht gelegentlich Verlassenschaftsinventare ein. So sollen sie „Spitzenvermögen in der Regel besser“ erfassen als mittlere und geringe Vermögen.40 An anderer Stelle aber nennt er am Beispiel des Textilindustriellen Nikolaus Dumba – wieder ein „wichtiger Kunstmäzen und -sammler sowie Förderer des Wiener Musiklebens“ – auch Probleme des Quellentypus:41
Sein hinterlassenes Vermögen wurde auf 9 bis 10 Mio. fl [18-20 Mio. Kronen.] geschätzt. Dabei unterschätzte der Verlassenschaftsakt den Wert seines Vermögens wahrscheinlich ganz gewaltig, vor allem was die riesigen Kunst- und Autographensammlungen betraf, aber auch die Immobilien.
Trotz dieser „ganz gewaltigen“ quellenkritischen Bedenken, kann also festgehalten werden, dass beide Quellenarten, Testamente und Verlassenschaftsakten Informationen zu Reichtum beinhalten können. Aufgrund möglicher Lücken müssen sie nicht zwingend ein vollständiges Bild zeichnen. Dennoch legt Korom nahe, „Erbe in den Mittelpunkt der Vermögens- und Reichtumsforschung zu stellen“.42
Wie bereits in den einleitenden Beispielen von Max und Moriz deutlich wurde, muss die Aussagekraft der Quellen berücksichtigt werden. Jeder Protagonist hat seine Motive, diese müssen in der Auswertung mitgedacht werden. Persönliche Motive wirken in Testamenten oder im Schriftverkehr über Erbstreitigkeiten schwerer, als in einer behördlich erstellten Vermögensübersicht. In letzteren Quellen ist eher die Frage, was eine vermeintlich neutralere Behörde überhaupt erfassen kann. Auch ist darauf hinzuweisen, dass manch Verlassenschaftsakt „stark skartiert“ sein kann.43 Behutsamer Umgang mit den Quellen ist also geboten: einerseits bezüglich etwaiger Verzerrungen und andererseits aufgrund ihrer Lückenhaftigkeit – also was kann eine Quelle überhaupt darstellen? Dies trifft auf die zusätzlich in dieser Arbeit berücksichtigten Quellen in ähnlicher Weise zu. Die Memoiren von Wilhelm Gutmann etwa sind anders zu behandeln als ein offizieller Auszug aus dem Handelsregister, ein Eintrag in einem Schematismus44 oder eine Auflistung im „Compass“, dem damals jährlich erscheinenden „finanziellen Jahrbuch für Österreich-Ungarn“.45
2.3. Methodik
Meine bisherige Untersuchung zu den Gutmanns, in der ich mich wesentlich auf Zeitungsartikel gestützt hatte, machte mich neugierig. Da in Zeitungsartikeln meist wenig konkrete Zahlen zum Reichtum einzelner genannt werden, hob ich das Testament Wilhelm Gutmanns im hilfsbereiten WSTLA aus46, um es auf konkrete Hinweise zum Familienreichtum zu untersuchen, zum einen auf ausgewiesene Beträge, zum anderen auf die Vermögensstruktur.
Das umfangreiche Testament wurde wenig überraschend in Kurrentschrift verfasst, in aufwändiger Transkription47 konnte der größte Teil übersetzt werden. Ohne die spätere Auswertung vorweg nehmen zu wollen, zeigte sich schnell, dass das Testament durchaus einige Informationen enthält. Viele davon scheinen jedoch mehr Fährten auf dem Weg zu einem deutlicheren Bild des Gutmann’schen Reichtums zu sein, als ihn direkt abzubilden. So sind diejenigen Inhalte, die dort angesprochen werden, zwar eindeutig formuliert, ein quantifiziertes Gesamtbild des Vermögens ist im Testament aber nicht anzutreffen. Somit war klar, dass ich zusätzlich den Verlassenschaftsakt einsehen würde.
Dieser besteht aus einer Vielzahl an Schriftstücken, die aufgrund der schieren Fülle nicht alle übersetzt und transkribiert werden konnten. Vielmehr legte ich bei der Auswertung entsprechend des Forschungsinteresses dieser Arbeit den Fokus auf Hinweise zu Vermögensübersichten, deren Struktur und vor allem auf große Werte in Gulden oder Kronen. Dabei ist anzumerken, dass viele Episoden auch um kleinere Beträge durchaus interessant klingen, um weiter erforscht zu werden, diese aber in diesem Rahmen nicht berücksichtigt werden können.
Da ab 1892 in Österreich in einer Währungsreform in einer Übergangsphase von Gulden auf Kronen umgestellt wurde,48 sind in den Quellen beide Währungen zu finden. Gulden werden darin als „ƒ“ oder „fl.“ abgekürzt, Kronen mit „K.“ oder „kr.“. Das Wechselverhältnis 2 Kronen zu 1 Gulden ist selten angeführt, meistens sind entweder Gulden oder Kronen angegeben. Um diese Arbeit übersichtlicher zu gestalten und verschiedene Werte aus verschiedenen Schriftstücken leichter vergleichbar zu machen, werde ich alle Werte in Kronen angeben, vor allem weil 1910 die Reform bereits abgeschlossen war und in besagter Liste der Wiener und Wienerinnen mit den höchsten Einkommen diese Währung ausgewiesen wird. Sollten in direkten Zitaten Gulden genannt sein, werden diese zusätzlich umgerechnet in Kronen ausgewiesen. In dieser Arbeit werden Beträge nicht nur in verschiedenen Währungen sondern auch aus verschiedenen Zeiträumen genannt. Hier zeigt aber der Vergleich des Verbraucherpreisindex, dass in der betrachteten Zeitspanne keine dramatischen Inflations- bzw. Deflationsentwicklungen erkennbar sind.49 Die Beträge sind also wegen der relativ konstanten Entwicklung vergleichbar.
Die in den Hauptquellen genannten Informationen sollten im Falle von Lücken durch Einbeziehung weiterer Quellen ergänzt werden. Diese Ergänzungen können aufgrund des hier eingeschränkten Rahmens einer Bachelorarbeit jedoch nur punktuell erfolgen. Ziel ist, durch die Perspektive der Erbschaft Wilhelms ein Schlaglicht auf das Familienvermögen zu werfen. Bevor endlich die in den Quellen anzutreffenden Hinweise besprochen werden, sollen noch einige Rahmenbedingungen ausgeführt und Informationen aus der Literatur gesammelt werden.
3. Rahmen
Um in weiterer Folge die Ergebnisse der Quellenauswertung in den zeitgenössischen Kontext einordnen zu können, werden in diesem Abschnitt zum einen der allgemeine gesellschaftliche Rahmen abgesteckt. So soll dargelegt werden, was damals die Attribute arm und reich bedeuten. Zusätzlich werden Strategien von Vermögenden und mögliche Strukturen von Vermögen angeführt.
3.1. Reich und Arm
Der „zweifellos reichste Mann Europas“ ist um 1910 Albert Freiherr von Rothschild.50 Damit führt er natürlich auch die Liste der Wienerinnen mit den höchsten Jahreseinkommen an, es verdoppelt sich zwischen 1898 und 1910 von 13 Mio. K. auf 26 Mio. K. Sandgruber schätzt sein bis zu seinem Tod angehäuftes Vermögen „mit Sicherheit“ auf eine Milliarde Kronen. Das entspricht in heutiger Währung grob 6,2 Milliarden Euro.51 An der Spitze der Vermögenden ist ebenso das Oberhaupt der Österreich-Ungarischen Monarchie zu nennen, der Kaiser allein soll über ein jährliches Einkommen von etwa 25 Mio. K. verfügt haben.52 Direkt darunter gab es das äußerst vermögende eine Prozent der Gesellschaft – die Superreichen. Über diese geben neben Sandgrubers die Arbeiten von Pammer, Streller und Stekl Auskunft, jene stützen sich nicht nur – aber wesentlich – auf Verlassenschaftsakte als Quellen. Alle drei zeichnen für ähnliche Zeiträume ein ähnliches Bild.
Pammer etwa untersucht Wiener Unternehmervermögen im Zeitraum zwischen 1852 und 1913. Er weist dort das hinterlassene Vermögen des im Jahr 1874 verstorbenen Vaters von Albert, Anselm Salomon Rothschild, im „exorbitanten Umfang“ von 94 Mio. Gulden [188 Mio. K.] aus.53 Die nachfolgenden sehr hohen Werte „in der Stichprobe liegen bei 19 , 18 und 14 Millionen Gulden, das fünftgrößte Vermögen bereits bei unter fünf Millionen [also 38, 36, 28 und 10 Mio. K.]“.54 Auffällig daran ist hier einerseits, dass innerhalb einer Generation die Wiener Rothschilds offenbar ihr Vermögen enorm vergrößern konnten. Andererseits wird deutlich, dass es an die Spitze der Superreichen nur eine „Handvoll Millionäre“ schaffte.55
Ein ähnliches Bild zeichnet Streller: in ihrer Auswertung von 139 Nachlässen aus dem Jahr 1906 finden sich 15 Kronenmillionäre.56 Deren reichster ist Sigmund Reizes mit einem Nachlassvermögen von 33 Millionen Kronen.57 Genauso wie bei Pammer wird deutlich, dass danach die Vermögen schnell geringer werden, von 10, 9, 7 bis zum fünften Platz von 3 Mio. K. Zusätzlich betont die Autorin, dass im Allgemeinen der „Absolutwert der Vermögen sicher zu gering angegeben“ wurde.58
Stekl zeigt für den Zeitraum von 1885 bis 1899 in der Habsburgermonarchie mehrere Beispiele von Vermögensstrukturen von Bankiers und Großhändlern. Er weist darauf hin, dass die Verlassenschaftsakten des Handelsgerichts Wien „bisher noch nicht systematisch und durchgehend ausgewertet“ wurden.59 Auch er führt einen besonders reichen Protagonisten an, in diesem Fall Moriz Königswarter mit einem Gesamtvermögen von 21 Mio. Gulden [42 Mio K.], die anderen sind weit abgeschlagen mit 1 bis 3 Mio Gulden [2–6 Mio. K.].60 Der Autor fasst zusammen:61
Die „Superreichen“ mit Jahreseinkommen von mehr als 200.000 Kronen waren [...] dünn gesät.
Ich habe diese Beispiele deshalb so ausführlich angeführt, um zu zweierlei zu verdeutlichen. Erstens scheint das Vermögen der Superreichen in der Periode des Spätherbstes K. u. K. Monarchie nur stichprobenartig erforscht, ganzheitliche Aufzählungen gibt es offenbar nicht, alle drei Texte nennen unterschiedliche Namen für nicht identische Zeiträume. Der Vergleich mit Sandgrubers Steuerliste von 1910, die im Unterschied dazu sehr wohl das Steueraufkommen sämtlicher Einkommen – aber eben nicht der Vermögen – abbildet, zeigt mögliche Inkonsistenzen. So hat etwa der hohe Nachlass von Reizes 1906 offenbar nicht dazu geführt, dass ein gleichnamiges Familienmitglied in jener Liste vorkommt. Die Witwe von Moriz Königswarter ist nur auf Platz 722 zu finden.62 Ob dies bedeutet, dass dessen Reichtum sehr vergänglich63 oder schwer fassbar ist, kann hier nicht geklärt werden. Der stichprobenartige Ansatz bedeutet auch, dass sich besonders große Vermögen – berücksichtigte oder unberücksichtigte – auf Berechnungen von Pro-Kopf-Vermögen stark auswirken können.64
Zweitens wird klar, dass ein Vermögen ab etwa 5 Mio. K. ausreicht, um innerhalb des einen obersten Prozentes der Superreichen herauszuragen. So wie heute ist auch im Spätherbst der K.u. K. Monarchie Reichtum besonders ungleich verteilt, nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern genauso innerhalb der Spitzengruppe.65
Das oberste Zehntelpromille der Wiener verdiente im Jahr 1910 etwa 6,4 Prozent aller Einkommen, das oberste Promille 11,9 Prozent, das oberste eine Prozent mehr als ein Viertel und die obersten 10 Prozent mehr als die Hälfte aller Einkommen. Auf die obersten 20 Prozent entfielen zwei Drittel aller Einkommen.
Um jene Millionenbeträge in Relation zum Rest der Bevölkerung zu setzten, soll nun der Blick von der Spitze noch weiter nach unten gerichtet werden. Pammer gibt auf die Frage nach der Entwicklung der Ungleichheit im Zuge der Industrialisierung der Monarchie keine einfache Antwort. Sie habe sich in verschiedenen Regionen unterschiedlich entwickelt. Auch hat sich die Verteilung zunächst verschärft, um in den letzten Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg „wieder ein wenig ausgewogener“ zu sein.66 Dennoch, die Unterschiede zwischen Arm und Reich sind um 1900 dramatisch. Ähnlich zu Stekl nennt Sandgruber – diesmal 100.000 Kronen – „so etwas wie eine Traumzahl“:67
Hunderttausend Kronen. So viel konnte von den meisten Menschen in einem ganzen Leben nicht verdient werden. […] Rund 90 Prozent der Bevölkerung der westlichen Reichshälfte Österreich-Ungarns verdienten im Jahr 1910 weniger als 1.200 Kronen und fielen daher nicht unter die Einkommenssteuerpflicht.
Um dieses „weniger als 1.200 Kronen“ des weitaus größten Teils der Gesellschaft zu verdeutlichen, sind hier wenige Beispiele angeführt, in der bereits gewohnten Richtung von oben nach unten. Ein Direktor eines mittleren Betriebes kann noch 20.000 K. verdienen.68 Ein gut verdienender Akademiker erhält 1905 steuerpflichtige 3.000 K.69 Unter der steuerpflichtigen Grenze finden sich bereits manch Lehrer und Lehrerinnen mit Löhnen zwischen 1.100 K. bis 3.000 K. oder Industriearbeiter und Industriearbeiterinnen mit Löhnen zwischen 500 bis 1.500 K.70 Beschäftigte in der Textilbranche erhielten gar nur 500 bis 600 Kronen im Jahr,71 Dienstboten und Dienstbotinnen vielleicht 100 bis 300 Kronen.72 Diese Jahreslöhne stehen in deutlichem Kontrast zu den weiter oben genannten. Mit einem derartig niedrigen Einkommen konnten viele gar nicht daran denken, Vermögen aufzubauen. An dieser Stelle soll – wie auch schon das Beispiel Rothschild gezeigt hat – darauf hingewiesen werden, dass zwar ein wechselseitiger Zusammenhang zwischen Jahreseinkommen und Höhe eines angehäuften Vermögen besteht73, dieser aber nicht eindeutig und klar quantifizierbar sein muss, vor allem nicht, was einzelne besonders hohe Vermögen betrifft. So hinterließ etwa Theodor Taussig, der 1910 das zweithöchste Jahreseinkommen von 4 Mio. K versteuerte, ein Vermögen von 10 Mio. K., Karl Morawitz, in der Liste auf Platz 22 mit einem Jahreseinkommen von 1 Mio. hingegen 30 Mio. K.74 Auch deshalb scheint ein Blick auf die Erbschaft Wilhelm Gutmanns gerechtfertigt, um nicht nur Jahreseinkommen zu vergleichen.
3.2. Strategien und Struktur
Um diese Vermögen und Einkommen im Folgenden besser beurteilen zu können, sollen damals anzutreffende Vermögensstrategien und -strukturen umrissen werden. Im Unterschied zu meiner bisherigen Arbeit, in der ich durch die Brille der Kapitalsorten nach Bourdieu75 versucht habe, allgemeine Möglichkeiten und Zusammenhänge der Reichtumserlangung und -bewahrung aufzuzeigen76, möchte ich hier den Fokus viel enger wählen, rein auf das ökonomische Kapital beschränkt.
Allgemein gesprochen finden sich um 1900 in Wien und Österreich in verschiedenen Branchen Kronen-Millionäre. Sandgrubers Übersicht zeigt die Anzahl an Millionären in unterschiedlichen Bereichen.77 Jene mit der höchsten Millionärsdichte bzw. dem höchsten Brancheneinkommen sind:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In diesen fünf Bereichen – also Industrie, Handel, Rentiers, Großgrundbesitz und Banken – finden sich die meisten Millionäre, wobei anzumerken ist, dass diese Bereiche nicht gleich vielversprechend sind. So haben etwa nur 82 Bänker ein Brancheneinkommen von 53 Mio untereinander aufzuteilen, aber im Handel muss eine ähnliche Summe auf fast doppelt so viele aufgeteilt werden.78 Umgekehrt zeigt die Ausnahme der Banken, dass in den anderen Branchen der Durchschnitt recht ähnlich ist. Dies lässt vermuten, dass die Branche an sich, sofern man kein Bänker ist, vielleicht nicht den wesentlichsten Faktor darstellt, um ein Spitzeneinkommen zu erreichen. Viel eher scheint die Höhe des Vermögens selbst die Anlageformen zu beeinflussen. Je höher das Vermögen, desto eher rücken laufende Einkommen wie Arbeitseinkommen oder Renten in den Hintergrund, und desto gewichtiger werden Unternehmensbeteiligungen, Immobilien, Privatforderungen, Wertpapiere oder Versicherungsansprüche.79
Ein ähnliches Bild zeigt Streller in ihrer Auswertung von Verlassenschaftsakten von 1906: Wertpapiere und Realitäten dominieren, gelegentlich wird in Lebensversicherungen investiert.80 Manche konzentrieren sich dabei mehr auf eine Strategie, andere diversifizieren ihre Investments um das Risiko zu streuen. So hat der bereits erwähnte Simon Reizes von seinen 33 Mio. Kronen drei Viertel in Wertpapieren angelegt.81 Ein anderes Beispiel findet sich hingegen in Max Springer. Er war zwar durch Finanzspekulation reich geworden, trachtete danach aber sein Vermögen in verschiedenen Bereichen anzulegen.82 So bunt und unterschiedlich die Geschichten der einzelnen Millionäre sind, so verschieden sind auch ihre Strategien. Während die einen ihr Geld in Wertpapiere oder Unternehmen stecken, investieren die anderen in „relativ mobilen und risikolosen Realitätenbesitz“ oder wieder andere in Kunstwerke.83
Drei weitere Aspekte sollen in diesem Zusammenhang angeführt werden. Erstens ist erkennbar, dass im späten 19. Jahrhundert Unternehmer dazu übergehen, neben der Diversifikation vertikale und horizontale Integration vorzunehmen.84 Sie erweitern ihre Unternehmen, in dem sie entweder ihre Konkurrenten in der selben Branche aufkaufen (horizontale Integration), oder branchenverwandte – also vor- und nachgelagerte Betriebe angliedern (vertikale Integration). Dieser Prozess fand etwa in der späthabsburgischen Bergbauindustrie statt, in der es auch zu einer Kartellbildung kam.85 Zweitens wird, in möglicher Nachahmung des alteingesessenen Adels und aufgrund der günstigen Gelegenheit nach der Verschuldung vieler Bauern, Großgrundbesitz in Niederösterreich und der Steiermark für reiche Anwälte, Fabrikanten und Bankiers attraktiv.86 Im sogenannten „Bauernlegen“ erwerben diese großzügigen Landbesitz, um einerseits ökonomische Interessen zu verfolgen oder einfach nur ihren Reichtum zu demonstrieren und somit eher symbolisches Kapital zu generieren.87 Drittens und abschließend ist darauf hinzuweisen, dass zur Bezifferung des Reichtums von Personen oder Familien, die selbst ein Unternehmen führen, nicht nur deren privater Besitz sondern auch das Firmenvermögen berücksichtigt werden muss.88
4. Familie um Wilhelm Gutmann
Um nun von themenfernen Personen und deren Reichtümern den Fokus auf die Familie Gutmann zu lenken, sollen zunächst die Verwandtschaftsverhältnisse rund um Wilhelm Gutmann mit Fokus auf das Jahr seines Todes 1895 skizziert werden89.
Gemeinsam mit seinem Bruder David führt er die Firma „Gebrüder Gutmann“. Aus der Ehe mit seiner ersten Frau Eleonore Latzko stammen die ersten vier Kinder Berthold, Maximilian, Berta und Rosa. Seine zweite Frau Ida Wodianer, aus einer vermögenden und nobilitierten Familie90, gebärt weitere fünf Kinder: Helene, Marianne, Moriz, Elisabeth (Elsa) und Rudolf.91
Die Kindersterblichkeit fordert ihren Tribut, die Kinder Berta und Helene sterben jung. Wilhelms erste Frau Eleonore verstirbt mit 40. Zum Zeitpunkt des Todes Wilhelms 1895 ist die familiäre Situation also folgendermaßen: Berthold, der Erstgeborene ist 39 und hat zu Wilhelms „tiefen Schmerze nicht den vollen Gebrauch seiner Verstandeskräfte erlangt“.92 Max ist 38 und bereits seit 13 Jahren im Familienunternehmen tätig, ab 1888 auch Gesellschafter.93 Sein Hauptgebiet sei „die Führung des Werkes in Witkowitz, doch kümmert er sich natürlich auch um alle anderen industriellen Unternehmungen“.94 Er wirkt als „Großunternehmer in zweiter Generation“ zur Vermehrung des Familienvermögens wesentlich mit.95
Die dreiunddreißigjährige Rosa ist seit 1886 verheiratete „Gräfin“ Fitz-James. Ähnlich ihre Halbschwester Marianne, sie ist nun 24 Jahre alt und seit 1888 „Lady“ Montefiore.96 Die Familie Montefiore war auch mit den Rothschilds verkuppelt, sowohl die Großtante als auch der Sohn des erwähnten reichsten Mannes Europas heirateten in eben diese Familie.97 Moriz, der dreiundzwanzigjährige Halbbruder von Max, ist nicht in der Firma aktiv, er „lebt als Schriftsteller das typische Leben der zweiten Generation, die bereits im Wohlstand aufgewachsen ist“ und wird ein Jahr nach dem Tod seines Vaters wegen „ungenügender Festigkeit des Charakters und physischer Schwäche“ unter Vormundschaft gestellt.98 In der familialen Netzwerkpolitik noch nicht eingespannt, ist die zwischenzeitlich zwanzigjährige Elsa im Sterbejahr ihres Vaters 1895 unverheiratet. Sie wird aber nach dem Tod ihres ersten Mannes Erös de Bethlenfalva, den sie 1899 ehelicht, schlussendlich in der zweiten Ehe im Jahr 1929 Fürstin von Liechtenstein werden. Das letzte Kind Wilhelms ist Rudolf, dieser ist erst 15 Jahre alt, als sein Vater im Haus in der Kantgasse 6 an einer Lungenentzündung stirbt.99
5. Hinweise zum Reichtum der Gutmanns
Auf Wikipedia und anderen Onlineangeboten100 finden sich mehrere Einträge zur Familie Gutmann. Wenig überraschend wird dabei meist deren Wohltätigkeit in den Vordergrund gerückt, deren Reichtum und Investments nur am Rande erfasst.101 Angaben zum Wert der Immobilien oder Unternehmen beziehungsweise zum Ausmaß des Reichtums allgemein werden keine gemacht. Immerhin findet sich dort eine Liste mit den Branchen in denen neben den Kerngeschäften Kohle, Eisen und Stahl weitere Standbeine der Gutmanns geschaffen wurden. Diese Informationen decken sich mit der Forschungsliteratur, so berichtet etwa Gaugusch:102
Aus diesen kleinen Anfängen bildete Wilhelm Gutmann eines der größten Kohleimperien Europas, zusammen mit dem Haus Rothschild war die Firma Gebrüder Gutmann das bedeutendste Großhandlungshaus Österreich - Ungarns. Zum Unternehmen gehörten die Hälfte der Witkowitzer Stahlwerke, umfangreicher Großgrund- und Hausbesitz sowie Beteiligungen an allen Schlüsselindustrien der österreichisch-ungarischen Monarchie. Der sagenhafte Reichtum der Familie war sprichwörtlich, wohl auch deswegen, weil sie bei vielen Gelegenheiten große Summen für wohltätige Zwecke spendete.
Der „sprichwörtliche Reichtum“ wird, wie von einem Lexikoneintrag nicht anders zu erwarten, auch nicht konkretisiert. Vereinzelte Zahlen zum Vermögen finden sich in der Literatur:
Melichar etwa nennt den Kaufpreis der bereits erwähnten „Herrschaft Jaidhof“. 1884 hat Wilhelm diesen Besitz, der zwei Schlösser in Jaidhof und Droß sowie andere Güter in Rehberg und Imbach sowie einen Wald in Panholz umfasst, um 1,7 Mio. Gulden [3,4 Mio. K.] erworben.103 Arnbom nennt im Vergleich dazu Details zum Gut von David, dem Bruder Wilhelms. Dieser „imposante“ Besitz umfasst neben dem Schloss auch „12 Meiereihöfe, eine Zuckerfabrik in Annadorf bei Tobitschau, ein Bräuhaus, eine Malzfabrik und diverse forstwirtschaftliche Besitzungen“. Die Autorin gibt aus Davids Verlassenschaftsakt von 1912 den Wert dieses Gutes mit 1,5 Mio. K. wieder. Außerdem habe er für dessen Umbau 640.000 Gulden [1,3 Mio. K.] aufgewendet.104 Wohl ebenso aus diesem Verlassenschaftsakt stammend nennt Sandgruber Davids gesamtes hinterlassene Nettovermögen von 19 Mio. K.105 Als weiteres Stück im Puzzle des Familienvermögens nennt Arnbom die Erbschaft von Ida Wodianer, der zweiten Ehefrau Wilhelms, die, als sie 1924 verstirbt, 5 Mio. K. hinterlässt.106
Neben diesen Angaben zu Vermögen – als Immobilienbewertungen oder Erbschaften – finden sich punktuell Quantifizierungen von Einnahmen und Ausgaben. Die wesentlichsten Aussagen stammen aus der bereits mehrmals zitierten Steuerliste von 1910. Auf der Seite von Wilhelms Nachkommen versteuert Maximilian 4,5 Mio. K. Jahreseinkommen, sein Halbbruder Rudolf 3,4 Mio. K. Der noch lebende Bruder David verfügt selbst über ein jährliches Einkommen von 3,5 Mio. K.. Auch dessen minderjährige Enkel sind schon Großverdiener – hier wurde eine Generation übersprungen, weil der einzige Sohn Davids früh verstarb: Wilhelm Hermann und Hans Emil sind mit jeweils 1,8 Mio. K. Jahreseinkommen ebenso unter den obersten zehn Bestverdienern.107 An dieser Stelle ist besonders das Beispiel von David hervorzuheben. Er hat 1910 3,5 Mio. Jahreseinkommen und 2 Jahre später 19 Mio. K. Vermögen hinterlassen.
Auch die Gutmann’sche Spendenfreudigkeit wird punktuell quantifiziert. In Wien etwa haben die beiden Brüder Wilhelm und David zur Errichtung der Poliklinik mit 150.000 Gulden [300.000 K.] und des Spitals Rudolfinerhaus mit 100.000 K. beigetragen.108 Das Mädchenwaisenhaus in der Ruthgasse ist auch mit 150.000 Gulden unterstützt worden.109
Zusätzlich tauchen in zeitgenössischen Zeitungen vereinzelte zusammenhanglose weitere Spuren auf: David kauft für 100.000 K. Aktien der Zeitung „Zeit“110, im mutmaßlichen Ämterkauf von Max werden 500.000 K. kolportiert.111 Die aus den Kontext gerissenen und nicht näher geprüften Angaben über die Teilnahme am Bau eines Teilabschnittes der Nordbahn für 4,5 Mio Gulden [9 Mio. K.] oder der Ankaufspreis einer Fabrik in Andritz für 500.000 Gulden [1 Mio. K.] geben höchstens eine Vorstellung davon, in welcher Dimension Gutmanns Ausgaben getätigt haben können.112
Was das Familienunternehmen betrifft, sind in der Literatur kaum umfassende Berichte anzutreffen. Dessen Entwicklung und Aufstieg werden übereinstimmend erzählt.113 Aus dem mährischen Leipnik kommend bauen Wilhelm und David ihr Unternehmen „Gebrüder Gutmann“ seit den 1850iger Jahren in Wien auf, später kommt eine Zweigstelle in Brünn dazu.114 Als Gewinner der Industrialisierung der Habsburgermonarchie im 19. Jahrhundert etablieren sie ihr Hauptgeschäft in der aufstrebenden Transport und Montanindustrie. Gutmanns sind im Kohlehandel aktiv, zu jener Zeit eine Branche mit viel Potential reich zu werden.115 Die vertikale Integration von Kohleförderung, Transport nach und Handel in Wien beflügelt die Entwicklung des Unternehmens. 1910 stehen sie nach Sandgruber „im Einkommensranking gleich hinter den Rothschilds“ und waren somit zweitreichste Familie in der Reichshauptstadt.116 Mit Rothschilds gibt es nicht nur familiale Netzwerkverbindungen über die Umwege Wodianer oder die schon erwähnten Montefiore117. Durch die handfesten direkten Geschäftsverbindungen Rothschild–Gutmann monopolisieren sie die Wiener Kohleversorgung. Ab 1872 steigen Gutmanns auch in das Rothschild’sche Eisenwerk Witkowitz in Mähren ein und verfügen über die Hälfte der Kuxe, also Anteile am Werk. Beide Familien bauen das Werk aus und versuchen durch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen die Produktivität zu erhöhen.118 An der machtvollen Position wird auch Kritik geübt, etwa durch Victor Adler. Er bezeichnet die Verbindung der beiden Familien und dem Grafen Wilczek wie folgt:119
Das Königreich Rothschild - Gutmann - Wilczek rund um Ostrau und Witkowitz bildete gleichsam einen Staat im Staate: „Diese Könige haben ihre eigene Verfassung, ihre eigenen Fabriks- und Grubenordnungen; sie prägen ihr eigenes Geld, sie drucken ihre eigenen Banknoten, ‚Kreditanweisungen‘ genannt. Natürlich treiben sie auch ihre eigene Politik und üben ihre eigene Polizei und Zensur.
Diese königgleiche Übermacht entsteht durch Kartellbildung. Um 1880 gibt es nur 5 wesentliche Eisenproduzenten in Österreich-Ungarn. In der Steiermark ist die Österreichisch-Alpine Montangesellschaft, die anderen vier in den heutigen tschechischen Gebieten. Die Witkowitzer Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft „was in a class by itself“.120 Um 1880 produziert sie allein 36% des böhmischen Eisenausstoßes. Dieser kann bis 1911 auf 50% gesteigert werden, die Versuche zur Produktivitätssteigerung haben offenbar gefruchtet. Auch die Anzahl der Beschäftigten stieg bis 1911 enorm. Seit dem Einstieg der Gutmanns hat sie sich versiebenfacht. Die Steigerung der Produktion wird auch in einem Bericht deutlich, der vom Betrieb selbst zur Hundertjahrfeier herausgegeben wurde. Sie erscheint darauf in einigen Bereichen fast exponentiell.121 Deutlich wird in diesem Bericht auch, dass in Witkowitz nicht nur Roheisen und Rohstahl produziert, sondern diese auch weiterverarbeitet werden: gegossen, geschmiedet oder gewalzt. Auch das feuerfeste Material Schamotte wird hergestellt.
Das zum größten Hüttenwerk der Habsburgermonarchie ausgebaute Unternehmen wird zwar „im Reigen der großen Eisenhütten der Habsburgermonarchie von den Wirtschaftshistorikern immer ein bisschen unterschätzt, nicht zuletzt deswegen, weil es keine Aktiengesellschaft und daher nicht publikationspflichtig war“, stellte aber sowohl für Rothschild als auch für Gutmann ein wesentliches oder vielleicht gar das wichtigste Stück des Industrieimperiums dar.122
Welche Bedeutung hat das „Juwel“ Witkowitz nun aber im Portfolio der Rothschilds beziehungsweise Gutmanns? Sandgruber versucht sich dieser Frage anzunähern. Zunächst nennt er den Kaufpreis, den Salomon Rothschild 1843 zahlt, mit 321.000 Gulden [642.000 K.].123 Das wegen mangelnder Investitionen veraltete Werk benötigt Kapital, nun kommt Wilhelm Gutmann 1872 ins Spiel. Er erwirbt 50 der 100 Kuxen. Zu welchem Preis bleibt unklar. Im Ersten Weltkrieg werden dort auch Rüstungsgüter produziert.124 Danach lag das Werk aus österreichischer Perspektive im Ausland, was zwar nicht die Besitzverhältnisse ändert, aber die Währung, in der das Grundkapital angegeben wird, nämlich 600 Mio. Tschechenkronen [Kc.].125 Die Dividenden, die in den 1920igern nach Wien gehen, belaufen sich auf 40 bis 60 Mio. Kc.126 Schwere Verluste des Werkes am Anfang der 1930iger Jahre führten dazu, dass die Gutmanns ihre Anteile an die Londoner Rothschilds verkauften. Schlussendlich pressen die Nationalsozialisten Louis Rothschild das Werk entgegen dessen Vorstellung von 10 Mio. für 2,75 Mio. Pfund ab, die aber nie bezahlt werden.127 Sandgruber nennt also aus der Perspektive Rothschild einige Zahlen zum Unternehmen Witkowitz, für diese Arbeit sind sie jedoch wenig hilfreich. Zum einen betreffen sie einen Zeitraum, der außerhalb des betrachteten liegt. Zweitens sind Umrechnungen der Währungen gerade in der ersten Jahren nach dem Krieg wenig zuverlässig.128
Die Unklarheiten zum wichtigen Bestandteil Witkowitz sollen jedoch nicht den Blick auf die abseits davon betriebenen Geschäfte der „Unternehmerdynastie Gutmann“ verstellen.129 Arnbom findet klare Worte:130
Man ist Produzent, Händler und teilweise auch Verwerter - umfassender kann ein Wirtschaftsimperium nicht konzipiert sein. […] Die Brüder Gutmann kaufen im Laufe der folgenden Jahre mehrere Kohlengruben auf, unter anderem auch von den Rothschilds, und beginnen, ein wahres Firmenimperium einzurichten - von Schamotte über Zucker, Waggons, Weberei bis zum eigenen Schiffspark gehen die Aktivitäten, es gibt kaum eine Branche, in der die Gutmanns nicht präsent sind.
Sowohl vertikale als auch horizontale Integration – hier im Aufkaufen von Kohlegruben der auch mal als Konkurrent entgegentretenden Rothschilds – genauso wie Diversifizierung in verschiedenen Branchen, Gutmanns tätigen vielfältige Investitionen.
Wie aus Wilhelms Memoiren hervorgeht, hängen viele der Branchen aber zusammen. Die eigene Kohle wird mit der eigenen Bahn transportiert und in der eigenen Zuckerfabrik verheizt. Auch die Schamottsteine werden benötigt, wie Wilhelm in seinen Memoiren festhält:131
Die Fabrication feuerfester Waaren in einer neuen, vollkommen modern eingerichteten Chamottefabrik deckt den eigenen und den Bedarf der umliegenden Industrien des hiesigen Revieres.
Auch wird zur Produktionssteigerung eines Betriebes schon mal ein benachbartes Gut samt Spirituosenproduktion erworben:132
Wir mussten, um mehr Autorität den Arbeitern gegenüber zu besitzen, die Herrschaft Jaworzno erwerben, da dieselbe auch die Propinationsberechtigung hat und wir dadurch dem übermässigen Branntweingenusse wirksam entgegentreten konnten.
Aber die Familie investiert auch anderen Branchen, die thematisch weiter entfernt sind. So sind sie etwa an einer Jute–Spinnerei in Neufeld „ansehnlich beteiligt“ oder bauen eine Zellulosefabrik.133 Gutmanns gehen dadurch ein gewisses Risiko ein:134
Im Jahre 1882 haben wir [...] eine grosse Cellulosefabrik in Rattimau errichtet, welche heute [...] zu den grössten und besteingerichteten Fabriken dieser Art in Oesterreich, vielleicht auf dem Continente zählt. Dass wir auch hierin die Erfahrungen, welche wir beim Eintritte in das Geschäft noch nicht hatten, mit manchen schweren Verlusten und Sorgen erkaufen mussten, wird man selbstverständlich finden, und sind wir heute glücklich, die Fabrik wohleingerichtet und wohlgeleitet zu finden, hoffend, dass die gewonnenen Erfahrungen die gehabten Verluste wieder einbringen werden.
Auch nach Wilhelms Tod erwirbt die Familie neue Betriebe nach den ursprünglichen Mustern. Die bereits genannte Maschinenfabrik Andritz kann einerseits als weiters Beispiel für die fortgesetzte vertikale Integration dienen, denn ihre „Spezialität [...] bildet die Herstellung von Betriebsanlagen für Brauereien, Spiritusbrennereien u. s. w.“.135 Andererseits ist ihr Erwerb durch „ein Konsortium, dem die Firma Gebrüder Gutmann angehören und dessen technischer Konsulent Baron Ferstl [sic]“ auch Beispiel für familiale Vernetzung, hier mit der Familie Ferstel.136 Als zusätzliches Beispiel für Diversifizierung post Wilhelm kann der Erwerb der Textilfirma „Vöslauer Kammgarnfabrik“ um 1900 dienen.137
Den meisten dieser Beispielen ist gemein, dass – in diesem Rahmen – nur selten Kaufpreise oder andere Möglichkeiten auffindbar sind, um den Wert dieser Unternehmen zu beziffern. Auch Wilhelm selbst hält sich meistens bedeckt. Zwar zählt er mit Freude seine unzähligen Unternehmungen auf, aber nur an zwei Stellen nennt er Zahlen. Einmal als seine Zuckerfabrik im heutigen slowakischen Sládkovičovo deutlich mehr Kapital – etwa 4,6 Mio. K. – verschlingt als erwartet:138
Es waren für dieses Unternehmen 4-500.000 Gulden präliminirt. Wir kamen nachher bis weit über zwei Millionen und unsere bevollmächtigten Herren in Dioszegh verlangten weitere Zuschüsse von 300.000 fl.
Das zweite Mal wird sein unwiderstehliches Kaufanbot erst nach Einschreiten Rothschilds angenommen: das seines Erachtens nach unproduktive Kohlewerk in Pechnik kann er erst nach einem Jahr Wartezeit und durch soziale Beziehungen erwerben. Sein Angebot allein reicht offenbar nicht aus, um die Verkäufer zu überzeugen, obwohl er doch den „vollen Werth für ein passives Werk“ von 750.000 Gulden [1,5. Mio. K.] geboten hat.139 Dass Wilhelm zwanzig Jahre später beim Verfassen seiner Memoiren noch immer etwas gekränkte Eitelkeit durchschimmern lässt oder vielleicht andere Beweggründe hat, diese Zahlen zu nennen, ist hier nebensächlich. Ein weiteres Mal sind nur Spuren des Gutmann’schen Reichtums zu finden, ein Gesamtbild ist nicht zu erkennen.140
Ein wesentlicher Grund dafür, dass das gesamte Firmenvermögen schwer fassbar ist, liegt sicher auch im Umstand, dass die Firma „Gebrüder Gutmann“ eine Kommanditgesellschaft war. Nach Wilhelms Tod sind deren alleinige Gesellschafter zunächst David und sein Neffe Max für das Jahr 1905 aufgelistet.141 Fünf Jahre später sind zwei weitere Kommanditgesellschafter hinzugekommen: Max’ Halbbruder Rudolf und der Freiherr Siegwart von Mayer-Ketschendorf.142
Im Gegensatz zur Aktiengesellschaft, die den Aktionären Rechenschaft ablegen muss, sind hier die Gesellschafter nur sich selbst und etwaigen Geldgebern verpflichtet. Die Firma unterliegt keiner Publizitätspflicht. Ohne Zugang zu internen Firmenaufzeichnungen ist das Firmenvermögen der Firma „Gebrüder Gutmann“ nicht umfassend zu bestimmen.
Dass die Gutmanns die Öffentlichkeit der Gesellschaftsform der „Actien-Gesellschaft“ nicht speziell vermeiden, wird an einigen Beispielen deutlich. Wilhelm selbst beschreibt, dass diese Form auch für die „Witkowitzer Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft“ vorgesehen ist, der Börsengang schlussendlich aber nicht vollzogen wird.143 Eine stichprobenartige Untersuchung der Compass– Ausgaben zeigt im Jahr 1894, dass David und Max im „Verwaltungsrath“ der „Kremser Gasbeleuchtungs-Gesellschaft“ mit einem „Actien-Capital [von] fl. 140.000“ [280.000 K.] sitzen, und Wilhelm alleine in der „Actiengesellschaft der Wien-Floridsdorfer Mineralöl-Fabrik“ mit einem Kapital von „fl. 700.000“ [1,4 Mio. K.].144 Ähnliche Beispiele finden sich auch im Jahr 1873: hier scheint Wilhelm gemeinsam mit Hermann Todesco oder Hermann Springer (neben anderen) im Verwaltungsrat der „Oesterreichischen Rückversicherungs-Gesellschaft“ und der „Allgemeinen Transport-Versicherungs-Gesellschaft“ auf.145 Freilich muss ein Sitz in der Verwaltung nicht bedeuten, dass dessen Inhaber auch Anteil an der jeweiligen Firma hält. Diese Fährten müssen jedoch in einem anderen Rahmen verfolgt werden, hier möchte ich mich auf die Erbschaft Wilhelms konzentrieren. Die Positionen in den Aufsichtsräten und vielleicht damit verbundene Firmenanteile können hier nur zur Abrundung des Bildes dienen.
Ein weiterer Grund, der die Erfassung des Firmenvermögens erschwert, ist die Verschachtelung der Eigentümerschaften. Nicht nur der Erwerb von sozialem Kapital in den bereits angesprochenen familialen oder anderen Netzwerken – Wilhelm gründete etwa den „Industriellen Club“, den Vorläufer der heutigen Industriellenvereinigung – ist wichtig.146 Nicht nur Kartellbildungen schaffen Vorteile, auch handfeste persönliche ökonomische Verbindungen werden gepflegt. In seinen Memoiren nennt Wilhelm mehrere Beispiele, eines davon, die bereits erwähnte Zuckerfabrik in Dioszegh, soll hier wiedergegeben werden:147
Im Jahre 1867 haben wir mit der Firma Ignaz und Jacob Kuffner eine Zuckerfabrik in Dioszegh errichtet, grösstentheils aus dem Grunde, weil wir und unser uns unvergesslicher Freund Ignaz v. Kuffner den Wunsch hatten, ein gemeinsames industrielles Unternehmen zu besitzen und durch die gemeinsame Thätigkeit Veranlassung zu haben, uns öfter zu sehen.
Auch das Beispiel der Andritzer Maschinenfabrik verdeutlicht personelle Verknüpfung und unternehmerische Verschachtelung. Wie oben schon berichtet, schreibt das Grazer Tagblatt 1899 von einem Konsortium, an dem auch die Firma „Gebrüder Gutmann“ beteiligt ist. Dennoch findet sich im Compass von 1912 keine namentliche Erwähnung, nur der familial verbundene Karl Ferstel scheint auf.148 Das Kapital dieses Unternehmens wird mit 2 Mio. K. angeben, eine Steigerung zum kolportierten Kaufpreis von 500.000 K. in etwa 10 Jahren. Dieses Beispiel verdeutlicht das unübersichtliche Geflecht an Mehrheits- und Minderheitsaktionären dieser Aktiengesellschaften.149
Unklarheit herrscht auch bezüglich einer anderen Vermögensstrategie: dem Erwerb von Grundbesitz und Immobilien. Diese Realitäten können entweder dazu erworben werden, um tatsächliche finanzielle Einkünfte zu entwickeln. In anderen Fällen werden sie aber nicht zur Vermögensvermehrung etwa in Zinshäusern oder Grundspekulation erworben, sondern für den Eigenbedarf genutzt.150 Sie können also schlicht nur dazu dienen, standesgemäß am Wiener Ring zu wohnen oder die Möglichkeit eröffnen, auf eine „Villa im Grünen“ ausweichen zu können.151 Manche Superreiche, wie etwa die Wittgensteins oder Rothschilds, zwar ökonomisch dem Agrarsektor fern, krönten „ihre Karriere mit dem Kauf eines Gutes“ – einfach weil sie es konnten.152 Sie zeigten so Ihren Reichtum und nutzten das Gut noch allenfalls für soziale Ereignisse zur Vernetzung etwa bei Jagdgesellschaften.153 Zumindest im Fall der Rothschilds hat der „große Grundbesitz hingegen mehr gekostet, als er einbrachte“.154
Auch die Gutmanns kauften Realitäten: Wilhelm die Herrschaft samt zweier Schlösser in Jaidhof in Niederösterreich mit 9355 Hektar155, David das Gut mit einem Schloss in Tobitschau nahe seiner Heimat in Mähren. In Wien lassen die beiden Ringstraßen-Palais errichten: Wilhelm lebt mit seiner Frau Ida in der Kantgasse 6156, David ganz in der Nähe des Palais Rothschild am Schwarzenberg-Platz 13157. Zur Sommerfrische bauen die beiden in Baden je eine Villa, Wilhelm in der Helenenstraße 72, David in der Weilburgstraße 16.158 Die Firma „Gebrüder Gutmann“ besitzt mehrere Adressen in Wien: ein Haus weiter im selben Block vom Wohnsitz Wilhelms und Idas am Kolowratring 5159, an der Oberen Donaustraße 111160 und am Erzherzog Carl-Platz 1161.
In der nächsten Generation kauft Emilie Gutmann, Max Ehefrau, im Jahr 1896 die „Gutmann-Villa“ in der Colloredogasse 24 Ecke Cottagegasse 50.162 Wenige Jahre später listet Lenobel neben Emilie auch Max als Eigentümer im 18. Bezirk. Seine Liegenschaft Colloredogasse 22 ist direkt an jene seiner Frau angrenzend, eine andere in der Cottagegasse 19 nicht ganz so nahe.163 Später erwerben Max und Rudolf im Jahr 1923 die Liegenschaft Weimarer Straße 83 Ecke Lannerstraße 21 im 19. Bezirk.164 Auch Moriz Gutmann kauft sich 1901 ein Schloss in Bad Vöslau samt Fläche von 372 Hektar.165 Rudolf besitzt ein Schloss in Gießhübl, baut sich aber auf seinem 1904 erworbenen Land (5803 Hektar) in Kalwang in der Steiermark ein neues.166 Auch Max kauft in der Steiermark, sein Gut In der Strechen umfaßt 5132 Hektar.167
Den Wert all dieser Immobilien zu bestimmen, kann hier – abseits der bereits genannten Beträge zu den Schlössern – nicht vorgenommen werden.168 Dennoch stellt sich die Frage, ob Familie Gutmann ihre Realitäten nur zum Eigenbedarf und Repräsentation von Reichtum erwerben, oder ob sie diese auch als Investment sehen. Die Immobilien in Wien fallen wahrscheinlich in die erste Kategorie. Bei den Grundherrlichkeiten in Jaidhof und Tobitschau ist die Frage nicht so einfach zu beantworten. Waren die Güter wie bei Rothschild ein Verlustgeschäft? Das Ausmaß der Grundbesitzes ist jedenfalls sehr umfangreich. Sandgruber und Arnbom schreiben, dass die Familie Gutmann „zu Beginn des Ersten Weltkriegs um die 50.000 Hektar an Grund und Boden“ besitzt.169 Ab einer Fläche von 1000 Hektar gehört man zu den Großgrundbesitzern.170 In einer Übersicht zu Niederösterreich für das Jahr 1908 ist das Gut Jaidhof das zweitgrößte.171 Das noch größere umfasst 31.000 Hektar und ist wenig überraschend im Besitz von Albert Rothschild.172 Die Familie Gutmann kann also ohne Zweifel als Großgrundbesitzerin bezeichnet werden.
Zur flächenmäßigen Bewertung des Gutes Tobitschau von David konnte ich keine Hinweise finden. Dennoch lässt die Beschreibung Arnboms vermuten, dass dieses – ebenso wie Wilhelms Anwesen – recht umfangreich ist. Mehr noch, hier ist die Rede von Zucker- und Bierproduktion, das Ziel Einkünfte zu generieren naheliegend. Auch mögliche strategische Gründe für den Erwerb von Gütern – zur Kontrolle der Arbeiterschaft – wurden weiter oben bereits deutlich. Ob Gutmanns im Unterschied zu Rothschilds ihren enormen Grundbesitz nicht nur zur Repräsentation ihres Reichtums oder aus strategischem Kalkül sondern auch zur Erzielung von Gewinnen einzusetzen vermögen, ist weiterhin unklar.
Die vielen angeführten Beispiele scheinen zu bestätigen, dass um 1910 Gutmanns „im Einkommensranking gleich hinter den Rothschilds stehen“.173 Dennoch zeigen sie auch, dass sich diese Einschätzung eher auf punktuelle Auswertungen stützt. Der Versuch, den Gutmann’schen Reichtum wissenschaftlich und vollumfänglich zu erfassen, scheint noch nicht unternommen. Ein Gesamtbild wie bei den Rothschilds mangelt meines Erachtens nach an folgenden Bestandteilen: Sandgruber hat das Vermögen Davids zum Zeitpunkt seines Todes unter Einbeziehung des Verlassenschaftsaktes mit 19. Mio. K. angegeben. Wie groß die Erbschaft seines Bruders Wilhelm ist, scheint bisher in keiner mir bekannten Untersuchung berücksichtigt oder ausgewiesen. Neben diesen zwei wesentlichen Bestandteilen des Familienvermögens zeigt sich das Firmenvermögen – wie oben ausgeführt – als schwer fassbar. Wie oben auch deutlich wurde, ist Reichtum vergänglich, eine große Erbschaft kann wenige Jahre später zu wenig auffälligem Einkommen führen. Andererseits hat etwa Rothschild sein Einkommen in einem Jahrzehnt verdoppelt. Deshalb ist auch die Quantifizierung des Besitzes der Hinterbliebenen zur Beurteilung des Familienvermögens nötig. Zwar ist die Erbschaft von Ida – immerhin 5 Mio. K. – bekannt, der Reichtum von Wilhelms Söhnen Max und Rudolf beziehungsweise der Enkel Davids ist bisher nicht beziffert.
In weiterer Folge möchte ich mich deshalb einer der Lücken widmen: der Erbschaft Wilhelms. Vielleicht finden sich hier nicht nur Hinweise auf das Privatvermögen Wilhelms, sondern auch solche zur Bewertung des Firmenvermögens.
6. Dem Reichtum auf der Spur
In diesem Abschnitt sollen anhand des Testaments Wilhelm Gutmanns und der daraus abgeleiteten Abhandlung, welche im Verlassenschaftsakt dokumentiert ist, zusätzliche Hinweise auf dessen Vermögen gesammelt werden.
6.1. Testament Wilhelms
In seinem Testament spricht Wilhelm „im vollen Besitz meiner Geisteskräfte“ zur Nachwelt.174 Es umfasst 23 Seiten und ist in 20 Abschnitte unterteilt, welche oft nur aus wenigen Sätzen bestehen, manchmal aber mehrere Seiten umfassen. Neben allfälligen religiösen Aussagen, wendet sich Wilhelm an seine Kinder:175
Euch meine geliebten Kinder rufe ich an dieser Stelle zu: Thut Allezeit Eure Pflicht und bestrebet Euch, Tüchtiges zu leisten und Bedeutendes zu schaffen. Das größte, das einzige wirkliche Vergnügen entspringt aus der Intention vorerst in der Familie, dann aber Jedem, dem Ihr, meine geliebten Kinder, begegnen werdet, nach Möglichkeit angenehm und nützlich zu sein; in dem Maße, als dieses Euch thatsächlich gelingt, erhöht sich das immer beglückende Selbstbewusstsein der Unsterblichkeit.
Pflichtbewusstsein und Tüchtigkeit sind ihm offenbar wichtige Werte. Eine nähere Auswertung aus erfahrungsgeschichtlicher Perspektive muss an dieser Stelle aber ausbleiben.
Die zwei umfassendsten Abschnitte handeln von dem Teil seines Erbes, das er seinen Töchtern und Berthold zukommen lassen will. In beiden wird deutlich, dass Wilhelm sehr genaue Vorstellungen hat, und diese auch exakt und umfänglich aufschlüsselt. So wird zum Beispiel beschrieben, welche Tochter schon früher zu ihrer Hochzeit einen Teil des vorgezogenen Erbes erhalten hat. Auch die noch unverheiratete „Elsa“ wird versorgt. Wilhelm bestimmt ausführlich, wie deren Anteil von „ƒ 1,500.000.- in Worten: Eine Million fünfmalhunderttausend Gulden österr. Währung“ [3 Mio. K.] verwaltet werden soll. Die eine Hälfte erhält sie zum „freien Eigenthume“, die andere Hälfte als „fideicommissarische Substitution“. Sie darf Einkünfte aus dem Vermögen nutzen, dieses aber nicht verbrauchen und muss es ihren Kindern oder Geschwistern hinterlassen. Es soll jedes Jahr um 4% erhöht werden. Wilhelm rechnet dies sogar eigenhändig für die nachfolgenden 4 Jahre exemplarisch vor.176 Die anderen Töchter werden – etwaige Vorleistungen abgezogen – in ähnlichem Ausmaß bedacht.
Noch umfangreicher ist der Abschnitt über den Anteil des beeinträchtigten Berthold, der ebenso 1,5. Mio. Gulden [3 Mio. K.] umfasst. Über sechs Seiten bestimmt Wilhelm Zinssätze, Vormundschaften und Stiftungskonstruktionen bis über den Tod seines Sohnes hinaus, um nichts dem Zufall zu überlassen.177 Diese Detailverliebtheit steht in krassem Gegensatz zum Umfang anderer Abschnitte, etwa dem zu Moriz:178
Meinem Sohne Moritz Ritter von Gutmann vermache ich anstelle seines Pflicht- und Erbtheiles ein Capital von ƒ 2,000.000.- sage Zwei Millionen Gulden österr. Währung. [4 Mio. K.]
Hier ist in einem Satz alles gesagt. Auch an nachfolgender Stelle ist Wilhelm kurz und prägnant:179
Zu meinen Erben ernenne ich meine vielgeliebten Söhne Maximilian und Rudolf unter einander zu gleichen Theilen und sollen diese den ihren als Erbe zufallenden Nachlass in der Weise theilen, dass ausschließlich meinem Sohne Maximilian mein Geschäftsantheil bei der Firma Gebrüder Gutmann zur Gänze zugewiesen wird, wogegen der meinem Sohne Rudolf zukommende Erbtheil aus meinem anderweitigem Nachlassvermögen zu decken sein wird.
Die Aufteilung seines Hauptvermögens soll also zu gleichen Teilen an die „Universalerben“ Max und Rudolf gehen, wobei nur Max, solange Rudolf minderjährig ist, an der Firma beteiligt werden soll:180
Ich wünsche, dass mein Sohn Maximilian die zwischen mir und meinem Bruder David bestehende Gesellschaft unter unveränderter Firma fortführen soll. Meinem Sohn Rudolf möge seinerzeit bei entsprechender Qualifikation und nach erreichter Großjährigkeit die Betheiligung in der Firma offen gehalten werden. Die Führung der Handelsgeschäfte muss in der bewährten streng kaufmännischen Weise erfolgen.
Etwaige anfallende Kosten der Erbschaft sollen „nur mittelst der meinen Nachlass bildenden Objekte geleistet werden“. Sein Privatvermögen beschreibt er so:181
a) die in meinem Nachlasse vorfindlichen Staatlichen und öffentlichen Fondpapiere, Prioritäthen, Pfandbriefe, Eisenbahnaktien und Industriepapiere
b) die ganz oder theilweise mir gehörigen Güter, Häuser und Realitäten
c) der in meinen Nachlass gehörige Theil der Montanbesitzes der Firma Gebrüder Gutmann
d) der in meinen Nachlass gehörigen Dinge
Wie viel Vermögen diese darstellen, wird im Unterschied zu den obigen minutiösen Ausführungen nicht angegeben. Es scheint eine Verquickung zwischen Firmenvermögen und Privatvermögen zu geben. Dies wird etwa deutlich, wenn Wilhelm seiner Frau Ida ein „Capital von ƒ 1,000.000.-“ [2 Mio. K.] hinterlässt, welches aber bei der Firma angelegt bleiben soll, sie erhält – ähnlich wie Elsa – nur die Zinsen davon und darf es erst nach Ihrem Tod an die gemeinsamen Kinder weitergeben .182 Ein anderes Mal betont Wilhelm, dass das Privatvermögen seiner Gattin und Kinder von diesem Testament ausgenommen sind, was „aus den Geschäftsbüchern der Firma und den übrigen Behältern mit voller Bestimmtheit zu ersehen sein“.183 Offenbar ist die Trennung zwischen Firmenvermögen und Privatvermögen wichtig, dazwischen gibt es aber Verbindungen. Dieses Spannungsfeld Trennung-Verbindung von Vermögen wird am Beispiel des oben aufgezählten Montanbesitzes deutlich. Ein Teil davon ist offenbar in Wilhelms Privatbesitz. Dort befindet sich auch das Gut Jaidhof, andere Realitäten werden nicht erwähnt, wie etwa die Villa in Baden oder die Firmengebäude.184
Hinweise auf den Umfang des gesamten Privatvermögens Wilhelms oder gar des Unternehmensvermögens sind im Testament keine anzutreffen. Deutlich wird aber aufgrund der unterschiedlichen Ausführlichkeit, dass Wilhelm manches genau geregelt wissen wollte, anderes vielleicht schon ausreichend geregelt war, um es im Testament bei kurzen allgemeinen Phrasen zu belassen. Die Nachfolge Max und Rudolfs im Unternehmen wird zwar formuliert, aber zu diesem Zeitpunkt war Max bereits Gesellschafter. Ich kann mir schwer vorstellen, dass der detailverliebte Wilhelm in der Firma nicht auch schon Vorkehrungen für einen reibungslosen Verlauf „in der bewährten streng kaufmännischen Weise“ getroffen hat. Hier könnten nicht nur Verantwortlichkeiten sondern auch Vermögenswerte schon vorher übergeben worden sein, immerhin wirkte Max ja schon einige Jahre mit. Auch die verehelichten Töchter haben vorab Erbanteile bekommen.
Anzumerken ist auch die so oft gerühmte Wohltätigkeit Wilhelms. Er verfügt, dass manch Diener und weitere Beamte seiner Firma ein paar hundert bis tausend Gulden erhalten sollen. Zusätzlich denkt er an die konfessionslose Armenfürsorge185, ein öfters anzutreffender Zugang vor allem jüdischer Unternehmer:186
Am Tage meines Ablebens oder so bald als möglich nach demselben sollen ƒ 10.000.- in Worten Zehntausend Gulden österr. Währung [20.000 K.] von meinen Universalerben nach ihrem Ermessen an Arme ohne Unterschied der Confession vertheilt werden.
Anschließend möchte ich noch kurz auf das Testaments von David, der 1912 verstarb, eingehen. Zwar ist durch den Verlassenschaftsakt sein gesamtes hinterlassenes Erbe beziffert, es scheint aber manch Eindruck aus Wilhelms Testament zu bestätigen. So sollen seine Enkel, die Kinder seines frühzeitig verstorbenen Sohnes aus Erträgen seiner Wertpapiere versorgt werden. Er fügt aber hinzu, dass „der Geschäftsbetrieb der Firma Gebrüd. Gutmann jedoch nie durch die Verwertung der Ueberschüsse beeinträchtigt werden“ darf.187 Hier scheint wieder eine Verbindung von Firmenkapital und privaten Einkünften auf. Was die Firmengeschäfte selbst betrifft, schreibt David, dass seine „geliebten Neffen und Mitgesellschafter in der Firma Gebrüd. Gutmann, die Herren Max und Rudolf Ritter von Gutmann […] voraussichtlich nach meinem Tode ohnehin als leitende Chefs der Firma“ tätig sein werden.188 Auch hier kann gefragt werden, ob die voraussichtliche Firmenführung tatsächlich erst nach seinem Tod fixiert wird. In einem derart umfangreichen Unternehmen scheint mir nicht das Wort „voraussichtlich“, sondern das Wort „ohnehin“ aussagekräftiger. Nebenbei sei erwähnt, dass David seine Töchter nicht so reichlich beerbt wie Wilhelm, sie bekommen nur je 1 Mio. K.189
Zusammenfassend möchte ich klar stellen: Dass die Trennung zwischen Firmenvermögen und Privatvermögen in einer Unternehmerdynastie unscharf ist, ist naheliegend und wenig überraschend. Wichtig an dieser Stelle ist aber die Frage, wie vollumfänglich eine Erbschaft den Reichtum eines Menschen oder Familie abbilden kann, falls – zur Sicherstellung eines reibungslosen Betriebes völlig nachvollziehbar – schon vor dem Tod Unternehmensvermögen übergeben wurde.
6.2. Verlassenschaftsakt
Der Verlassenschaftsakt zu Wilhelm Gutmann ist sehr umfangreich. Er umfasst mehr als 1000 Seiten.190 Auch zeitlich erstreckt sich das Konvolut über einen Zeitraum von 1895 bis 1941. Offenbar hatten auch nationalsozialistische Behörden Interesse an der „Urschrift der Einantwortungsurkunde ON 385“.191 Freilich stammt der Großteil der Schriftstücke aus 1901, das Jahr, in dem die gerichtliche Übergabe der Verlassenschaft in den rechtlichen Besitz der Erben übergeht, also die sogenannte Einantwortung des Erbes. Zwischenzeitlich ist auch Elsa verheiratet und zeichnet in einer ihren Eingaben an das Gericht als „Elsa Erös von Bethlenfalva gebor. Edle von Gutmann“.192 Die einzelnen Schriftstücke sind nummeriert. Sie sind dem Akt mit der Geschäftszahl (GZ) 53-6-95 zugeordnet und nach fortlaufenden Ordnungszahlen (OZ) von 341-463 nummeriert.193 Der Akt scheint vollständig, eine Skartierung somit unwahrscheinlich.
Das Konvolut enthält Schriftstücke sehr unterschiedlicher Natur. Fristverlängerungen, umfassende Stellungnahmen, kürzere Noten, Rekurse, Zeitungsausschnitte, Quittungen, Auflistungen, Geschäfts- und Revisionsberichte – ausführlich etwa zum Erbteil Bertholds – oder Depositenscheine – um nur einige zu nennen. Wilhelms detaillierte Planung zeigt sich nun in ihrer Ausführung: etwa in der exakten Aufschlüsselung des Aktivbestandes von Elsas Substitutionsvermögen von 1,7 Mio. K.194 Das erneute Auftauchen dieses Betrages ist jedoch der Suche nach dem Gesamtvermögen nicht dienlich, er ist aus dem Testament schon bekannt.
Im Verlassenschaftsakt ist eine umfassende Inventarisierung des Erbes aus mehreren Gründen zu erwarten. Zum einen ist einer der Haupterben – Rudolf – noch minderjährig, an einigen Stellen zeichnet seine Mutter und „Vormunderin“ Ida.195 Im Allgemeinen scheinen die Kinder mit der vorgesehenen Aufteilung des Erbes einverstanden. Zu manchen Details schriftlich Stellung zu nehmen, sehen sie sich offenbar dennoch genötigt. So finden sich im Akt einige Schreiben, die Auffassungsdifferenzen aufzeigen. Marianne Montefiore etwa zweifelt an der Berechnung ihres Erbanteiles und übermittelt dem Gericht eigene Zahlen. Sie sieht sich aufgrund der „ungewöhnlich günstigen Vermögenslage“ der Haupterben Max und Rudolf dazu veranlasst, sich mit dem „Erlage von [zusätzlichen] Kr. 400.000.- einverstanden erklären zu sollen“.196 An anderer Stelle fordert sie vom Gericht, die Auszahlung ihrer im Testament zugesicherten Rente. Sie hat diese nicht erhalten, weil ihre Mutter Ida das vorhandene Geld „zur Deckung des standesgemässen Unterhaltes […] in der Heilanstalt des Dr. Binswanger“ verwendet hat, statt an sie zu übergeben.197 Auch zwischen Moriz und sein Halbbruder Max kommt es zu Auffassungsunterschieden. Max ist als Vormund mit Moriz’ ausschweifendem Lebenstil nicht einverstanden und rechnet dem Gericht vor, dass dieser hohe Schulden hat.198 Moriz hingegen fühlt sich zu unrecht durch „compromittierende Massregelungen“ eingeschränkt, er sei aufgrund seines umfangreichen Erbes und dessen gewinnbringenden Veranlagung gar nicht zahlungsunfähig.199 Weiters scheint die Bewertung mancher Vermögensteile erst vom Gericht geprüft werden zu müssen.
Die Ergebnisse dieser gerichtlichen Anstrengungen finden sich in der erwähnten Einantwortungsurkunde OZ 385. Aus der Sicht dieser Forschungsarbeit bildet sie das Kernstück des Verlassenschaftsaktes. Dieser Teil besteht selbst aus verschiedenen Schriftstücken. In einer „Specification der Ausgaben“ ist jede noch so kleine Ein- und Ausgabe seit Wilhelms Ableben bis Ende 1900 in „Corrent-Conten“ dokumentiert. Auch vom Gericht angeforderte Stellungnahmen der Betriebe über Gewinnausschüttungen und damit verbundene teils sehr ausführliche Geschäftsberichte sind enthalten. So antwortet die „Jaworznoer Steinkohle-Gewerkschaft“ dem Gericht wie folgt:200
Auf Ihr Ansuchen beehren wir uns, Ihnen bekannt zu geben, dass wir auf die Kuxe unserer Gewerkschaft in den Jahren 1895 bis inclus. 1900 […] die nachfolgenden Beträge zur Ausschüttung gebracht haben. Im Jahre 1895 für einen Kux-Antheil K. 3000, 1896 K. 3400, 1897 K. 4000, 1898 K 5400., 1899 K. 11000, 1900 K. 20000.
Auch die anderen aufgeforderten Betriebe zeigen ansteigende Gewinntendenzen: die „Stauding-Stramberger Localbahn“, die Witkowitzer Berbau- u. Eisenhütten-Gewerkschaft“ und die „Zieditz Haberspirker Brau- & Glanzkohlengewerkschaft“. Zusammengefasst ist das so Stück für Stück inventarisierte Vermögen in der „Erbtheilungs-Urkunde“:201
Hier ist nun die gerichtliche Beurteilung des gesamten Vermögens Wilhelms zu seinem Tod, es wird mit 42 Mio. Kronen angegeben. Beide Universalerben erhalten davon die Hälfte, wobei mache Positionen nicht halbiert werden, wie etwa das Gut Jaidhof, das Max erhält, oder das Palais in der Kantgasse, das an Rudolf samt „Mobilien“ geht. Diese Teilung wird auf den Kreuzer genau berechnet und ist im Anhang zu finden. Im Wesentlichen erhält Rudolf mehr Anteile an den Wertpapieren bzw. Kuxe diverser Bergbaubetriebe, um das Ungleichgewicht der Realitäten auszugleichen. Hier wird deutlich, dass Moriz mit seinen 4 Mio. K offenbar nur 20% von dem erbt, was seine beiden Brüder erhalten, beide je 21 Mio K. Auch seine Schwestern erhalten im Vergleich zum Rest der Bevölkerung zwar enorme Summen, im Vergleich zu ihren beiden universalerbenden Brüdern ist der Rest der Familie aber recht ungleich bedacht.
Was die Struktur des Vermögens in verschiedenen Branchen betrifft, ist diese beim Ableben Wilhelms recht eindeutig. Es besteht aus vier Teilen. Industrie und Handel – im wesentlichen Bergbau und Transport – machen knapp 30% aus, Wertpapiere ebenso. Auffällig ist das hohe „Barguthaben bei der Firma Gebrüd. Gutmann in Wien“ das ein Drittel umfasst. Die verbleibenden 10% entfallen auf den Grundbesitz samt Einrichtung und Kunstgegenstände. Vergleicht man hier den Wert des Gutes Jaidhof, der mit 3,3 Mio. K angegeben wird, so ähnelt dieser frappant den 3,4 Mio K. zu denen Wilhelm das Anwesen gekauft hat. Da hier keine Wertsteigerung erkennbar ist, ist davon auszugehen, dass die Gutmanns – ähnlich den Rothschilds – Realitäten nicht zum Zweck von Rendite angeschafft haben, zumindest nicht Wilhelm. Auch finden sich in dieser Aufstellung keine Hinweise auf Lebensversicherungen.202
Weiters findet sich die Verquickung von privatem Eigentum und Firmeneigentum wieder. So liegt das Barguthaben Wilhelms auf dem Konto der Firma. Vielleicht ist die Trennung zwischen Privat- und Firmenvermögen zur Beurteilung des Reichtums der Familie Gutmann gar nicht wesentlich. Dies zeigt sich auch daran, dass die Anteile an den Bergbaubetrieben personenbezogen sind.
Ich möchte an dieser Stelle auf das Beispiel Witkowitz fokussieren. Wilhelm spricht in seinen Memoiren davon, „in den Jahren 1872 und 1873 sehr namhafte Mittel meines Hauses in der Eisenindustrie engagirt [sic]“ zu haben.203 Bei seinem Ableben macht der gerichtlich bestimmte Wert der Anteile von 8. Mio. K. immerhin 18% aus und ist somit das mit Abstand wertvollste Unternehmen. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass dieser Anteil seinem persönlichen Vermögen zugerechnet wird, also nicht in Firmenbesitz ist. Ähnlich dürfte es sich bei den anderen 30 Kuxen verhalten, die seiner Familie gehören – die andere Hälfte ist bei Rothschilds. So „besitzt Herr Max Ritter von Gutmann schon seit längerer Zeit in seinem Privatvermögen ebenfalls 10 Kuxe dieses Unternehmens“.204 Ob die restlichen 20 Kuxe seinem Bruder David persönlich gehören, ist unklar, aber aufgrund der Hinweise zu den restlichen Anteilen naheliegend. In der Abhandlung der Erbschaft werden sie zwischen den Brüdern so aufgeteilt:205
Von den 20 in die Verlassenschaft gehörigen Kuxen der Wittkowitzer Bergbau- und Eisenhütten Gewerkschaft (:Post 14:) übernimmt Max Ritter von Gutmann nur 5 und Rudolf Ritter von Gutmann 15. Hiedurch wird einem Begehren der Vormundschaft des Letzteren im Interesse des Mündels entsprochen, da mit der größten Wahrscheinlichkeit eine sehr günstige Entwicklung und beträchtliche Erträgnisse dieses besonders gut eingerichteten Industrie Etablissements zu erwarten ist.
Deutlich wird darin zunächst, dass Ida, die Mutter von Rudolf – nicht aber von Max – auf die Erbteilung Einfluss nimmt. Weiters und wesentlicher ist, dass sie davon ausgeht, dass diese Anteile stark an Wert gewinnen werden. Dies zeigt nicht nur die schon erwähnte fast exponentielle Steigerung mancher Produktionsindikatoren. Auch die Beantwortung der gerichtlichen Anfrage zur Gewinnausschüttung zeichnet dieses Bild:206
In Beantwortung Ihrer an uns gerichteten Anfrage, dienen wir Ihnen entstehend mit dem Verzeichnisse der von Seite unserer Gewerkschaft in den Jahren 1895 bis incl. 1900 pro Kux zur Ausschüttung gelangten Beträge. Es wurden vertheilt pro Kux pro 1895 K.32.000, 1896 K. 50.000, 1897 K. 40.000, 1898 K 44.000, 1899 K.68.000 und 1900 K. 72.000.
Seit dem Tod Wilhelms hat sich der Wert der Kuxe in nur 5 Jahren mehr als verdoppelt. Wie das Gericht zu einer Bewertung der Unternehmensanteile aufgrund dieser Gewinnausschüttung kommt, ist zwar unklar, dass das Werk gegen Ende des 19. Jahrhunderts deutlich an Fahrt aufnimmt nicht.207 Dieser Aufwärtstrend ist also im Einklang mit der Entwicklung der anderen Unternehmen, die im Zuge der Verlassenschaft dem Gericht berichten. An dieser Stelle möchte ich an den Reichtum Albert Rothschilds erinnern: sein versteuertes Einkommen allein hat sich von 1898 bis 1910 verdoppelt. Ob auch das Gutmannsche Vermögen diese Entwicklung erfuhr, kann anhand der Erbschaft Wilhelms nicht abgeschätzt werden. Sie liefert nur Hinweise darauf, in welche Richtung die Indizien der ersten Jahre nach seinem Ableben zeigen.
Die wesentlichen gewinnträchtigen Unternehmungen scheinen von der Inventarisierung erfasst. Andere fehlen, etwa die in den Memoiren erwähnte Jute–Spinnerei oder die Zellulosefabrik. Auch die Villa in Baden scheint nicht auf. In wessen Besitz sie 1895 sind, kann hier nicht bestimmt werden. Auch nicht näher untersucht werden die umfassenden Unternehmensberichte, die in anderen Forschungskontexten interessant sein könnten. So dokumentieren etwa die Broschüren der „Stauding–Stramberger Localbahn“ den „Rechnungs-Abschluss der Betriebs–Kranken-Cassa“, welche der Aufschlüsselung der Gewinnausschüttung gegenübergestellt werden könnte. Die „Recapitulation aller Waarenclassen“ oder „die Stückzahl der beförderten Thiergattungen und Equipagen“ zeigt die den Detaillierungsgrad, in welchem diese Geschäftsberichte vorliegen.208
Worauf ich jedoch eingehen möchte ist Wilhelms Wohltätigkeitsempfinden. Wilhelm ist in das kollektive Gedächtnis als Wohltäter eingegangen ist, wie David und Max und andere Superreiche dieser Zeit auch. Er hat an diesem Narrativ selbst mitgearbeitet. Nicht nur dadurch, dass er die Spenden an sich tätigt, sondern auch, dass er davon erzählt. In seinen Memoiren widmet er seiner Philanthropie ein eigenes Kapitel. Darin berichtet er auch von den oben bereits angeführten Projekten:209
Gemeinschaftlich mit meinem Bruder habe ich in Wien (Döbling) ein Waisenhaus für 60 Mädchen, vollständig eingerichtet, in’s Leben gerufen und ebenso mit meinem Bruder an der Poliklinik in Wien ein Kinderspital für 50 kleine Patienten gegründet. Für den Bau der Poliklinik selbst wurden große Beträge ausgeworfen.
Er nennt zwar den Spendenbetrag nicht, dieser ist aber mit 300.000 K. hinlänglich bekannt.210 Offenbar war diese Summe auch für ihn selbst ein „großer Betrag“ und damit eine vielleicht nicht alltägliche Spende. In Relation zu seinem sechs Jahre später vererbten Vermögen sind das 0,7 Prozent. Sie ist jedoch nur eine der prominenten und auch medial ausgeschlachteten Spenden.211 Mit dem Rudolfinerhaus und dem Mädchenwaisenhaus beträgt das bekannte Spendenausmaß 1,7 Prozent im Verhältnis zum hinterlassenen Vermögen Wilhelms.212
Auch im Testament sowie der Verlassenschaft finden sich Hinweise zu der Vorstellung Wilhelms, wie umfänglich seine Wohltat sein kann. Aus den erwähnten testamentarisch bestimmten 20.000 K. werden schlussendlich etwas mehr, „so dass im Ganzen 22.700 K zur Vertheilung gebracht“ werden.213 Das sind 0,05 Prozent in Bezug auf sein gesamtes Erbvermögen, oder 0,8% von 3 Mio. K. die seine minder bedachten Töchter erhalten. Eine grobe Schätzung des Ausmaßes der Zuwendungen an ca. 177 Beamte und Diener, von denen jeder eine Quittung unterfertigt, ergibt eine Summe von rund 90.000 K. und damit 0,2 Prozent.214 Die Größenordnungen der Spenden post mortem sind noch geringer als die Dimension zu Lebzeiten.
Spenden an die Arbeiter in Ostrau oder Witkowitz finden im Verlassenschaftsakt keine Erwähnung. In der „Spezification der Ausgaben“ finden sich aber andere Beträge. So etwa Honorare des Dr. Julius Magg, dem „Hof- und Gerichts-Advocat“ der Familie: im Jahr 1898 erhält dieser am 19. Juli ƒ 31.075 und am 13. Dezember nochmals ƒ 36.909, im Jahr darauf sind nochmal ƒ 15.000 ausgewiesen.215 Allein diese drei Honorare ergeben in zwei Jahren eine Summe von rund 160.000 K. oder philanthropisch gesprochen: eine halbe Spende an die Poliklinik.
Zusammenfassend zeichnet sich also ein gewisses Missverhältnis von Betonung einer Spende einerseits und deren Höhe im Vergleich zu anderen Ausgaben oder dem Gesamtvermögen andererseits ab. Wilhelms Verständnis von Wohltätigkeit ist zum Zeitpunkt des Testaments im Promille-, zu Lebzeiten womöglich im 1 bis 2 Prozentbereich in Bezug auf sein Vermögen.
7. Schlusswort
In dieser Arbeit wurde der Reichtum der Familie Gutmann konkretisiert. Zwar ist eine Erbschaft nur eine Momentaufnahme des privaten Vermögens einer Person. Aber der umfangreiche Quellenkorpus enthält neben einer detaillierten Aufstellung zu eben diesem Vermögen im Falle Wilhelms auch einige weiterführende Informationen.
Für die Reichtumsforschung zeigen sich die beiden Hauptquellen das Testament und der Verlassenschaftsakt unterschiedlich gut geeignet. Während das Testament zwar manch Fährte enthält und gewisse persönliche Ansichten des Erblassers vermittelt, findet sich in diesem Fall keine Aufstellung des Gesamtvermögens. Diese ist jedoch im Verlassenschaftsakt enthalten, weshalb dieser zur Konkretisierung des gegenständlichen Vermögens unerlässlich ist.
In Kombination mit der Auswertung von anderen Quellen, in diesem Fall hervorzuheben sind vor allem die Memoiren Wilhelms, aber auch verschiedener Sekundärliteratur, lichtet sich der Nebel um das wenig erforschte Gutmann’sche Familienvermögen zumindest etwas.
Wilhelm kommt zunächst alleine nach Wien, holt aber David nach, damit dieser ihn wegen des „grossen Aufschwungs, den mein Kohlegeschäft nahm“ unterstützt.216 Sein „Geschäft, das nun unter der [neuen] Firma Gebrüder Gutmann weitergeführt“ wird, hat ab jetzt zwei Brüder als Gesellschafter. Im Gesellschaftsvertrag von 1863 ist ein Startkapital von 60.000 Gulden angegeben [120.000K]:217
Der Gesellschaftsfond ist auf nachstehende Art gebildet. Herr I.W. Gutmann belässt den seinem in dem bisher unter Firma I.W.Gutmann bestandenen Geschäftes befindlichen und durch die darüber gezogenen Bilance ausgewiesenen Kapitales an Geld, Waren und guten Activen einen Betrag von 50.0000 fl sage: Fünfzig Tausend Gulden Conv. Mz. als Einlage in die hier geschlossene Gesellschaft, und Herr David Gutmann gibt einen in außenstehenden Fondvermögen und nach Eingang in successischen Raten an I.W. Gutmann abzuführenden Kapitalsbetrag per …...10.000 fl als Einlage in die hier geschlossene Gesellschaft.
Wilhelm hat also, zumindest was die ursprüngliche Kapitaleinlage betrifft, ein deutliches Übergewicht. Aus diesen 120.000 K. werden bist zu Wilhelms Tod allein in seinem Nachlass 42 Mio. K. Was den Nachlass seines Bruders betrifft, umfasst dieser 17 Jahre später 19 Mio. K. Allein die zeitliche Distanz zwischen den beiden Schlaglichtern erschwert die Beurteilung des Familienreichtums. Unklar ist, wie hoch das Vermögen Davids zum Zeitpunkt des Ablebens seines Bruders ist. Ebenso ist schwer zu beurteilen, wie sich der Nachlass Wilhelms weiter entwickelt. Werden Max und Rudolf das Vermögen vermehren oder verlieren? Anzeichen im Verlassenschaftsakt und andere Indizien deuten darauf hin, dass in den Jahren zwischen Wilhelm und Davids Ableben die Gutmann’schen Unternehmungen einem ansteigendem Trend unterliegen. Dieser scheint sich auch in den eingangs erwähnten Steuerlisten widerzuspiegeln, wo sie als Familie über das zweithöchste Einkommen verfügen. Der Rückschluss vom Einkommen auf das angehäufte Familienvermögen ist aber schwierig, zu viele personelle, räumliche wie zeitliche Lücken verstellen den Blick auf eine ganzheitliche Einschätzung.
Ohne detaillierte Untersuchung des Reichtums der Gutmanns zu verschiedenen Zeitpunkten und anhand der Quantifizierung der jeweiligen Einzelvermögen der Hinterbliebenen können die beiden Schlaglichter jedoch eines sehr wohl vermitteln. Wie schon einmal weiter oben zitiert, schreibt Sandgruber, dass Familie Gutmann „im Einkommensranking gleich hinter den Rothschild steht“.218 Diesen Eindruck kann die Steuerliste auch tatsächlich vermitteln. Der Vergleich mit dem riesigen Vermögen Albert Rothschilds von 1 Milliarde Kronen und den anderen dahinter platzierten, zeigt aber, dass Gutmanns deutlich näher an der Gruppe der Rothschild Nachfolger stehen – vielleicht sogar mitten drin – als an Rothschild selbst. Wie gezeigt wurde, ist ein Vermögen von 40 Mio. Kronen zwar im Vergleich zum Rest der Bevölkerung eine unvorstellbare Summe, in der Spitze der Superreichen – Rothschild ausgenommen – ist diese Größenordnung in den Jahrzehnten vor dem ersten Weltkrieg aber auch bei anderen anzutreffen.
Trotzdem, selbst wenn die Erbschaft Wilhelms zu gering bewertet, manch Vermögensteil von der gerichtlichen Inventarisierung nicht erfasst oder schon vor der Erbschaft übergeben wäre, verschachtelte Besitzverhältnisse in Firmenkonstruktionen oder familialen Netzwerken die Beurteilung erschweren: die vielen bekannten und auch die in dieser Arbeit freigelegten Hinweise verleihen der Familie Gutmann einen nicht unbegründeten Anspruch, den zweiten Platz für sich zu reklamieren. Nur eine eingehende Untersuchung dieser und anderer superreicher Familien abseits der Rothschilds oder überhaupt eine ganzheitliche Untersuchung der obersten Vermögen wird diese Frage klären können.
8. Literaturverzeichnis
Arnbom, Marie-Theres: Friedmann, Gutmann, Lieben, Mandl und Strakosch: Fünf Familienporträts aus Wien vor 1938, Wien: Böhlau, 2013.
Bonyhady, Tim: Wohllebengasse. Die Geschichte meiner Wiener Familie. Wien: Paul Zsolnay Verlag, 2013.
Bourdieu, Pierre: Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapitel. In: Kreckel, Reinhard: Soziale Ungleichheiten. Soziale Welt. Sonderband 2. Göttingen: Verlag Otto Schwartz & Co, 1983, S.183–198.
Brunnbauer, Heidi: Im Cottage von Währing/Döbling… Interessante Häuser – interessante Menschen. Gösing: Edition Weinviertel, 2003.
Butschek, Felix: Statistische Reihen zur österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Die österreichische Wirtschaft seit der industriellen Revolution. Wien: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, 1999.
Doujak, Günther Michael: Die Entwicklung des landtäflichen Großgrundbesitzes in Niederösterreich seit dem Jahr 1908, Dissertation. Wien: Universität Wien, 1981.
Deimer, Emmerich: Chronik der Allgemeinen Poliklinik in Wien im Spiegel der Medizin- und Sozialgeschichte. Wien: Göschl, 1989.
Derix, Simone: Grenzenloses Vermögen. Räumliche Mobilität und die Infrastrukturen des Reichtums als Zugänge zur historischen Erforschung des »einen Prozents«. In: Gajek, Eva Maria/Kurr, Anne/Seegers, Lu (Hgg.): Reichtum in Deutschland: Akteure, Räume und Lebenswelten im 20. Jahrhundert. Göttingen: Wallstein Verlag, 2019, 164–181.
Eigner, Peter: Industrie. Merkmale und Entwicklungstendenzen. In: Cerman, Markus/Eder, Franz X. /Eigner, Peter/Komlosy, Andrea/Landsteiner, Erich (Hgg.): Wirtschaft und Gesellschaft. Europa 1000-2000. Innsbruck/Wien/Bozen: Studienverlag, 2011, 228–243.
Gajek, Eva Maria/Kurr, Anne: Themenschwerpunkte des Sammelbandes. Innenansicht. Akteure, Lebenswelten, Netzwerke. In: Gajek, Eva Maria/Kurr, Anne/Seegers, Lu (Hgg.): Reichtum in Deutschland: Akteure, Räume und Lebenswelten im 20. Jahrhundert. Göttingen: Wallstein Verlag, 2019, 14–31.
Gaugusch, Georg: Wer einmal war. Das Jüdische Großbürgertum Wiens 1800–1938. A–K. Wien: Amalthea, 2011.
Hellmann, Bernadette: Viele vermögen mehr. Wie Bürgerstiftungen die Geld-, Zeit- und Ideenreichen zusammenbringen. In: Lauterbach, Wolfgang/Hartmann, Michael/Ströing, Miriam (Hgg.): Reichtum, Philanthropie und Zivilgesellschaft. Wiesbaden: Springer , 2014, 269–288.
Hubmann, Gerald/Jobst, Clemens/Maier, Michaela: Ein neuer langer Verbraucherpreisindex für Österreich, 1800–2018. In: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Vol.107 (1), Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2020, 47–85.
John, Michael: Die jüdische Bevölkerung in Wirtschaft und Gesellschaft Altösterreichs (1867-1918). Bestandsaufnahme, Überblick und Thesen unter besonderer Berücksichtigung der Süd-Ostregion. In: Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland Heft 92 Sigel WAB 92. Juden imGrenzraum. Geschichte, Kultur und Lebenswelt "Schlaininger Gespräche 1990". Eisenstadt:Burgenländisches Landesmuseum Eisenstadt, 1993, 197–244.
Korom, Philipp: Erben. In: Dimmel, Nikolaus/Hofmann, Julia/ Schenk, Martin/Schürz, Martin (Hgg.): Handbuch Reichtum. Neue Erkenntnisse aus der Ungleichheitsforschung. Innsbruck/Wien/Bozen: StudienVerlag, 2017, 244–254.
Landwehr, Achim: Historisches Material. In: Frietsch, Ute/Rogge, Jörg (Hgg.): Über die Praxis des kulturwissenschaftlichen Arbeitens. Ein Handwörterbuch. Bielefeld: Transcript, 2013, 184–188.
Melichar, Peter: >2oo Hektar. Großgrundbesitz in Niederösterreich in der ersten Jahrhunderthälfte. In: Melichar, Peter/Langthaler, Ernst/Eminger, Stefan (Hgg.): Wirtschaft Band 2. Niederösterreich im 20. Jahrhundert. Wien/Köln/Weimar: Böhlau Verlag, 2012, 575–632.
Niederacher Sonja: Das Vermögen jüdischer Frauen und Männer in Wien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Gajek, Eva Maria/Kurr, Anne/Seegers, Lu (Hgg.): Reichtum in Deutschland: Akteure, Räume und Lebenswelten im 20. Jahrhundert. Göttingen: Wallstein Verlag, 2019, S.313–328.
o.A.: Bruttoinlandsprodukt und Hauptaggregate, Statistik Austria Online, URL: https://www.statistik.at/statistiken/volkswirtschaft-und-oeffentliche-finanzen/volkswirtschaftliche-gesamtrechnungen/bruttoinlandsprodukt-und-hauptaggregate (01.06.2022).
o.A.: Häuserschematismen, Wien Geschichte Wiki Online, Stadt Wien, URL: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/H%C3%A4userschematismen (Zugriff 04.03.2022).
o.A.: Historischer Währungsrechner, Eurologisch, Finanzbildung durch die Oesterreichische Nationalbank, URL: https://www.eurologisch.at/docroot/waehrungsrechner (01.06.2022).
o.A.: World’s billionaires have more wealth than 4.6 billion people, Oxfam Online, 20.01.2020, URL: https://www.oxfam.org/en/press-releases/worlds-billionaires-have-more-wealth-46-billion-people (01.06.2022).
o.A.: WAIS - Wiener Archivinformationsystem, Stadt Wien Online, URL: https://www.wien.gv.at/actaproweb2/benutzung/index.xhtml (01.06.2022).
o.A.: Wilhelm von Gutmann. In: Wikipedia Online, URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Gutmann (Zugriff: 22.06.2022)
Pacher, Gerold: Strategien zur Erlangung und Bewahrung von Reichtum der Familie Gutmann im Spiegel zeitgenössischer Berichterstattung, Bachelor Arbeit , Wien: Universität Wien, 2020.
Pammer, Michael: Entwicklung und Ungleichheit. Österreich im 19. Jahrhundert. In: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beihefte Nr. 161. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2002.
Pammer, Michael: Jüdische Vermögen in Wien 1938. In: Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkommission. Vermögensentzug während der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Entschädigungen seit 1945 in Österreich. Band 8. Wien/München: Oldenbourg Verlag, 2003.
Pammer, Michael: Testamente und Verlassenschaftsabhandlungen (18. Jahrhundert). In: Pauser, Josef, Scheutz, Martin, Winkelbauer, Thomas (Hgg.): Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert). Wien/München: Oldenbourg Verlag, 2004. 495–510.
Pammer, Michael: Umfang und Verteilung von Unternehmervermögen in Wien 1852-1913. In: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte/Journal of Business History, Vol. 41 (1), München: C.H. Beck, 1996, 40–64.
Pammer, Michael: Wohlstandsverteilung und Unterentwicklung. In: WISO Wirtschafts- und Sozialpolitische Zeitschrift Vol. 24 (4), Linz: Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, 2001, 165–183.
Prokop, Ursula: David Gutmann und das israelitische Mädchenwaisenhaus in Wien-Döbling. In: David. Jüdische Kulturzeitschrift Online, Ausgabe 124 (04) 2020. URL: https://davidkultur.at/artikel/david-gutmann-und-das-israelitische-maedchenwaisenhaus-in-wien-doebling (Zugriff: 22.06.2022)
Resch, Andreas: Industriekartelle in Österreich vor dem Ersten Weltkrieg. Marktstrukturen, Organisationstendenzen und Wirtschaftsentwicklung von 1900 bis 1913. Berlin: Duncker & Humblot, 2002.
Rudolph, Richard: Banking and Industrialization in Austria-Hungary: The Role of Banks in the Industrialization of the Czech Crownlands, 1873–1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
Sandgruber, Roman: Die 1000 reichsten Österreicher im Jahr 1910, Verteilungsstatistische und kollektivbiographische Auswertungen. In: Schulz, Günther (Hg.): Arm und Reich, Zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ungleichheit in der Geschichte. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2015, S.213–242.
Sandgruber, Roman: Traumzeit für Millionäre. Die 929 reichsten Wienerinnen und Wiener im Jahr 1910. Wien/Graz/Klagenfurt: Styria, 2013.
Sandgruber, Roman: Rothschild. Glanz und Untergang des Wiener Welthauses. Wien/Graz/Klagenfurt: Molden, 2018.
Schulze, Max-Stephan: Re-Estimating Austrian GDP, 1870–1913. Methods and Sources, In: London School of Economics & Political Science, Working Papers in Economic History, Vol. 36, London: London School of Economics, 1997.
Scott, Joan Wallach: Geschichte schreiben als Kritik, In: Historische Anthropologie, Vol. 23 (1), Köln/Weimar/Wien: Böhlau Verlag, 2015, 93–114.
Stanzer, Burkhard/Pleisnitzer, Susanne: Erbe Österreich – Habsburgs Ringstraßenbarone (2/4) - Die böhmischen Magnaten. Vierteilige Dokumentationsreihe. Neuland Film GmbH, Produktion: Grünwald, Claudia/Stanzer, Burkhard/Staudach, Harald, ORF 2019.
Stekl, Hannes: Reichtum und Wohlstand in der späten Habsburgermonarchie. In: Bruckmüller, Ernst (Hg.): Armut und Reichtum in der Geschichte Österreichs. Köln/Wien: Böhlau Verlag, 2012, 113–140.
Streller, Vera Maria: "Verschwender und Geizkrägen". Eine strukturelle Untersuchung des Wirtschaftsbürgertums in Wien um 1900 auf Grund von Verlassenschaftsakten, Diplomarbeit. Wien: Universität Wien, 1988.
Suppan, Arnold: Hitler - Beneš - Tito: Konflikt, Krieg und Völkermord in Ostmittel- und Südosteuropa. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013.
Tschiggerl, Martin/Walach, Thomas/Zahlmann, Stefan: Geschichtstheorie. Wiesbaden: Springer, 2019.
9. Quellen
Gutmann, David Ritter von: Testament, Wien 4. März 1912. Wiener Stadt- und Landesarchiv, Handelsgericht, A51.52 – Testamente: 52/1912 (Signatur: 2.3.3.A51.52/1912).
Gutmann, Wilhelm Isaak Wolf Ritter von: Testament, Wien 19. März 1895. Wiener Stadt- und Landesarchiv, Handelsgericht, A51 – Testamente: 34/1895 (Signatur: 2.3.3.A51.34/1895).
Gutmann, Wilhelm Isaak Wolf Ritter von: Verlassenschaftsabhandlung, Wien 19. März 1895. Wiener Stadt- und Landesarchiv, Handelsgericht, A53 – Verlassenschaftsabhandlungen: 53/1895 (Signatur: 2.3.3.A2.53/1895).
Registerakt Firma Gebrüder Gutmann, 1863-1947, Aktenzeichen: Ges. 2/270. Wiener Stadt- und Landesarchiv, Handelsgericht, A47 – HRA – Registerakten: 5053a (Signatur: 2.3.3.A47.5053a).
Gutmann, Wilhelm Isaak Wolf Ritter von: Aus Meinem Leben, Neudruck nach der Originalausgabe des Jahres 1891. Wien: Carl Gerold’s Sohn, 1911.
Leonhardt, Gustav (Hg.): Compass. Jahrbuch für Volkswirtschaft und Finanzwesen. 1873. Sechster Jahrgang. Wien: Compass-Verlag, 1873.
Lenobel, Josef (Hg.): Häuser-Kataster der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien. Wien: Lenobel, 1905.
Lenobel, Josef (Hg.): Das Buch der Häuser und Hausbesitzer Wiens. XVIII. Bezirk. Wien/Leipzig: Lenobel, 1908.
Hanel, Rudolf (Hg.): Compass. Finanzielles Jahrbuch für Österreich-Ungarn. 1905. Band III. Protokollierte Industrie-Firmen Österreichs. Wien: Compass-Verlag, 1905.
Hanel, Rudolf (Hg.): Compass. Finanzielles Jahrbuch für Österreich-Ungarn. 1910. Band III. Dreiundvierzigster Jahrgang. Wien: Compass-Verlag, 1910.
Hanel, Rudolf (Hg.): Compass. Finanzielles Jahrbuch für Österreich-Ungarn. 1912. Band II. Fünfundvierzigster Jahrgang. Wien: Compass-Verlag, 1912.
Heller, Samuel (Hg.): Compass. Finanzielles Jahrbuch für Österreich-Ungarn. 1894. Siebenundzwanzigster Jahrgang. Wien: Compass-Verlag, 1894.
o.A.: 100 Jahre Eisenwerk Witkowitz!, Herausgegeben von Eisenwerk Witkowitz. Mährisch-Ostrau: Jul. Kittls Nachf. Keller und Co., 1928. Nationalbibliothek der Tschechischen Republik (Signatur OSA001/E37), Kramerius Online , URL: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/30437076 (Zugriff: 22.06.2022)
o.A.: Eingekaufte Pairs. Prozess Gutmann contra “Zeit”. In: Bohemia Nr. 103, 78. Jahrgang. Prag: 14.04.1905. S1–3. http://kramerius.nkp.cz/kramerius (Zugriff: 22.06.2022)
o.A.: Der Verkauf der Andritzer Maschinenfabrik.. In: Grazer Tagblatt Nr. 314, 9. Jahrgang. Graz: Karl Ubell, 12.11.1899. S.27. http://anno.onb.ac.at (Zugriff: 21.06.2022)
o.A.: Die vierzigjährige Jubelfeier des Geschäftshauses des Herrn Wilhelm und David Ritter von Gutmann. In: Die Neuzeit Nr. 2. Wien: Waizner & Sohn, 08.01.1892. S.11–13. http://anno.onb.ac.at (Zugriff: 21.06.2022)
o.A.: Eingekaufte Pairs - 500.000 Kronen das Stück. In: Die Zeit Nr. 823, 4. Jahr. Wien: Verlag DieZeit Ges.m.b.H, 10.01.1905. S1–2. http://anno.onb.ac.at (Zugriff: 22.06.2022)
Tittel, Ignaz: Schematismus und Statistik des Grossgrundbesitzes in den Erzherzogtümern Nieder- u. Oberösterreich und im Herzogtum Steiermark. Prag: Verlag Josef Springer, 1908.
10. Anhang
10.1. Auszug der Liste der Reichsten in Wien 1910
Im folgenden ein Auszug aus Sandgrubers Liste der reichsten Wiener 1910 mit Fokus auf Familie Gutmann und andere in dieser Arbeit genannten Personen219.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
10.2. Auszug aus dem Verwandtschaftsdiagramm der Gutmanns
Ein Auszug des familialen Netzwerkes der Familie Gutmann. Hier ist der Übersicht halber nur die Seite Wilhelms und nur seine Kinder angegeben.
10.3. „Bestandtheile des Erbvermögens“
Hier die Aufteilung des Erbes unter den Universalerben Max und Rudolf entsprechend des Verlassenschaftsaktes, zur besseren Übersichtlichkeit leicht vereinfacht.220 So wurden etwa sämtliche katastralen Einlagezahlen, die den Grundbesitz Jaidhof umfassen, und in der Aufstellung angegeben sind, nicht wiedergegeben.
10.4. Einblick in die Unterlagen
Hier zwei Abbildungen der Originalunterlagen, zunächst aus dem Testament, dann aus dem Verlassenschaftsakt Wilhelms.
10.4.1. Auszug Testament Wilhelm
Testament Wilhelm, Seite 7, danach die Transkription:221
- geben und habe ihr ferner am 1. Jänner 1893 auf ihren Erbtheil fcs. 1,000.000.- Eine Million France bereits bezahlt.
Meine geliebte Tochter Marianne verehelichte Lady Francis Montefiore hat anlässlich ihrer Verheiratung von mir das Capital, welches eine Rente von £ 5000.- Pfund Livre Sterling sicherstellt, sowie eine Ausstattung im Werte von beiläufig ƒ 150.000.- Gulden in Worten Einmalhundertfünfzigtausen Gulden österr. Währung erhalten und es sind in den Ehepacten die erforderlichen Bestimmungen zu ihren Gunsten vertragsmässig festgestellt.
Meiner geliebten Tochter Elsa vermache ich an Stelle ihres Erb- und Pflichttheiles ƒ 1,500.000.- in Worten: Eine Million fünfmalhunderttausend Gulden österr. Währung. Von diesen ƒ 1,500.000.- erhält meine Tochter Elsa die Hälfte d. i. ƒ 750.000.- zum freien Eigenthume; bezüglich der weiteren
10.4.2. Auszug Verlassenschaftsakt Wilhelm
Hier ein Ausschnitt aus der „Erbtheilungs-Urkunde“ im Verlassenschaftsakt Wilhelm Gutmann.222
10.5. Weiterführende Fragen
- Trotz der sich in der Umstrukturierung befindlichen und wenig übersichtlichen Lage der Steuerakten könnten versucht werden, das Bild der Gutmannschen Steuerleistung von Sandgruber, das sich nur auf 1909-1910 bezieht, auszuweiten.
- Im Testament wird auch die familiäre Vernetzung deutlich. Diese Netzwerke könnten näher untersucht werden. Auch die geschäftliche Vernetzung könnte fokussiert werden. Mit wem machen Gutmanns Geschäfte, mit wem teilen sie sich Unternehmen. Welche Vorstandssitze belegen sie in welchen Unternehmen? Auch die Änderung der Zusammensetzung der Gesellschafter der Firma „Gebrüder Gutmann“ kann untersucht werden.
- Der Grundbesitz könnte aufgrund der Verweise auf die katastralen Einlagezahlen im Verlassenschaftsakt genauer untersucht werden. Auch Tittel führt weiterführende Hinweise an, indem er Katastralreinerträge und Grundsteuer beziffert, anhand derer weiterführende Bewertungen vorgenommen werden könnten.
- Die Verlassenschaftsakten von den Hinterbliebenen sind zu untersuchen, um ein vollständigeres Bild vor allem der Entwicklung des Familienvermögens zu erhalten.
- Die Erschließung firmeninterner Dokumente, sofern überliefert, könnte wichtige Hinweise beinhalten.
[...]
1 Gutmann: Verlassenschaftsabhandlung Wilhelm (1895) GZ 53-6-95 OZ 374.
2 Gutmann: Verlassenschaftsabhandlung Wilhelm (1895) GZ 53-6-95 OZ 364.
3 Sandgruber: Traumzeit (2013), 24.
4 Siehe etwa Sandgruber: Traumzeit (2013) oder Arnbom: Familienporträts (2013). Zu den österreichischen Rothschilds siehe Sandgruber: Rothschild (2018).
5 Pacher: Strategien Gutmann (2020).
6 Derix: Grenzenloses Vermögen (2019) 164.
7 Gajek/Kurr: Innenansicht (2019) 25.
8 Vgl. etwa Korom: Erben (2017) 244 oder Pammer: Testamente und Verlassenschaftabhandlungen (2004) 495.
9 Bourdieu: Kapital (1983) 185–190.
10 Derix: Grenzenloses Vermögen (2019) 164.
11 Gajek/Kurr: Innenansicht (2019) 25.
12 Stekl: Reichtum und Wohlstand (2012) 113.
13 Der Begriff „Superreiche“ entstammt der heutigen Zeit und stellt damit natürlich die Rückprojektion einer aktuellen Bezeichnung dar. Da aber die heutige Ungleichheit in der Vermögensverteilung der damaligen gleicht, Spitzeneinkommen sehr weniger Menschen ganz besonders hoch sind, nenne ich diese Superreiche. Vgl. Etwa Sandgruber: Traumzeit (2013) 246–249.
14 Stanzer/Pleisnitzer: Habsburgs Ringstraßenbarone (2/4). Die böhmischen Magnaten. Dokureihe, ORF (2019).
15 Nicht nur im Populärfernsehen, auch in der Literatur findet sich diese Gewichtung gerne. Vgl. etwa Arnbom: Familienporträts (2013) oder Brunnbauer: Im Cottage von Währing/Döbling (2003). Viele Texte zu Gutmanns zitieren meist Arnbom, weil sie eines der wenigen Bücher verfasst hat, das die Familie ausdrücklich behandelt. Die darin anzutreffenden Narrative sind großteils wie oben beschrieben, auch wenn die Autorin an manchen Stellen demonstrative Wohltätigkeit als unternehmerische Strategie zur Anhäufung von Reichtum bezeichnet.
16 Scott: Geschichte schreiben als Kritik (2015) 114.
17 Landwehr: Historisches Material (2013) 186.
18 Tschiggerl/Walach/Zahlmann: Geschichtstheorie (2019) 94.
19 Oxfam (2020).
20 Gutmann: Verlassenschaftsabhandlung Wilhelm (1895). GZ 53-6-95 OZ 374.
21 Gerade in Hinblick darauf, welche illustren Namen sich weiter hinten in der Reihung finden.
22 siehe: WAIS - Wiener Archivinformationsystem.
23 Gutmann: Verlassenschaftsabhandlung Wilhelm (1895). GZ 53-6-95 OZ 364.
24 Korom: Erben (2017) 244
25 Pammer: Testamente und Verlassenschaftabhandlungen (2004) 506.
26 Ebd. 504.
27 Ebd. 508.
28 Korom: Erben (2017) 245.
29 Hellmann, Viele vermögen mehr (2014) 282.
30 Pammer: Testamente und Verlassenschaftabhandlungen (2004) 496.
31 Ebd. 496.
32 Pammer: Testamente und Verlassenschaftabhandlungen (2004) 497.
33 Ebd. 497.
34 Ebd. 499.
35 Siehe dazu vor allem Pammer: Entwicklung und Ungleichheit (2002) oder Pammer: Unternehmervermögen (1996), aber auch Streller: Verschwender und Geizkrägen (1988), Stekl: Reichtum und Wohlstand (2012) oder Sandgruber: Traumzeit (2013).
36 Pammer: Testamente und Verlassenschaftabhandlungen (2004) 501.
37 Ebd. 502.
38 Niederacher: Vermögen jüdischer Frauen und Männer (2019) 320.
39 Gutmann: Verlassenschaftsabhandlung Wilhelm (1895). GZ 53-6-95 OZ 364.
40 Sandgruber: Die 1000 reichsten Österreicher (2015) 220.
41 Sandgruber: Traumzeit (2013) 70.
42 Korom: Erben (2017) 245.
43 Pammer: Unternehmervermögen (1996) 43.
44 Häuserschematismen, Wien Geschichte Wiki Online.
45 Vgl. etwa Compass (1912). Dieser umfassende Quellenkorpus wird in dieser Arbeit stichprobenartig eingebunden.
46 Dank an die engagierten Referenten!
47 Vielen Dank an meine Mutter, ohne deren Übersetzungen ich niemals so viele Dokumente untersuchen hätte können.
48 Hubmann/Jobst/Maier: Verbraucherpreisindex für Österreich 1800–2018 (2020) 72.
49 Ebd., Übersichten Abschnitt II, 1.10.1.
50 Sandgruber: Traumzeit (2013) 24–27.
51 Historischer Währungsrechner, ONB. Aktuell besitzt der reichste Österreicher im Jahr 2022, Dietrich Mateschitz, geschätzt 27 Mrd. €, der reichste Europäer Bernard Arnault 170 Mrd. € (Quelle Wikipedia). Vergleiche dieser Art sind natürlich ungenau, können aber dennoch eine grobe Relation darstellen. Das alleinige Umrechnen von Währungen wird aber dem Vergleich von Superreichen damals wie heute nicht gerecht. So kann das Vermögen Wilhelms in Bezug zur gesamten Wirtschaftsleistung der Habsburgermonarchie betrachtet werden, das von Mateschitz in Bezug zu jener des heutigen Österreichs. Das Verhältnis des BIP pro Einwohner von 1910 und 2022 ist grob geschätzt etwa 1 zu 10, das Vermögen von Wilhelm also etwa doppelt so gewichtig wie jenes von Mateschitz. (Siehe dazu: Schulze: Austrian GDP (1997) 21, sowie Bruttoinlandsprodukt und Hauptaggregate, Statstik Austria.)
52 Sandgruber: Traumzeit (2013) 134.
53 Pammer: Unternehmervermögen (1996) 49.
54 Ebd.
55 Pammer: Entwicklung und Ungleichheit (2002) 196.
56 Streller: Verschwender und Geizkrägen (1988) 13–14. Wie zufällig diese Stichprobe zustande kam, ist unklar. Die Der 10% Anteil an Kronenmillionäre dieses Samples sind nicht repräsentativ.
57 Ebd. 19.
58 Ebd. 5.
59 Stekl: Reichtum und Wohlstand (2012) 123.
60 Ebd. 124.
61 Ebd. 116.
62 Sandgruber: Traumzeit (2013) 376.
63 Ebd., 22.
64 Pammer: Entwicklung und Ungleichheit (2002) 196.
65 Sandgruber: Traumzeit (2013) 15–16.
66 Pammer: Wohlstandsverteilung und Unterentwicklung (2001) 180.
67 Sandgruber: Traumzeit (2013) 16.
68 Ebda.
69 Bonyhady: Wohllebengasse (2013) 174.
70 Sandgruber: Traumzeit (2013) 16.
71 Streller: Verschwender und Geizkrägen (1988) 15.
72 Sandgruber: Traumzeit (2013) 16.
73 Pammer: Unternehmervermögen (1996) 63.
74 Sandgruber: Traumzeit (2013) 39.
75 Bourdieu: Kapital (1983) 183.
76 Pacher: Strategien Gutmann (2020).
77 Sandgruber: Traumzeit (2013) 31.
78 Anzumerken ist hier, dass die Bildung von Durchschnittswerten dazu neigt, Ausreißer (in diesem Fall gerade nach oben) zu verwischen. Trotzdem kann diese Berechnung einen Rahmen aufzeigen, in dem Reichtum passiert.
79 Pammer: Jüdische Vermögen in Wien 1938 (2003) 139. Pammer bezieht sich in dieser Studie zur Vermögensstruktur auf die Zeit um 1938, also einige Jahrzehnte und einen Weltkrieg und Anschluss später. Da Streller, Stekl und Sandgruber ähnliche – wenn auch nicht derart vollumfängliche - Bilder zeichnen, nehme ich an, dass sich die Vermögensstrukturen nicht dramatisch verändert haben.
80 Streller: Verschwender und Geizkrägen (1988) 25.
81 Ebd. 26. Wie sehr Reizes seine Wertpapiere nach verschiedenen Branchen aufteilte, um innerhalb dieser Anlageform Risiko zu minimieren, wurde nicht näher untersucht.
82 Stekl: Reichtum und Wohlstand (2012) 125.
83 Ebd. 123.
84 Eigner: Industrie (2011) 242.
85 Resch: Industriekartelle (2002) 132.
86 Melichar: 200 Hektar (2012) 582.
87 Ebd. 602.
88 Pammer: Unternehmervermögen (1996) 48.
89 Der Stammbaum Wilhelms ist im Anhang dargestellt.
90 John: Jüdische Bevölkerung (1993) 217.
91 Gaugusch: Wer einmal war (2011) 1032–1033. Was die Schreibweise des Namens Moriz betrifft, finden sich sowohl in der Literatur als auch in den Quellen zwei Varianten: „Moritz“ und „Moriz“. Da sogar derselbe Rechtsanwalt, der bei Gericht verschiedenen Eingaben in dessen Namen tätigt, beide Varianten wählt, habe ich mich schlussendlich für eine entschieden.
92 Gutmann: Testament Wilhelm (1895) 10.
93 Brunnbauer: Im Cottage von Währing/Döbling (2003) 102.
94 Arnbom: Familienporträts (2013) 91.
95 Brunnbauer: Im Cottage von Währing/Döbling (2003) 102.
96 Gaugusch: Wer einmal war (2011) 1034.
97 Sandgruber: Rothschild (2018) 26–27.
98 Arnbom: Familienporträts (2013) 102 und 104.
99 Gaugusch: Wer einmal war (2011) 1032–1034.
100 Siehe etwa Wikipedia: Eintrag Wilhelm Gutmann oder Prokop: Eintrag David Gutmann (2020)
101 Wikipedia: Eintrag Wilhelm Gutmann.
102 Gaugusch: Wer einmal war (2011) 1029.
103 Melichar: 200 Hektar (2012) 602.
104 Arnbom: Familienporträts (2013) 75–76.
105 Sandgruber: Traumzeit (2013) 50.
106 Arnbom: Familienporträts (2013) 100.
107 Sandgruber: Traumzeit (2013) 39 und 182. Ein Auszug der Liste nach Sandgruber findet sich im Anhang.
108 Arnbom: Familienporträts (2013) 77–79.
109 Die Neuzeit Nr. 2 (08.01.1892) 11.
110 Bohemia Nr. 103 (14.04.1905) S.2
111 Die Zeit Nr. 823, (10.01.1905) S.2. Max Gutmann soll nach einem Bericht in „Der Zeit“ versucht haben, seine politische Karriere durch Ämterkauf zu intensivieren. So soll ihm „die Berufung ins Herrenhaus gegen Barzahlung von je 500.000 Kronen angeboten und versprochen worden“ sein. In der Folge kam es zu einem Gerichtsverfahren, in dem Max die Verleger des Blattes „Die Zeit“ wegen Verleumdung verklagte, schlussendlich jedoch seine Klage zurückzog.
112 Grazer Tagblatt Nr. 314 (12.11.1899) S.27.
113 Vgl. dazu vor allem Arnbom: Familienporträts (2013) und Sandgruber: Traumzeit (2013).
114 Compass (1905) 907.
115 Sandgruber: Traumzeit (2013) 50.
116 Ebd.
117 Arnbom: Familienporträts (2013) 100.
118 Arnbom: Familienporträts (2013) 71.
119 Zitiert nach Sandgruber: Rothschild (2018) 239.
120 Rudolph: Banking and Industrialization (1976) 51.
121 100 Jahre Eisenwerk Witkowitz (1928) 3–13. Quellenkritisch kann diese dramatische Produktionssteigerung in einem vom Unternehmen selbst herausgegebenen Bericht natürlich hinterfragt werden. Dennoch scheint auch die Forschung zumindest einen starken Anstieg zu attestieren.
122 Sandgruber: Rothschild (2018) 227.
123 Ebd. 62.
124 Ebd. 372.
125 Ebd. 440.
126 Ebd. 441.
127 Ebd. 474.
128 Butschek: Statistische Reihen (1999) 1.10.1 Devisenkurse in Wien 1872-1948. Eine vorsichtige Rechnung ist dennoch möglich. Die Kurse Kronen-Pfund von 1914 und 1937 sind recht ähnlich. 10 Mio Pfund entsprechen 1937 grob 260 Mio. K. Natürlich hat sich das Werk zwischenzeitlich entwickelt, dieser Wert kann also nicht für 1914 angenommen werden. Auch die Umrechnung von Tschechen Kronen in die Vorkriegswährung scheint unseriös.
129 Suppan: Hitler - Beneš - Tito (2013) 404.
130 Arnbom: Familienporträts (2013) 67–71.
131 Gutmann: Aus Meinem Leben (1891) 102.
132 Ebd. 108.
133 Gutmann: Aus Meinem Leben (1891) 120.
134 Ebd. 120.
135 Grazer Tagblatt Nr. 314 (12.11.1899) S.27.
136 Ebda.
137 Resch: Industriekartelle (2002) 132.
138 Gutmann: Aus Meinem Leben (1891) 76.
139 Ebd. 109.
140 Ob Sandgruber, Brunnbauer oder Arnbom, die sich explizit auch auf die Memoiren von Wilhelm Gutmann bezieht, den dort genannten Spuren aufgrund von Geringfügigkeit in Bezug auf das Gesamtvermögen nicht weiter nachgegangen sind, ist unklar.
141 Compass (1905) 889. Eine umfängliche Untersuchung sämtlicher Jahrgänge zur Entwicklung der Zusammensetzung der Gesellschaftsverhältnisse konnte hier nicht erfolgen.
142 Compass (1910) 210.
143 Gutmann: Aus Meinem Leben (1891) 86.
144 Compass (1905) 402 und 440.
145 Compass (1873) 616 und 620.
146 Sandgruber: Traumzeit (2013) 190.
147 Gutmann: Aus Meinem Leben (1891) 76.
148 Compass (1912) 417.
149 Suppan: Hitler - Beneš - Tito (2013) 146.
150 Stekl: Reichtum und Wohlstand (2012) 127.
151 Streller: Verschwender und Geizkrägen (1988) 31.
152 Sandgruber: Traumzeit (2013) 201.
153 Melichar: 200 Hektar (2012) 602.
154 Sandgruber: Rothschild (2018) 215.
155 Tittel (1908) 85–87.
156 Lenobel (1905) 4. Die Adresse ist ident mit Fichtegasse 12. Aufgrund einer Adressänderung lautet die heutige Adresse nicht mehr Kantgasse 6 sondern Beethovenplatz 3.
157 Lenobel (1905) 108. Die Adresse ist damals ident mit Heugasse 2 bzw. Schwindgasse 2. Heutige Adresse: Schwarzenbergplatz 11.
158 Prokop: Eintrag David Gutmann (2020)
159 Lenobel (1905) 13. Die Adresse ident mit Fichtegasse 10. Heutige Adresse: Schubertring 5.
160 Lenobel (1905) 37. Heutige Adresse: Obere Donaustraße 111.
161 Lenobel (1905) 38. Heutige Adresse: Mexikoplatz 1.
162 Brunnbauer: Im Cottage von Währing/Döbling (2003) 99.
163 Lenobel (1905) 18. Bezirk 22–23.
164 Brunnbauer: Im Cottage von Währing/Döbling (2003) 247.
165 Arnbom: Familienporträts (2013) 104 und Tittel (1908) 88.
166 Arnbom: Familienporträts (2013) 101 und Tittel (1908) 368.
167 Tittel (1908) 544.
168 Anzumerken ist, dass Tittel weiterführende Hinweise liefert, indem er Katastralreinerträge und Grundsteuer beziffert, anhand derer weiterführende Bewertungen vorgenommen werden könnten.
169 Sandgruber: Traumzeit (2013) 353 und Arnbom: Familienporträts (2013) 101. Ich kann diese Berechnung nicht nachvollziehen, kann sie aber auch nicht zurückweisen. So gibt Sandgruber beispielsweise die Fläche von Max in der Steiermark mit 12.000 ha an, während Tittel 1908 5000 ha angibt (siehe oben). Sandgruber gibt an Max habe dieses Gut von 1892 bis 1916 schrittweise erweitert. Eine exakte Nachvollziehung der Gesamtberechnung bzw. der Vergrößerung der einzelnen Güter kann in diesem Rahmen nicht stattfinden. Trotzdem ist zwischen den hier angeführten stichprobenartigen Werten aus Tittel 1908 mit einer Gesamtsumme von maximal 22.000 Hektar (ohne den Besitz von David) eine gewisse Differenz offen. Dennoch vertraue ich diesbezüglich der Angabe Sandgrubers.
170 Melichar: 200 Hektar (2012) 580.
171 Doujak: Entwicklung des landtäflichen Großgrundbesitzes (1981) 100–102.
172 Ebd. 251.
173 Sandgruber: Traumzeit (2013) 51.
174 Gutmann: Testament Wilhelm (1895) 1.
175 Ebd. 5–6.
176 Ebd. 6–10.
177 Gutmann: Testament Wilhelm (1895) 10–16.
178 Ebd. 16.
179 Ebd. 16–17.
180 Ebd. 17.
181 Ebd. 19.
182 Ebd. 2.
183 Gutmann: Testament Wilhelm (1895) 18.
184 Das Palais Kantgasse 6 wird insofern erwähnt, als dass Ida dort gratis leben darf, wer es erbt wird nicht ausgeführt.
185 Streller: Verschwender und Geizkrägen (1988) 58. Christliche Reiche spendeten eher nur an christliche Arme. Aufgrund des grassierenden Antisemitismus sahen jüdische Unternehmer in der konfessionsunabhängigen Spende eine Möglichkeit, Anfeindungen im Zusammenhang mit Spendentätigkeit zu umgehen.
186 Gutmann: Testament Wilhelm (1895) 22.
187 Gutmann: Testament David (1912) 11.
188 Ebda.
189 Ebd. 2. Von den vier Töchtern wird exlizit Bertha davon ausgeschlossen.
190 In diesem Rahmen konnte ich nicht jede Seite detailliert prüfen. Da der größte Teil in Kurrent verfasst ist, war auch die überblickliche Trennung von wichtigen und nicht gegenständlichen Aktenteilen ein aufwändiges Unterfangen. Der Akt ist deshalb in diesem Rahmen bestmöglich, aber eben nicht vollumfänglich erfasst .
191 Gutmann: Verlassenschaftsabhandlung Wilhelm (1895) GZ 53-6-95 Übergabebestätigung vom 30.11.1941.
192 Ebd. OZ 463.
193 Offenbar wurde im Jahr die Bezeichnung auf Ordnungsnummer (ON) geändert.
194 Ursprünglich waren 750.000 Gulden [1,5 Mio. K.] für das Substitutionsvermögen vorgesehen, dieses sollte mit 4% p.a. veranlagt werden. Verglichen mit dem tatsächlichen Kontostand sind Wilhelms Vorausberechnungen nur in geringem Maß abweichend.
195 Gutmann: Verlassenschaftsabhandlung Wilhelm (1895) GZ 53-6-95 OZ 342.
196 Ebd. OZ 381.
197 Ebd. OZ 380.
198 Ebd. OZ 346.
199 Ebd. OZ 361 und 374.
200 Gutmann: Verlassenschaftsabhandlung Wilhelm (1895) GZ 53-6-95 OZ 385.
201 Ebda. Im Anhang findet sich ein Auschnitt des Originals.
202 Derartige Anschaffungen könnten sich aber vielleicht in den Wertpapieren verstecken.
203 Gutmann: Aus Meinem Leben (1891) 76.
204 Gutmann: Verlassenschaftsabhandlung Wilhelm (1895) GZ 53-6-95 OZ 342.
205 Ebd. OZ 342.
206 Ebd. OZ 385.
207 Eine vierprozentige Kapitalisierung der Gewinne zur Schätzung des gesamten Unternehmenswertes (100 Kuxe) ergibt für das Jahr 1895 80 Mio. K. und für das Jahr 1900 180 Mio. K. Diese Berechnung ist deutlich näher am Wert von 1937 mit 260 Mio. K. als die Hochrechnung der gerichtlichen Einschätzung für das gesamte Unternehmen mit 40 Mio. K. Zwischen diesen recht unterschiedlichen Ergebnissen liegen freilich 4 Dekaden. Witkowitz hat in dieser Zeit eine signifikante fast exponentielle Entwicklung erfahren, das seriöse Gegenüberstellen dieser Werte kann in diesem Rahmen nicht geschehen. Ich neige dazu, der gerichtlichen Einschätzung zu folgen, selbst wenn sie konservativ wäre. Klar ist trotzdem, dass das Eisenwerk Witkowitz eine Millionen schwere Unternehmung ist.
208 Gutmann: Verlassenschaftsabhandlung Wilhelm (1895) GZ 53-6-95 OZ 385.
209 Gutmann: Aus Meinem Leben (1891) 127–128.
210 Deimer: Poliklinik (1989) 19
211 Pacher: Strategien Gutmann (2020) 26.
212 An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass gerade die prominenten hohen Spenden mit David gemeinsam getätigt wurden. Somit müsste auch dessen Vermögen in die Berechnung einfließen. Auch nennt Wilhelm in seinen Memoiren weitere andere wohltätige Unternehmungen. Eine umfassende Berechnung des Verhältnisses der Gutmannschen Spenden zu ihrem Vermögen ist hier nicht möglich. Eine Annäherung an dessen Größenordnung aber sehr wohl.
213 Gutmann: Verlassenschaftsabhandlung Wilhelm (1895) GZ 53-6-95 OZ 418.
214 Ebd. OZ 343.
215 Ebd. OZ 385.
216 Gutmann: Aus Meinem Leben (1891) 51.
217 Registerakt Firma Gebrüder Gutmann (1863) Ges 2/270/1. Hier wird eine unwesentliche Diskrepanz zur Darstellung auf Wikipedia deutlich. Der Gesellschaftsvertrag zwischen David und Wilhelm stammt von 1863, auch in den Memoiren wird David erst ab nach 1856 erwähnt, während auf der Onlineplattform David schon ab 1853 dabei ist.
218 Sandgruber: Traumzeit (2013) 50.
219 Sandgruber (2013) S.306–469.
220 Gutmann: Verlassenschaftsabhandlung Wilhelm (1895) GZ 53-6-95 OZ 385.
221 Gutmann: Testament Wilhelm (1895) 7.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den Reichtum der Familie Gutmann in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg, wobei der Fokus auf der Erbschaft von Wilhelm Gutmann liegt.
Welche Quellen werden hauptsächlich für die Untersuchung verwendet?
Die Hauptquellen sind das Testament von Wilhelm Gutmann und der dazugehörige Verlassenschaftsakt. Zusätzlich werden Memoiren von Wilhelm Gutmann, Testamente von Familienmitgliedern und zeitgenössische Unternehmensverzeichnisse herangezogen.
Was ist der Zweck der Erbschaftsanalyse im Kontext der Reichtumsforschung?
Erbschaften bieten Einblick in Vermögenswerte zu einem bestimmten Zeitpunkt und können wesentliche Hinweise auf den Umfang und die Struktur des Vermögens geben, das zu Lebzeiten möglicherweise nicht vollständig dokumentiert wurde.
Wie umfassend war das Vermögen von Wilhelm Gutmann bis zu seinem Ableben?
Das Gesamtvermögen von Wilhelm Gutmann zum Zeitpunkt seines Todes wird anhand des Testaments und des Verlassenschaftsaktes untersucht. Es zeigt sich, dass sein Vermögen die Grundlage für den Reichtum seiner Familie legte, die um 1910 zu den reichsten Familien in Wien gehörte.
Welche Rolle spielt das Testament im Vergleich zum Verlassenschaftsakt bei der Reichtumsforschung?
Während das Testament Einblicke in persönliche Ansichten und Verteilungsabsichten gibt, enthält es keine Aufstellung des Gesamtvermögens. Der Verlassenschaftsakt ist unerlässlich, da er eine detaillierte Aufstellung des Vermögens zum Zeitpunkt des Todes enthält.
Wie wird der Reichtum der Familie Gutmann im Vergleich zu anderen wohlhabenden Familien in Wien um 1900 eingeordnet?
Die Quellen deuten darauf hin, dass die Familie Gutmann hinter den Rothschilds als die zweitreichste Familie in Wien um 1900 genannt werden kann, wobei ihr Vermögen deutlich näher an der Gruppe der Rothschild-Nachfolger liegt als an den Rothschilds selbst.
Welche Bedeutung hat das Familienunternehmen "Gebrüder Gutmann" für den Reichtum der Familie?
Wilhelm Gutmann war Firmengründer von "Gebrüder Gutmann", einem bedeutenden Großhandelsunternehmen in Österreich-Ungarn, insbesondere im Kohle-, Eisen- und Stahlhandel. Der Anteil am Unternehmen trug wesentlich zum Familienreichtum bei.
Welche Anlagestrategien verfolgte Wilhelm Gutmann?
Die Familie Gutmann diversifizierte ihre Investitionen in verschiedenen Branchen wie Kohle, Eisen, Stahl, Zuckerfabriken und Immobilien, wobei sie sowohl vertikale als auch horizontale Integration zur Risikostreuung nutzte.
Wie wird die Spendenfreudigkeit von Wilhelm Gutmann im Kontext seines Vermögens bewertet?
Obwohl Wilhelm Gutmann für seine Wohltätigkeit bekannt ist, machen die testamentarisch bestimmten Spenden nur einen geringen Prozentsatz seines Gesamtvermögens aus, was ein gewisses Missverhältnis zwischen der Betonung der Spenden und ihrer tatsächlichen Höhe im Vergleich zu anderen Ausgaben und dem Gesamtvermögen zeigt.
Was war der Wert von Wilhelm Gutmanns Vermögen zum Zeitpunkt seines Todes laut Verlassenschaftsakt?
Das gerichtlich bewertete Gesamtvermögen von Wilhelm Gutmann zum Zeitpunkt seines Todes betrug 42 Millionen Kronen.
Welche Rolle spielte das Unternehmen "Witkowitzer Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft" im Vermögen der Gutmanns?
Der Wert der Anteile an der "Witkowitzer Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft" machte mit 8 Millionen Kronen einen wesentlichen Teil (18%) des Nachlasses von Wilhelm Gutmann aus und war somit das wertvollste Einzelunternehmen in seinem Portfolio.
- Quote paper
- Gerold Pacher (Author), 2022, Der Reichtum der Familie Gutmann vor dem Ersten Weltkrieg. Das Erbe von Wilhelm Gutmann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1313143