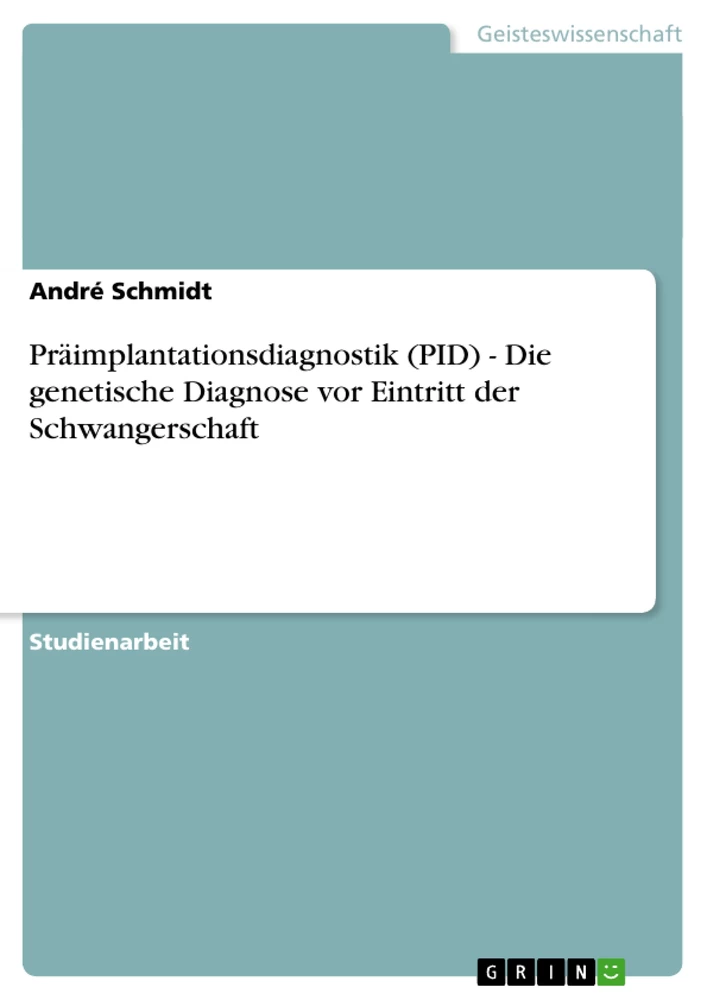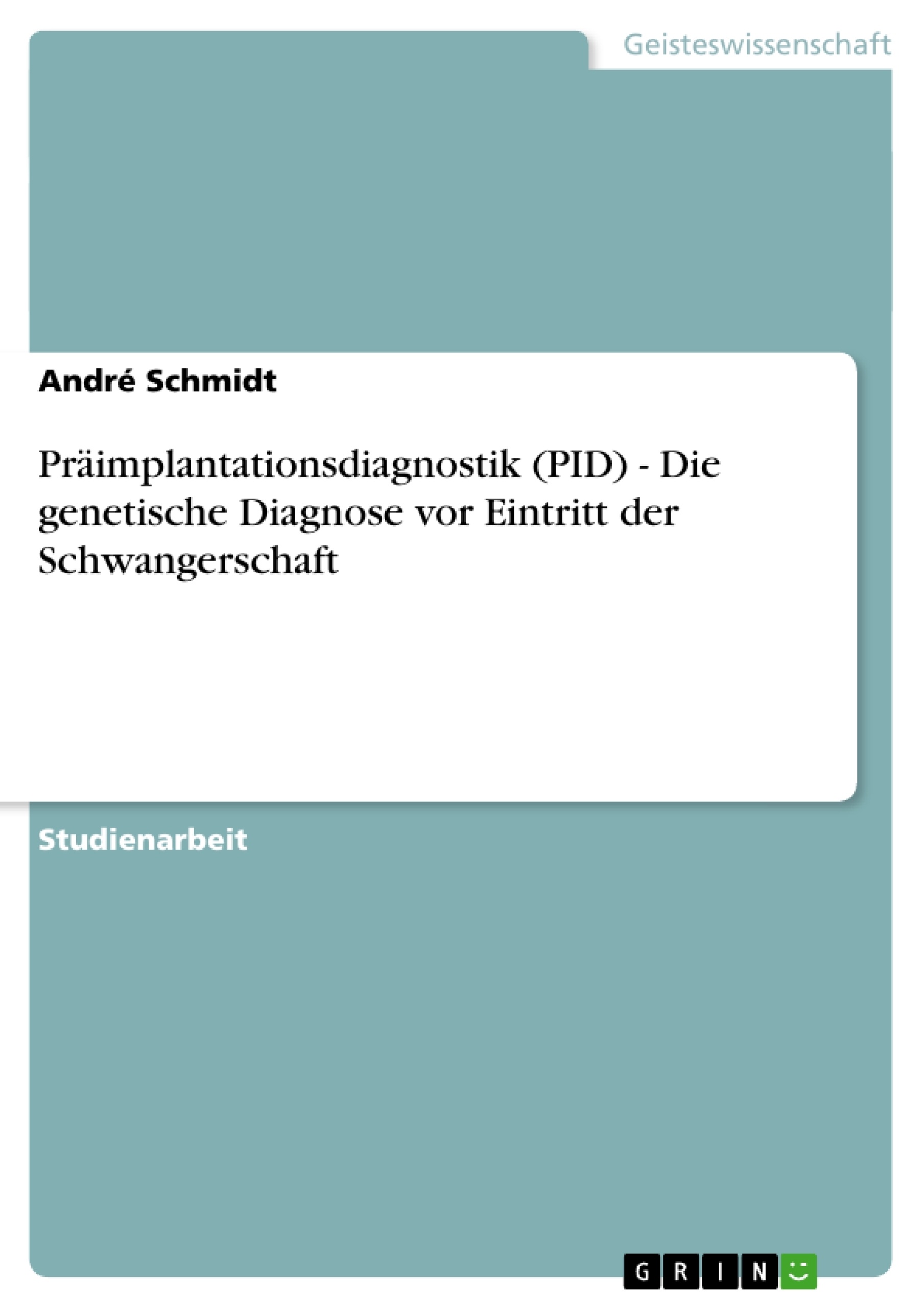In dieser Seminararbeit sollen anhand von ausgewählten Aufsätzen und Abhandlungen verschiedener Autoren, wie Regine KOLLEK, Bernhard IRRGANG und Markus HENGSTSCHLÄGER unterschiedliche philosophische Positionen zu der umstrittenen Thematik der Präimplantationsdiagnostik (PID) näher betrachtet werden. Dabei wird für ein besseres Verständnis neben einer anfänglichen aktuellen Problemstellung der Gegenstand auch in einen kurzen sozialen Kontext eingegliedert. Ein Schwerpunkt dieser Arbeit soll auf die Vorstellung sowie der ethischen Reflexion der wissenschaftlich-technischen Probleme sowie den biologischen Grenzen, die mit der PID verbunden sind, gelegt werden. Ein Hauptaugenmerk wird dabei der Fragestellung gewidmet sein, inwieweit die möglichen gesundheitlichen Risiken für die betroffenen Frauen und Kinder sowie die daraus resultierenden sozialen, rechtlichen und besonderes auch ethischen Implikationen in der Gesellschaft reflektiert werden. Im Speziellen soll dabei ein grundsätzlicher Blick auf das Machbare und das Nichtmachbare sowie auf das Wünschenswerte und das Nichtwünschenswerte im Zusammenhang mit dem fiktiven Ruf nach genetisch perfekten Kindern durch eine Aufarbeitung der aktuellen biomedizinischen Fortschritte geworfen werden, indem auch der Frage nachgegangen werden soll, in wieweit die neuartigen Qualitäten, welche die PID in das Handlungsfeld der genetischen Untersuchung einbringt, den Umgang mit dem werdenden menschlichen Lebens zukünftig verändern könnte.
Als wissenschaftliche Grundlagen zur Klärung dieser Fragen dient unter anderem der umfassende Überblick über den aktuellen Stand der biomedizinischen Forschung aus dem Werk „Präimplantationsdiagnostik. Embryonenselektion, weibliche Auto-nomie und Recht“ der Autorin Regine KOLLEK. Neben Aufsätzen wie „Analyse ethischer Positionen zur Präimplantationsdiagnostik“ von Hans-Martin BRÜLL wird aber auch Sekundärliteratur, wie die Monographien Markus HENGSTSCHLÄGERs „Das ungeborene menschliche Leben und die moderne Biomedizin. Was kann man, was darf man?“ und „Soll der Mensch biotechnisch machbar werden? Eugenik, Behinderung und Pädagogik“ von Otto SPECK sowie die orientierende Abhandlung „Einführung in die Bioethik“ von Bernhard IRRGANG hierfür herangezogen, um auch die Untersuchungen anderer Fachleute sowie den Forschungsstand mit einzubeziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die aktuelle Problemstellung
- Die Chance einer Möglichkeit
- Ethische Herausforderungen
- Naturwissenschaftlich-medizinischer Sachstand
- Die Untersuchung des Embryos - Embryobiopsie
- Die Analyse des Erbmaterials
- Anwendungsgebiete der PID
- Einwände gegen die Präimplantationsdiagnostik
- Risiken und Gefahren von Mikromanipulationen
- Gesundheitliche Konsequenzen für Frauen
- Das Embryonenschutzgesetz
- Weitere Einwände
- Alternative Techniken
- Die Blastozystenbiopsie
- Die Alternative der Polkörperbiopsie
- Exkurs: Neue bioethische Herausforderungen
- Die biologischen Grenzen des Tierversuchs
- Das vermittelnde Konzept des Gradualismus
- Die Zona Pellucida Definition
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht verschiedene philosophische Positionen zur Präimplantationsdiagnostik (PID), indem sie den naturwissenschaftlich-medizinischen Sachstand mit ethischen Reflexionen verbindet. Besonderes Augenmerk liegt auf den gesundheitlichen Risiken für Frauen und Kinder sowie den daraus resultierenden sozialen, rechtlichen und ethischen Implikationen. Die Arbeit beleuchtet das Spannungsfeld zwischen dem Machbaren und Wünschenswerten im Kontext des Strebens nach genetisch perfekten Kindern und analysiert die Auswirkungen der PID auf den Umgang mit entstehendem Leben.
- Ethische Herausforderungen der PID
- Naturwissenschaftlich-medizinischer Stand der PID
- Gesundheitliche Risiken und soziale Implikationen der PID
- Alternative Techniken zur PID
- Bioethische Herausforderungen im Zusammenhang mit der PID
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht philosophische Positionen zur PID anhand von Aufsätzen verschiedener Autoren, betrachtet die aktuelle Problemstellung im sozialen Kontext und reflektiert wissenschaftlich-technische Probleme sowie biologische Grenzen der PID. Ein Schwerpunkt liegt auf den gesundheitlichen Risiken für Frauen und Kinder und deren ethischen Implikationen. Die Arbeit fragt nach dem Machbaren, Wünschenswerten und den Auswirkungen der PID auf den Umgang mit entstehendem Leben. Sie bezieht den aktuellen Stand der biomedizinischen Forschung ein.
Die aktuelle Problemstellung: Dieses Kapitel beginnt mit der Darstellung der engen Verbindung von Faszination und Unsicherheit in der Gen- und Reproduktionstechnologie. Es beschreibt die Entwicklung der IVF und ICSI, bevor die PID als Verfahren der genetischen Untersuchung eingeführt wird. Der Text hebt das gestiegene Interesse an den Anwendungsmöglichkeiten dieser neuen Biotechnologien hervor und diskutiert die gesellschaftlichen Visionen vom "neuen Menschen", die mit der PID verbunden sind, und die Gefahren eines ungezügelten Perfektionsstrebens. Das Kapitel endet mit der Beschreibung der gegensätzlichen Haltung gegenüber einem "Menschen nach Maß" und dem Notwendigkeit einer Diskussion über die Risiken und Chancen der PID.
Naturwissenschaftlich-medizinischer Sachstand: Dieses Kapitel würde detailliert den wissenschaftlichen Hintergrund der PID beschreiben, einschließlich der Methoden der Embryobiopsie und der Analyse des Erbmaterials. Es würde auch die verschiedenen Anwendungsgebiete der PID erläutern. Diese Zusammenfassung fehlt im gegebenen Text.
Einwände gegen die Präimplantationsdiagnostik: Dieses Kapitel behandelt die Kritik an der PID. Es würde eingehen auf die Risiken von Mikromanipulationen, die gesundheitlichen Konsequenzen für Frauen, das Embryonenschutzgesetz und weitere ethische Bedenken. Diese Zusammenfassung fehlt im gegebenen Text.
Alternative Techniken: Hier werden alternative Techniken zur PID vorgestellt, wie die Blastozystenbiopsie und die Polkörperbiopsie. Ihre Vor- und Nachteile im Vergleich zur PID würden diskutiert. Diese Zusammenfassung fehlt im gegebenen Text.
Exkurs: Neue bioethische Herausforderungen: Dieses Kapitel erörtert neue bioethische Herausforderungen, die im Zusammenhang mit der PID auftreten. Es diskutiert die biologischen Grenzen des Tierversuchs, das Konzept des Gradualismus und die Zona Pellucida Definition. Diese Zusammenfassung fehlt im gegebenen Text.
Schlüsselwörter
Präimplantationsdiagnostik (PID), Gen- und Reproduktionstechnologie, In-vitro-Fertilisation (IVF), Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI), Ethische Herausforderungen, Gesundheitliche Risiken, Embryonenschutzgesetz, Bioethik, Biomedizinische Forschung, Genetische Diagnostik, Reproduktionsmedizin, Humangenetik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Präimplantationsdiagnostik (PID)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht verschiedene philosophische Positionen zur Präimplantationsdiagnostik (PID). Sie verbindet den naturwissenschaftlich-medizinischen Sachstand mit ethischen Reflexionen und konzentriert sich besonders auf die gesundheitlichen Risiken für Frauen und Kinder sowie die daraus resultierenden sozialen, rechtlichen und ethischen Implikationen. Die Arbeit analysiert das Spannungsfeld zwischen Machbarkeit und Wünschenswertem im Kontext des Strebens nach genetisch perfekten Kindern und untersucht die Auswirkungen der PID auf den Umgang mit entstehendem Leben.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt ethische Herausforderungen der PID, den naturwissenschaftlich-medizinischen Stand der PID, gesundheitliche Risiken und soziale Implikationen der PID, alternative Techniken zur PID und bioethische Herausforderungen im Zusammenhang mit der PID. Sie umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur aktuellen Problemstellung, ein Kapitel zum naturwissenschaftlich-medizinischen Sachstand, ein Kapitel zu Einwänden gegen die PID, ein Kapitel zu alternativen Techniken, einen Exkurs zu neuen bioethischen Herausforderungen und eine Schlussbemerkung.
Welche Kapitel sind in der Seminararbeit enthalten und worum geht es darin?
Die Seminararbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (Einführung in die Thematik und Forschungsfrage), Die aktuelle Problemstellung (Entwicklung der PID, gesellschaftliche Visionen und ethische Bedenken), Naturwissenschaftlich-medizinischer Sachstand (Methoden der PID, Anwendungsgebiete – detaillierte Beschreibung fehlt im Preview), Einwände gegen die Präimplantationsdiagnostik (Risiken, ethische Bedenken, rechtliche Aspekte – detaillierte Beschreibung fehlt im Preview), Alternative Techniken (z.B. Blastozystenbiopsie, Polkörperbiopsie – detaillierte Beschreibung fehlt im Preview), Exkurs: Neue bioethische Herausforderungen (biologische Grenzen des Tierversuchs, Gradualismus, Zona Pellucida Definition – detaillierte Beschreibung fehlt im Preview) und Schlussbemerkung (Zusammenfassung und Fazit).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Präimplantationsdiagnostik (PID), Gen- und Reproduktionstechnologie, In-vitro-Fertilisation (IVF), Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI), Ethische Herausforderungen, Gesundheitliche Risiken, Embryonenschutzgesetz, Bioethik, Biomedizinische Forschung, Genetische Diagnostik, Reproduktionsmedizin, Humangenetik.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, verschiedene philosophische Positionen zur PID zu untersuchen und den naturwissenschaftlich-medizinischen Sachstand mit ethischen Reflexionen zu verbinden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den gesundheitlichen Risiken für Frauen und Kinder sowie den sozialen, rechtlichen und ethischen Implikationen der PID. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der PID auf den Umgang mit entstehendem Leben und das Spannungsfeld zwischen Machbarkeit und Wünschenswertem im Kontext des Strebens nach genetisch perfekten Kindern.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die im Preview bereitgestellte Zusammenfassung enthält nur eine kurze Übersicht über die einzelnen Kapitel. Detaillierte Informationen zum naturwissenschaftlich-medizinischen Sachstand, zu den Einwänden gegen die PID, zu den alternativen Techniken und zu den neuen bioethischen Herausforderungen sind in der vollständigen Seminararbeit enthalten.
- Quote paper
- André Schmidt (Author), 2006, Präimplantationsdiagnostik (PID) - Die genetische Diagnose vor Eintritt der Schwangerschaft , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131224