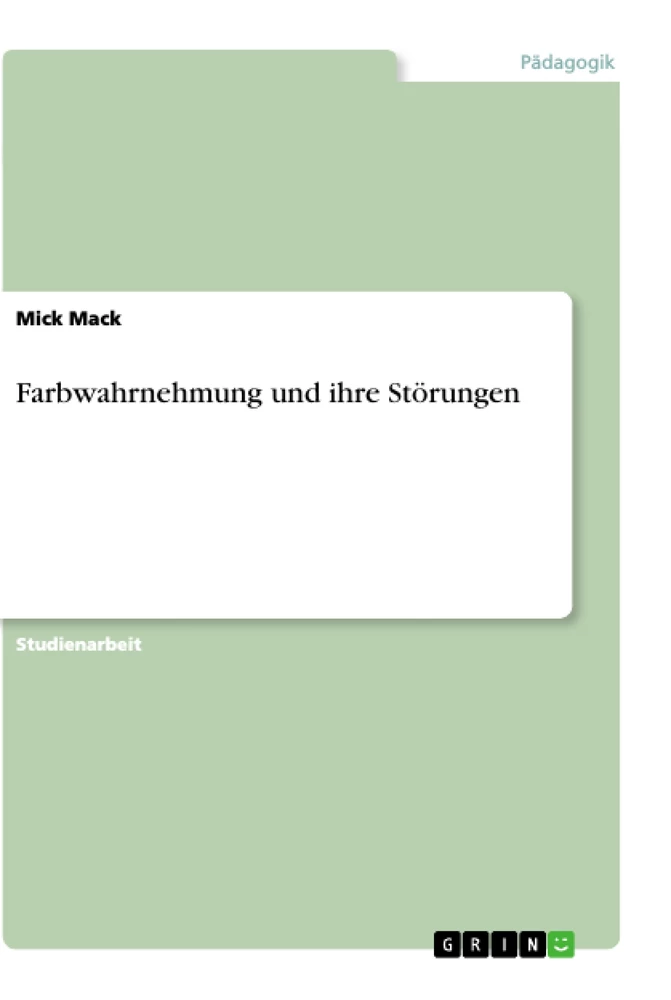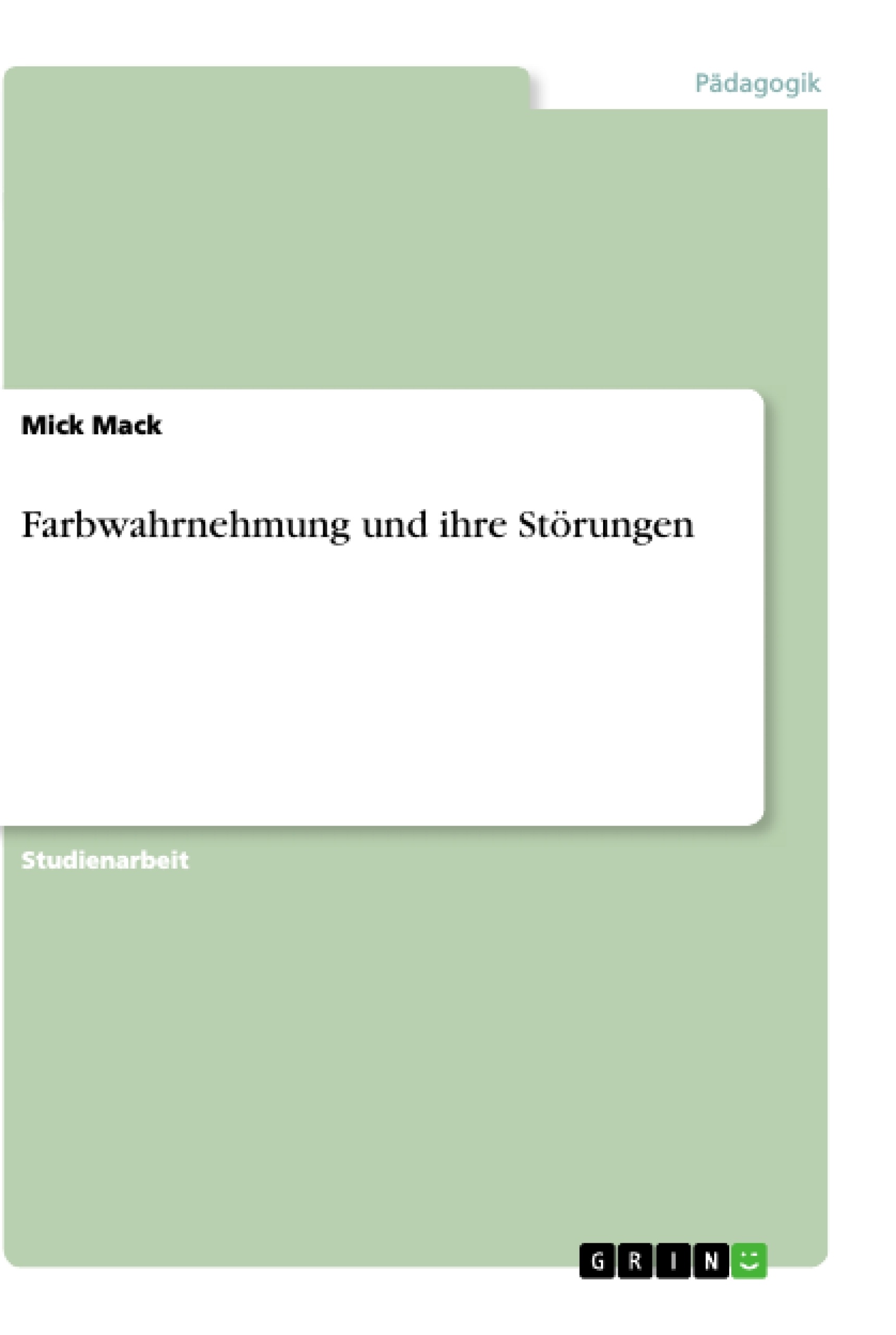Was ist Farbe? Wie entsteht Farbe? Ist Farbe nur eine Produktion unserer Wahrnehmungen und Empfindungen in unserem Gehirn? Wie findet die Farbwahrnehmung statt? Mit welchen Einschränkungen müssen Farbsehschwache und Farbenblinde im Alltag leben?
Im Blick dieser Fragen möchte ich in den folgenden Seiten den Leser in die Farbwahrnehmung einführen. Den Anfang bilden theoretische Grundlagen der Farbwahrnehmung über die Farbtheorien von Young und Helmholtz. Nachdem der ganzheitliche Prozess der Farbwahrnehmung verdeutlicht wurde, widme ich mich
im nächsten großen Kapitel der unterschiedlichen Farbsehstörungen. Anhand eines Fallbeispiels möchte ich zum Schluss das erwähnte mit einem Einblick in die visuelle
Wahrnehmung eines Farbenblinden konkretisieren.
Farbe ist ein psychologisches Phänomen. Farbe ist so natürlich in der Wahrnehmung des heutigen Menschen, dass man sich keine Gedanken darüber macht, wie denn eigentlich die Farbe entsteht oder wie das visuelle System des Farbsehens funktioniert.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Farbwahrnehmung
2.1 Die Farbtheorien
2.2 Prozess der Farbwahrnehmung
3. Farbsehstörungen
3.1 Farbsehschwächen
3.2 Farbenblindheit
4. Diagnose
5. Der Umgang mit einer Farbsehstörung
6. Schluss – Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Was ist Farbe? Wie entsteht Farbe? Ist Farbe nur eine Produktion unserer Wahrneh-mungen und Empfindungen in unserem Gehirn? Wie findet die Farbwahrnehmung statt? Mit welchen Einschränkungen müssen Farbsehschwache und Farbenblinde im Alltag leben?
Im Blick dieser Fragen möchte ich in den folgenden Seiten den Leser in die Farb-wahrnehmung einführen. Den Anfang bilden theoretische Grundlagen der Farb-wahrnehmung über die Farbtheorien von Young und Helmholtz. Nachdem der ganzheitliche Prozess der Farbwahrnehmung verdeutlicht wurde, widme ich mich im nächsten großen Kapitel der unterschiedlichen Farbsehstörungen. Anhand eines Fallbeispiels möchte ich zum Schluss das erwähnte mit einem Einblick in die visu-elle Wahrnehmung eines Farbenblinden konkretisieren.
Farbe ist ein psychologisches Phänomen. Farbe ist so natürlich in der Wahrneh-mung des heutigen Menschen, dass man sich keine Gedanken darüber macht, wie denn eigentlich die Farbe entsteht oder wie das visuelle System des Farbsehens funktioniert.
Grundlage des visuellen Denkens und Sehens ist allen voran unser Auge. Dieses enorm wichtige Organ unseres Körpers ist eines der größten Rezeptoren die ein Mensch besitzt. „Schon der Jenaer Philosoph und Physiker J.F. Fries (1773–1843) schrieb 1818 in seinem „Handbuch der psychischen Anthropologie“ über das Se-hen: »Für die Kenntnis der Natur ist der Mensch ein Zögling des Auges. [...] Der Sehende fasst das ganze Leben der Natur um sich her durch Licht und Farbe, das Auge ist unser Weltsinn.«“ {Birbaumer 2003: 374}
Licht und Farbe sind die wichtigsten Elemente unserer Wahrnehmung. Diese inter-essante Beziehung zwischen Licht und Farbe hat der berühmte Physiker Isaac Newton im 18. Jahrhundert schon entdeckt und konnte anhand des Prismenglases die un-terschiedlichen Spektralfarben des Sonnenlichts erzeugen. Licht ist eine elektroma-gnetische Wellenlänge von 400-700 Nanometern (nm). Die Farben haben eine un-terschiedliche Wellenlänge, z.B. besitzt die Farbe „Blau“ eine relativ kurze Wellen-länge. Wenn man nun von Farbe spricht, ist immer die Farbe als Wellenlänge zu be-trachten bzw. die Empfindung die daraus entsteht. Welche Funktion Farbe hat, kann man wahrnehmungspsychologisch eher nicht erklären. Dabei handelt es sich wohl um ein evolutionäres Phänomen {vgl. Goldstein 2008: 156}. Wie der Prozess der Farbwahrnehmung passiert und welche Grundlagen dazu benötigt werden, erkläre ich im folgenden Kapitel.
2. Die Farbwahrnehmung
Bevor es detailliert zur Farbwahrnehmung kommt, gehe ich kurz auf den Begriff Wahrnehmung ein: Die Wahrnehmung entsteht durch den „Reizinput“ das durch unser Auge aufgenommen wird. Reize, wie Umweltreize (z.B. ob es regnet oder sonnig ist) und Körperreize, werden durch unser Auge wahrgenommen und in unser Gehirn weitergeleitet.
Positive Empfindungen entstehen meist durch - an unserem Beispiel bleibend - wenn sonniges Wetter draußen ist. Diese Empfindungen bilden zusammen mit Er-fahrungen aus früheren Ereignissen die ganzheitliche visuelle Wahrnehmung. Nach Myers ist somit „Empfindung und Wahrnehmung ein kontinuierlicher Prozess“ {Myers 2008: 215}. Die Empfindung (sensation) ein „Prozess bei dem unsere Sin- nesrezeptoren und unser Nervensystem Reizenergien aus unserer Umwelt empfan-gen und darstellen“ und die Wahrnehmung (perception) ein „Prozess, bei dem die sensorischen Informationen organisiert und interpretiert werden“, was uns bei der Erkennung von der Bedeutung von Gegenständen und Ereignissen ermöglicht {Myers 2008: 214}.
2.1 Die Farbtheorien
Die Farbtheorien der Wissenschaftler Young und Helmholtz sind die bekanntesten Theorien unserer Zeit. Young hat im 19. Jahrhundert mit Experimenten am Farbmi-scher bewiesen, dass „jede mögliche Farbempfindung [...] durch eine Mischung der Grundfarben“ entsteht {vgl. Goldstein: 160ff}. Er behauptete, dass drei Grundfar-ben zur Mischung von Farben reichen. Diese wurden später international als Rot (700nm), Grün (546nm) und Blau (435nm) festgelegt, obwohl sie physiologisch nicht eindeutig festgelegt sind. Die additive Farbmischung meint die Mischung von Farbe als Licht, also als Wellenlängen, z.B. mit Farbmischern. Wird weißes Licht durch einen Blaufilter und einen Gelbfilter gesendet, so erhält man grünes Licht. Der Blaufilter schluckt gelbes und rotes Licht, der Gelbfilter blaues Licht. Bei Pig-mentfarben (Malen) handelt es sich um subtraktive Farben, da die Körner der Far-ben wie Farbfilter wirken.
Später hat Hering als Gegenfarbtheorie die Vermutung aufgestellt, dass die Urfar-ben Rot, Gelb, Blau und Grün sind. Dabei hat er entdeckt, dass die Wirkung der Ge-genfarben Rot/Grün und Blau/Gelb sowie Schwarz/Weiß antagonistisch stattfinden. Diese Wahrnehmung kann man bei den sogenannten Nachbildern feststellen, da diese Farbpaare auch komplementär zueinander sind. Jeder kennt das Phänomen, wenn man in ein gelbes Blitzlicht geschaut hat, bekommt man blaue Punkte zu se-hen {vgl. Goldstein 2008: 169}
Doch was haben die Farbtheorien mit dem eigentlichen Vorgang des Farbsehens miteinander zu tun? Helmholtz war der Auffassung, dass diese Grundfarben von Young die Voraussetzung für das Farbsehen bilden. Durch die unterschiedliche Er-regung der Sensoren (Zapfen) auf der Netzhaut (Retina), entstehen durch die Ver-rechnung der antreffenden Wellenlängen die jeweiligen Farben. Wie dies aber ge-nau abläuft, erkläre ich im nächsten Kapitel.
2.2 Der Prozess der Farbwahrnehmung
Das Auge als „Reizinput“ nimmt als erstes die Wellenlängen des Lichts wahr. Diese wurden davor von den Gegenständen der Umgebung jeweils absorbiert und reflek-tiert. Wenn man eine rote Tasse (s. Abb.1) ansieht, werden die Lichtstrahlen im Material der Tasse absorbiert und nur der rote Lichtstrahl bzw. die rote Wellenlänge - „Lichtstrahlen haben keine Farbe“ {Isaac Newton, zitiert in: Myers 2008: 231} - wird wieder reflektiert. Jene Wellenlänge (im Licht) passiert die transparente Horn-haut und die Linse.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text ist eine Einführung in die Farbwahrnehmung, die Farbstörungen und den Umgang mit diesen. Er beinhaltet eine Einführung, Erklärungen zur Farbwahrnehmung (inklusive Farbtheorien), Informationen über Farbsehstörungen, Diagnosemöglichkeiten, Strategien zum Umgang mit Farbsehstörungen und ein Fazit.
Was sind die Hauptthemen des Textes?
Die Hauptthemen sind Farbwahrnehmung, Farbtheorien (Young-Helmholtz und Gegenfarbtheorie von Hering), Farbsehstörungen (Farbsehschwächen und Farbenblindheit), Diagnose und der Umgang mit Farbsehstörungen im Alltag.
Wie wird die Farbwahrnehmung im Text erklärt?
Der Text erklärt die Farbwahrnehmung als einen Prozess, der mit der Aufnahme von Reizen durch das Auge beginnt. Diese Reize werden dann ins Gehirn weitergeleitet und dort interpretiert. Es wird auf die Bedeutung von Empfindung und Wahrnehmung eingegangen und die Theorien von Young und Helmholtz (additive Farbmischung) sowie die Gegenfarbtheorie von Hering werden erläutert.
Was sind die Farbtheorien nach Young und Helmholtz?
Young hat mit Experimenten bewiesen, dass jede mögliche Farbempfindung durch eine Mischung der Grundfarben (Rot, Grün, Blau) entsteht. Helmholtz war der Auffassung, dass diese Grundfarben die Voraussetzung für das Farbsehen bilden und dass durch die unterschiedliche Erregung der Sensoren (Zapfen) auf der Netzhaut die jeweiligen Farben entstehen.
Was ist die Gegenfarbtheorie von Hering?
Hering stellte die Vermutung auf, dass die Urfarben Rot, Gelb, Blau und Grün sind. Er entdeckte, dass die Wirkung der Gegenfarben Rot/Grün und Blau/Gelb sowie Schwarz/Weiß antagonistisch stattfindet. Dies kann man bei Nachbildern feststellen.
Wie wird der Prozess der Farbwahrnehmung detailliert beschrieben?
Das Auge nimmt die Wellenlängen des Lichts wahr, die von Gegenständen absorbiert und reflektiert werden. Die reflektierte Wellenlänge passiert Hornhaut und Linse. Die Sensoren (Zapfen) auf der Netzhaut reagieren auf diese Wellenlängen, wodurch die Farbwahrnehmung entsteht.
Welche Arten von Farbsehstörungen werden im Text erwähnt?
Im Text werden Farbsehschwächen und Farbenblindheit als Arten von Farbsehstörungen erwähnt.
Was sind die Themen der einzelnen Kapitel?
Die Kapitel behandeln: 1. Einleitung in das Thema Farbe. 2. Die Farbwahrnehmung und die zugrunde liegenden Theorien. 3. Farbsehstörungen. 4. Diagnose von Farbsehstörungen. 5. Der Umgang mit Farbsehstörungen. 6. Schlussfolgerungen.
- Arbeit zitieren
- Mick Mack (Autor:in), 2009, Farbwahrnehmung und ihre Störungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/131213